Polnische Reportagen
Erstmals sind mit "Ein Paradies für Ethnographen" auf Deutsch frühe polnische Reportagen von Ryszard Kapuscinski erschienen. Es ist eine Zeitreise in die Jahre vor und nach dem Krieg.
Im Anfang war der Krieg.
"Ich stapfe mit der Schwester neben dem Fuhrwerk her, einem einfachen hölzernen Leiterwagen, der mit Heu ausgelegt ist, und hoch oben auf dem Heu, auf einer leinenen Plane, liegt mein Großvater. Er kann sich nicht rühren, denn er ist gelähmt.
Wenn ein Fliegerangriff beginnt, bringt sich die geduldig dahinstapfende, dann schlagartig von Panik erfasste Schar von Flüchtlingen im Straßengraben in Sicherheit, versteckt sich in Büschen, sucht in Kartoffeläckern Deckung (...). Wenn die Flugzeuge in der Ferne verschwinden, laufen wir zum Fuhrwerk zurück, und die Mutter wischt dem Großvater den Schweiß vom Gesicht."
Dies ist die Urszene, die Kapuscinskis Leben und Schreiben bis in die Gegenwart prägen wird. Aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten von der Roten Armee vertrieben, wird er fortan keine Ruhe mehr finden und den Opfern der Kriege und anderer Emanationen der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts über die ganze Welt folgen.
Die Spurensuche beginnt 1950 als Reporter einer Jugendzeitschrift und hat als ersten Höhepunkt die zu Recht als "Polnische Geschichten" bezeichneten Reportagen, die er zwischen 1959 und 1962 für "Polityka" schrieb und die in diesem Band gesammelt sind. Kapuscinski erinnert sich an diese Zeit:
"Ich war ein junger Reporter und reiste auf den Spuren von Leserbriefen durchs Land. Die Absender beklagten sich über erlittenes Unrecht und ihre Armut, darüber, dass ihnen der Staat die letzte Kuh weggenommen hatte oder dass es in ihrem Dorf noch immer kein elektrisches Licht gab."
Reportage und die Herrschaft einer kommunistischen Partei - diesen Widerspruch zu lösen und als Einzelner den Bedingungen einer Diktatur zu trotzen und, ohne ernsthaft mit ihr zu kollidieren, ein wahrhaftiges Bild des Menschen zu zeichnen, das macht das Lebenswerk Kapuscinskis aus. Ihm kam zu Hilfe, dass sich nach Stalins Tod die Zensur in Polen gelockert hatte und dass es ihm ohnehin weniger auf die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse als auf die Darstellung menschlicher Schicksale ankam.
"Geschichten" heißen diese Reportagen zu Recht, weil sie in das Innenleben ihrer Protagonisten eindringen, weil sie aus deren Sicht eine Welt zu schildern vermögen, die über die aktuelle politische Situation hinaus ein Ort der Bewährung ist. Es ist ein unheilvoller Ort, und vom Heil verlassen sind die, die darin wandeln.
Die beiden deutschen Frauen, Mutter und Tochter, die geistesverwirrt aus einem Altersheim fliehen und ihr enteignetes Haus wieder beziehen wollen, weil sie einer Radiomeldung entnommen haben, die Amerikaner seien im Anmarsch und mit ihnen ihr Sohn und Bruder aus Deutschland. Die aus allen Ecken des Landes herbei gewehten Säufer, die eine von Sanddünen umgebene Kolchose bewirtschaften sollen.
Die ehemaligen Studenten, die weiter in ihrem Warschauer Wohnheim hausen, von den Essensresten der anderen leben und ihnen das Stipendium bei Karten- und Würfelspielen abzunehmen versuchen. Und in dem am meisten beeindruckenden Text die sechs Bergarbeiter, die ihren verunglückten Kumpel in seinen Heimatort bringen sollen und den Sarg auf den Schultern tragen müssen, weil der Lastwagen mit Panne liegenblieb.
"Dabei wissen wir nicht, wie er war. Keiner von uns hat ihn je gesehen. Stefan Kanik, 18 Jahre alt, durch einen Unfall ums Leben gekommen. Mehr wissen wir nicht. Jetzt können wir noch hinzufügen, dass er ungefähr 60 Kilo wog. Der Rest ist ein Geheimnis. Eine Vermutung.
Und dieses Rätsel der unsichtbaren Person, die so fremd und steif da liegt, beherrscht die sechs Lebenden, ihre Gedanken, entzieht ihren Körpern die Kraft. Kühl und schweigend nimmt der Tote ihre Opfergabe der Entsagung, der Demut, des Einwilligens in dieses seltsame Schicksal entgegen."
Kapuściński ist einer von den Sechsen. Der Reporter hat am Sarg mit angefasst, weil er nicht bloß ein Schalltrichter sein will, weil er nicht nur Geschichten erzählen will, sondern jene Geschichte mit seinen Figuren teilt, von der er sagt, der Mensch trägt sie in seinen Knochen mit sich herum. Die fünf Bergarbeiter und der Reporter schaffen es bis zum Abend nicht bis in das Heimatdorf des Toten und beschließen, in einem Wald zu übernachten. Nachdem sie den Sarg ins Gebüsch geschoben und ein Feuer entzündet haben, hören sie Stimmen.
"Die Stimmen kommen immer näher. Endlich sieht man Gestalten. Zwei, drei, fünf.
Mädchen. Sechs, sieben.
Acht Mädchen."
Die jungen Männer können die Mädchen dazu bewegen, sich zu ihnen ans Feuer zu setzen.
"Wir betrachten die Mädchen. Sie tragen bunte Kleider und haben nackte Arme, von der Sonne gebräunt, die nun im Schein des Feuers abwechselnd golden und braun schimmern. Sie werfen scheinbar gleichgültige und doch aufreizende und zugleich wachsame, zugängliche und unerreichbare Blicke ins flackernde Feuer, ganz offensichtlich erfüllt sie die seltsame, irgendwie heidnische Stimmung, die ein nachts im Wald entzündetes Feuer im Menschen weckt (...) Man braucht bloß die Hand auszustrecken, um ein Mädchen zu umarmen, aber man braucht auch nur ein paar Schritte zu machen und sich über den Sarg zu beugen, und zwischen dem Schönsten auf der Welt und dem grausamen Tod - stehen wir."
Zwischen der Liebe und dem Tod, dem Frieden und dem Krieg, dem Tun und dem Erleiden bewegen sich alle Menschen in diesem Buch. Und wie die Bergarbeiterhände nicht den Weg zu den nackten Armen der Mädchen finden, so bleiben auch die der meisten anderen Figuren tatenlos. Es sind die Verlierer und die Verzweifelten, die Tollpatsche, Trinker und die Träumer, denen Kapuscinski sein Mitgefühl und seine gestalterische Kraft widmet. Er sagt:
"Aus dem Krieg kommen, das bedeutete, sich innerlich zu reinigen, vor allem vom Hass."
Im Schreiben hat er diese Reinigung vollzogen und an die Stelle des Hasses die Empathie gesetzt. Sie versetzt ihn in die Lage, in einer trostlosen Umgebung das Menschliche zu entdecken und zu schildern. Mit leisem Pathos, nicht ohne pädagogische Versuchung, mit Melancholie und wehmütigem, gelassenem und mitunter bitterem Humor - ein großer Schriftsteller kündigt sich an.
Ryszard Kapuscinski: Ein Paradies für Ethnographen - Polnische Geschichten
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2010
"Ich stapfe mit der Schwester neben dem Fuhrwerk her, einem einfachen hölzernen Leiterwagen, der mit Heu ausgelegt ist, und hoch oben auf dem Heu, auf einer leinenen Plane, liegt mein Großvater. Er kann sich nicht rühren, denn er ist gelähmt.
Wenn ein Fliegerangriff beginnt, bringt sich die geduldig dahinstapfende, dann schlagartig von Panik erfasste Schar von Flüchtlingen im Straßengraben in Sicherheit, versteckt sich in Büschen, sucht in Kartoffeläckern Deckung (...). Wenn die Flugzeuge in der Ferne verschwinden, laufen wir zum Fuhrwerk zurück, und die Mutter wischt dem Großvater den Schweiß vom Gesicht."
Dies ist die Urszene, die Kapuscinskis Leben und Schreiben bis in die Gegenwart prägen wird. Aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten von der Roten Armee vertrieben, wird er fortan keine Ruhe mehr finden und den Opfern der Kriege und anderer Emanationen der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts über die ganze Welt folgen.
Die Spurensuche beginnt 1950 als Reporter einer Jugendzeitschrift und hat als ersten Höhepunkt die zu Recht als "Polnische Geschichten" bezeichneten Reportagen, die er zwischen 1959 und 1962 für "Polityka" schrieb und die in diesem Band gesammelt sind. Kapuscinski erinnert sich an diese Zeit:
"Ich war ein junger Reporter und reiste auf den Spuren von Leserbriefen durchs Land. Die Absender beklagten sich über erlittenes Unrecht und ihre Armut, darüber, dass ihnen der Staat die letzte Kuh weggenommen hatte oder dass es in ihrem Dorf noch immer kein elektrisches Licht gab."
Reportage und die Herrschaft einer kommunistischen Partei - diesen Widerspruch zu lösen und als Einzelner den Bedingungen einer Diktatur zu trotzen und, ohne ernsthaft mit ihr zu kollidieren, ein wahrhaftiges Bild des Menschen zu zeichnen, das macht das Lebenswerk Kapuscinskis aus. Ihm kam zu Hilfe, dass sich nach Stalins Tod die Zensur in Polen gelockert hatte und dass es ihm ohnehin weniger auf die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse als auf die Darstellung menschlicher Schicksale ankam.
"Geschichten" heißen diese Reportagen zu Recht, weil sie in das Innenleben ihrer Protagonisten eindringen, weil sie aus deren Sicht eine Welt zu schildern vermögen, die über die aktuelle politische Situation hinaus ein Ort der Bewährung ist. Es ist ein unheilvoller Ort, und vom Heil verlassen sind die, die darin wandeln.
Die beiden deutschen Frauen, Mutter und Tochter, die geistesverwirrt aus einem Altersheim fliehen und ihr enteignetes Haus wieder beziehen wollen, weil sie einer Radiomeldung entnommen haben, die Amerikaner seien im Anmarsch und mit ihnen ihr Sohn und Bruder aus Deutschland. Die aus allen Ecken des Landes herbei gewehten Säufer, die eine von Sanddünen umgebene Kolchose bewirtschaften sollen.
Die ehemaligen Studenten, die weiter in ihrem Warschauer Wohnheim hausen, von den Essensresten der anderen leben und ihnen das Stipendium bei Karten- und Würfelspielen abzunehmen versuchen. Und in dem am meisten beeindruckenden Text die sechs Bergarbeiter, die ihren verunglückten Kumpel in seinen Heimatort bringen sollen und den Sarg auf den Schultern tragen müssen, weil der Lastwagen mit Panne liegenblieb.
"Dabei wissen wir nicht, wie er war. Keiner von uns hat ihn je gesehen. Stefan Kanik, 18 Jahre alt, durch einen Unfall ums Leben gekommen. Mehr wissen wir nicht. Jetzt können wir noch hinzufügen, dass er ungefähr 60 Kilo wog. Der Rest ist ein Geheimnis. Eine Vermutung.
Und dieses Rätsel der unsichtbaren Person, die so fremd und steif da liegt, beherrscht die sechs Lebenden, ihre Gedanken, entzieht ihren Körpern die Kraft. Kühl und schweigend nimmt der Tote ihre Opfergabe der Entsagung, der Demut, des Einwilligens in dieses seltsame Schicksal entgegen."
Kapuściński ist einer von den Sechsen. Der Reporter hat am Sarg mit angefasst, weil er nicht bloß ein Schalltrichter sein will, weil er nicht nur Geschichten erzählen will, sondern jene Geschichte mit seinen Figuren teilt, von der er sagt, der Mensch trägt sie in seinen Knochen mit sich herum. Die fünf Bergarbeiter und der Reporter schaffen es bis zum Abend nicht bis in das Heimatdorf des Toten und beschließen, in einem Wald zu übernachten. Nachdem sie den Sarg ins Gebüsch geschoben und ein Feuer entzündet haben, hören sie Stimmen.
"Die Stimmen kommen immer näher. Endlich sieht man Gestalten. Zwei, drei, fünf.
Mädchen. Sechs, sieben.
Acht Mädchen."
Die jungen Männer können die Mädchen dazu bewegen, sich zu ihnen ans Feuer zu setzen.
"Wir betrachten die Mädchen. Sie tragen bunte Kleider und haben nackte Arme, von der Sonne gebräunt, die nun im Schein des Feuers abwechselnd golden und braun schimmern. Sie werfen scheinbar gleichgültige und doch aufreizende und zugleich wachsame, zugängliche und unerreichbare Blicke ins flackernde Feuer, ganz offensichtlich erfüllt sie die seltsame, irgendwie heidnische Stimmung, die ein nachts im Wald entzündetes Feuer im Menschen weckt (...) Man braucht bloß die Hand auszustrecken, um ein Mädchen zu umarmen, aber man braucht auch nur ein paar Schritte zu machen und sich über den Sarg zu beugen, und zwischen dem Schönsten auf der Welt und dem grausamen Tod - stehen wir."
Zwischen der Liebe und dem Tod, dem Frieden und dem Krieg, dem Tun und dem Erleiden bewegen sich alle Menschen in diesem Buch. Und wie die Bergarbeiterhände nicht den Weg zu den nackten Armen der Mädchen finden, so bleiben auch die der meisten anderen Figuren tatenlos. Es sind die Verlierer und die Verzweifelten, die Tollpatsche, Trinker und die Träumer, denen Kapuscinski sein Mitgefühl und seine gestalterische Kraft widmet. Er sagt:
"Aus dem Krieg kommen, das bedeutete, sich innerlich zu reinigen, vor allem vom Hass."
Im Schreiben hat er diese Reinigung vollzogen und an die Stelle des Hasses die Empathie gesetzt. Sie versetzt ihn in die Lage, in einer trostlosen Umgebung das Menschliche zu entdecken und zu schildern. Mit leisem Pathos, nicht ohne pädagogische Versuchung, mit Melancholie und wehmütigem, gelassenem und mitunter bitterem Humor - ein großer Schriftsteller kündigt sich an.
Ryszard Kapuscinski: Ein Paradies für Ethnographen - Polnische Geschichten
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2010
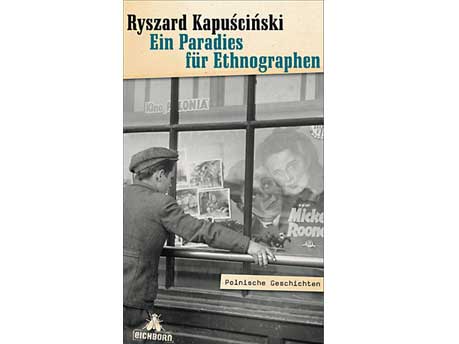
Cover: "Ryszard Kapuscinski: Ein Paradies für Ethnographen"© Eichborn Verlag
