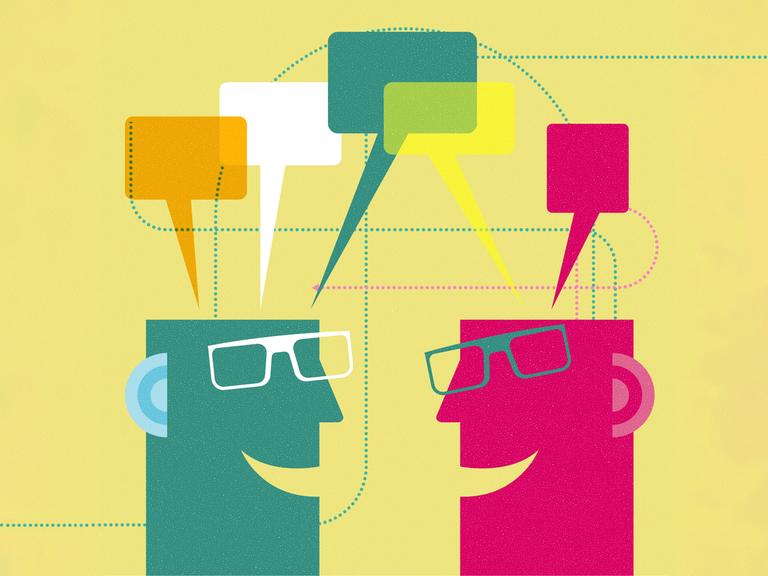Kommentar zur Sprachverarmung
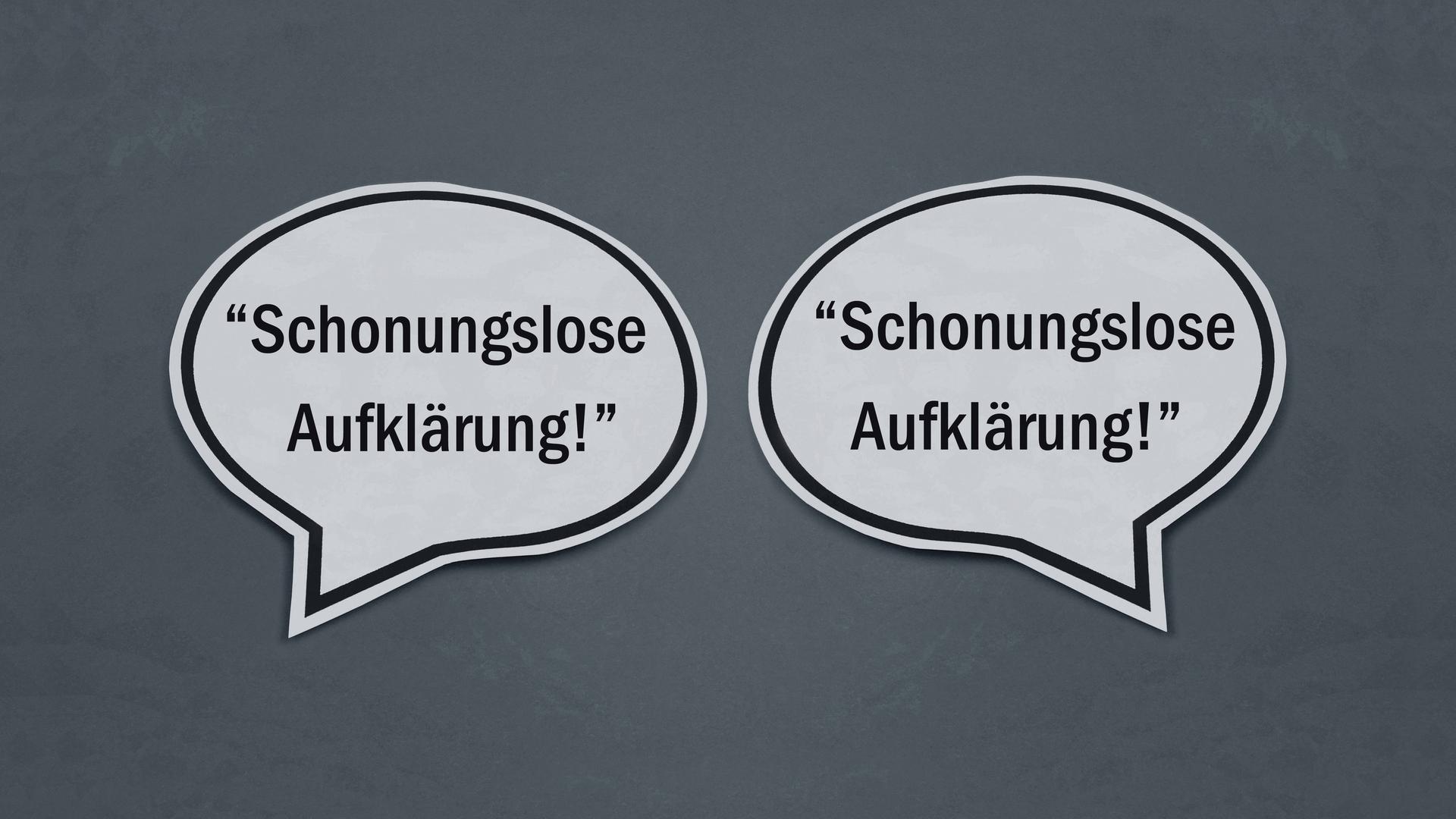
Führt die Verwendung der immergleichen Floskeln zu einer Schablonisierung im Denken? © IMAGO / Steinach / IMAGO / Sascha Steinach
Sprechen in Schablonen, Denken in Schablonen?
04:12 Minuten
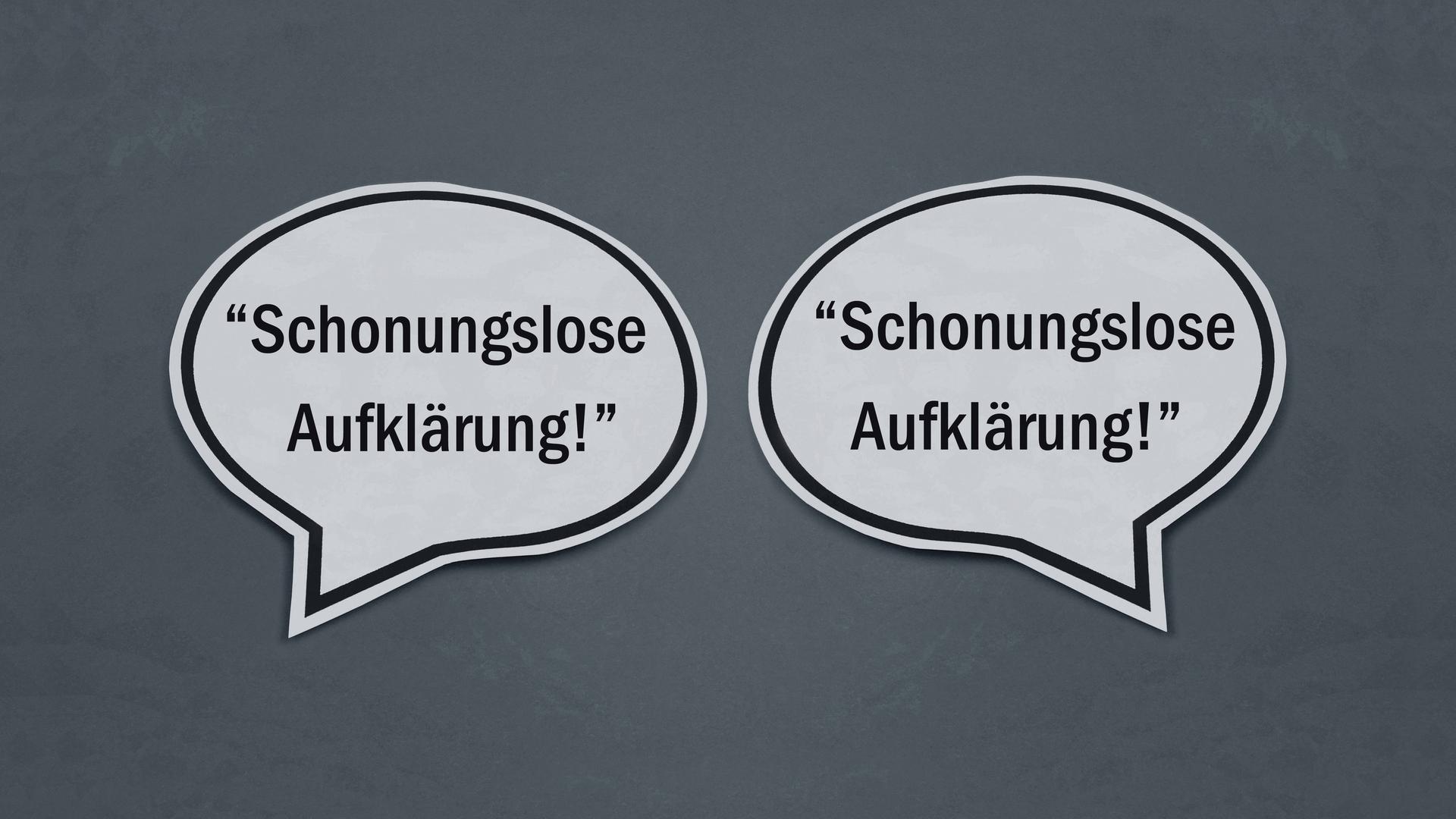
Politik und Journalismus greifen immer wieder auf dieselben Floskeln zurück: eine sprachliche Verarmung, die gefährlich ist.
Der alte Mann mit dem grauen Bart war zufrieden. Mit sich und der Welt, deren Erschaffung ihn allerdings immer noch ziemlich in Anspruch nahm. Schließlich war es keine Kleinigkeit, in nur sechs Tagen das Nichts durch ein Universum zu ersetzen.
Und das offensichtlich mit Erfolg, denn wenn jeder dieser eben erst erschaffenen Tage im ebenfalls neu erschaffenen Abendrot versank, hieß es stets: "Gott sah, dass es gut war." So protokolliert jedenfalls die Bibel die immergleichen Botschaften.
Der Charme der Schablone
Der Charme der Schablone hat sich erhalten. Prophezeien doch Politikerinnen und Politiker aller Farben und Fraktionen derzeit in jedes vor sie gehaltene Mikrofon, "am Ende des Tages" werde entweder alles gut oder – eher oppositionell-apokalyptisch – alle Maßnahmen würden sich unweigerlich als ungenügend und falsch erweisen.
Eine "Klatsche" oder gar "totale Klatsche" für Regierung, Koalition oder wen auch immer sei diese Bewertung, wird dann medial blitzschnell geurteilt, das kränkende "Klatsche" dabei gern auch in Verbindung mit '"Umfrage-", "Wahl-" oder "Wirtschaft-" gebracht.
Kein Wunder, dass angesichts solcher Schmähungen auf der jeweils anderen politischen Seite gefeiert wird. So knallten nun – wie bei jedem Formel-1-Sieg mittlerweile üblich – die „Korken“ aus den Champagnerflaschen.
Rhetorischer Plattenbau
Das öffentliche Reden und Schreiben scheint in Deutschland von wachsenden Wortfindungsschwierigkeiten und Formulierungsnöten geprägt zu sein. Da fängt sich dann permanent jemand eine "schallende Ohrfeige" ein, Niederlagen sind meist "krachend" und wenn gesiegt wird, dann möchte der Sieger sich am liebsten für einen "Erdrutschsieg" bejubeln lassen, ohne dabei in der Regel zu bedenken, wie schlecht dieses naturkatastrophale Bild doch zu einem Gewinner passt.
Politik und Journalismus nutzen unter dem Zwang zu schnellen Antworten und ereignissynchroner Berichterstattung ihre Textbausteine wie ein Vorschulkind seine Plastikklötze. Nur, dass Fünfjährige daraus oft erstaunlich phantasievolle Gebilde entstehen lassen, Politik wie Presse dagegen nur immer mehr vom immer Gleichen. Rhetorischer Plattenbau eben.
Was jedoch höchstens langweilig wäre, bestünde da nicht dieser bohrende Verdacht, dass Sprechen in Schablonen auch zu einem Denken in Schablonen führt. Wie wir gerade bemerken, wird Diplomatie durch digitale Dispute ersetzt, und 280 Zeichen in den privaten Netzwerken amerikanischer Milliardäre können plötzlich über Krieg und Frieden entscheiden.
Sprache als Brücke in die Welt
Wenn – wie es der von den Nationalsozialisten 1933 in die Emigration gezwungene Philosoph Ernst Cassirer formulierte – die Sprache sich mit wachsender geistiger Reife zu einer Brücke in die Welt entwickelt, dann sollten wir den Zustand dieser Brücke besser im Auge behalten. Sprachverarmung darf sie nicht baufällig werden lassen oder sogar zum Einsturz bringen. Die Folgen wären verheerend.
Selbst der alte Herr mit dem grauen Bart hat schließlich von allem Anfang an nicht nur an seinem Universum, sondern auch an seiner Sprache gefeilt. Was seine Schöpfung angeht, änderte sich schließlich sogar sein Fazit. Nicht nur gut sei sie, stellte er fest, sondern sogar sehr gut. Am Ende des Tages wohlgemerkt.