Piraten, Korsaren und Freibeuter
Brutale Überfälle, Mord und Vergewaltigung hier, legalisierte Kaperfahrten und ein komplexes Handelssyetem dort: Die Piraterie zeigt sich im Laufe der Geschichte als ein überaus vielschichtiges Phänomen. Zwei neue Bücher zum Thema bringen jetzt Licht ins Dunkel.
Der Seeräuber ist eine der widersprüchlichsten Gestalten der Weltgeschichte. In ihm vereinen sich romantischer Exotismus und skrupellose Kriminalität. Wer einmal über die Stränge schlagen will, schlüpft ins Piratenkostüm, doch wenn bewaffnete Habenichtse Tanker entern, ertönt unisono der Ruf nach hartem Durchgreifen. Provozierend erscheint schon, dass es sie überhaupt noch gibt, und kaum weniger provozierend erscheint der Gedanke, dass Piraten Anstöße zur Entwicklung des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen gegeben haben.
In dem Band "Der Feind aller" analysiert der amerikanische Literaturwissenschaftler Daniel Heller-Roazen die rechtsgeschichtlichen Aspekte der Piraterie. Bereits im alten Rom waren Seeräuber auch juristisch schwer zu fassen. Cicero habe den Piraten als "communis hostis omnium" definiert, als "gemeinsamen Feind aller", für den weder Kriegs- noch Vertragsrecht gelte:
"Wenn du einem Räuber eine für dein Haupt ausgesetzte Summe nicht bringst, ist das kein Betrug, auch nicht wenn du trotz Schwur es nicht tust, denn der Pirat gehört nach der Definition nicht in die Zahl der Kriegsgegner, sondern ist der gemeinsame Feind aller. Mit dem darf weder ein Treuverhältnis noch ein Eid Gemeinschaft bilden."
Die kategorische Verdammung des Piraten aber wollte nicht gelingen. Ob christliche und muslimische Korsaren, ob britische "privateers" wie Francis Drake oder niederländische Freibeuter wie Piet Hein – immer fanden sich Staaten bereit, den Raub auf See zu legitimieren und sich so einen Anteil der Beute zu sichern. Der Aufstieg Großbritanniens und der Niederlande wurde auch mit der Beute finanziert, die sie Spaniern und Portugiesen abgejagt hatten. Doch die Geister, die man in Kriegszeiten gerufen hatte, wurde man nicht wieder los:
"Es muss für Pisa oder Genua mindestens ebenso schwierig gewesen sein, die Korsaren innerhalb der Grenzen der Legalität zu halten, wie es im achtzehnten Jahrhundert der britischen Regierung schwer fiel, dafür zu sorgen, dass die privateers den strengen Instruktionen folgten, die sie bei Anbruch des Krieges erhielten."
Das ist noch zurückhaltend formuliert. Was heute auch mit Satelliten und Fernkommunikation schwer fällt, war zur Hochzeit des Piratenwesens im 17. und 18. Jahrhundert unmöglich: Jenseits der Kanonenschussweite, aus der später die Dreimeilenzone wurde, tat sich auf dem Meer ein Raum auf, den selbst Weltmächte wie Großbritannien nicht flächendeckend kontrollieren konnten.
Heller-Roazen verfolgt die Entwicklung des Seerechts, zu dessen Begründern Männer wie der Niederländer Hugo Grotius zählten, doch hatten viele Länder ein Interesse an maritimen Grauzonen. Der Kaperbrief, den ein Staat einem Freibeuter ausstellte, war auch sein eigener Freibrief, den Krieg mit anderen, sprich privaten Mitteln zu führen. Die Devise sei:
"Nicht die Tat ist es, die sich selbst legitimiert, und nicht der Täter, sondern die Befugnis."
Diese Befugnis aber wurde nur einseitig anerkannt. Für die Europäer sei das Meer nie ein rechtsfreier Raum gewesen, schreibt der Historiker Michael Kempe in seinem Buch "Fluch der Weltmeere", sondern ein Raum, in dem um Rechte gestritten wurde:
"Piraterievorwürfe waren fast immer wechselseitig. Als Prototyp des illegalen Beutenehmers blieb die Bezeichnung 'Pirat' eine Fremdattribution, 'Kaperfahrer' als Prototyp des legalen Beutenehmers dagegen eine Selbstattribution. Im andauernden Wechselspiel zwischen Legitimität und Illegitimität von Gewalt und Güterwegnahme waren internationale Rechtsbeziehungen, meist im Zeichen gegenseitiger Konkurrenz stehend, für keine Seite transparent und berechenbar."
Mochte legale Freibeuterei die Staatskasse füllen, so konnte sie doch jederzeit in unkontrollierte Piraterie umschlagen. Kempe beschreibt, wie das indische Mogulreich seine britischen und niederländischen Handelspartner unter Druck setzte, dem Piratenwesen im indischen Ozean Einhalt zu gebieten. Ende des 17. Jahrhunderts nämlich hatte sich das System der so genannten "Piratenrunde" entwickelt, das von Neufundland und um Afrika herum bis nach Indonesien reichte.
Dabei akzentuiert Kempe, dass Piraterie nicht nur eine Bedrohung, sondern stets auch ein Teil des internationalen Handels gewesen sei. Anders als in "Stevensons" Schatzinsel raubten Piraten nicht nur Gold und Silber, sondern vor allem Handelsgüter, die sie so bald wie möglich verkauften. Hehler- und Schmugglerware aber ist günstiger als legale, und Kempe führt aus:
"Bezüglich der 'Piratenrunde' kam hinzu, dass sie den Bewohnern der amerikanischen Kolonien neben der Möglichkeit, günstig an europäische Waren oder afrikanische Sklaven heranzukommen, ebenso Gelegenheit gab, rare Luxusgüter wie feine Textilwaren, Edelmetalle und Schmuck direkt aus Ostindien erhalten zu können. (…) Man könnte hier insofern von einem verdeckten Logistikunternehmen sprechen, das subkutan zu den offiziellen Handelsbeziehungen eine alternative Marktverflechtung erzeugte, die zwar auf der Schattenseite der durch Monopole und staatliche Lizenzen dominierten internationalen Handelspolitik lag, zugleich aber als Reaktion auf diese zu ihr gehörte, wie die zweite Seite ein und derselben Medaille."
Dass solche Helden einer freien Marktwirtschaft Räuber, Mörder und Vergewaltiger waren, provozierte die Entwicklung des internationalen See- und Völkerrechts. Doch wie beim "Krieg gegen den Terror" war auch der Kampf gegen die Piraterie von nationalen Interessen geprägt:
"Nach dem Wiener Kongress sahen die europäischen Großmächte, allen voran Frankreich und Großbritannien, den Zeitpunkt für gekommen die Städte im Maghreb nicht mehr als gleichwertige Kriegsgegner zu bekämpfen, sondern als ungleichwertige Piraten und Räuber, um daraus die Berechtigung abzuleiten, das von den zu Verbrechern deklassierten Korsaren gesäuberte Land als Kolonialmacht zu okkupieren."
Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, ob die Freiheitskämpfer, Luftpiraten und Terroristen unserer Tage nicht die Nachfahren des gemeinsamen Feindes aller sind. Mögen Motive und Selbstverständnis auch unterschiedlich sein, so urteilt Kempe doch:
"In welthistorischer Perspektive markieren Piraterie und Terrorismus zwei korrespondierende Schwellenphänomene: den Aufbau und den Abbau des staatlichen Gewaltmonopols, den Anfang der Neuzeit und das Ende des Zeitalters klassischer Staatenpolitik, das manche Beobachter mit der sich im 21. Jahrhundert voll entfaltenden Globalisierung kommen sehen."
Statt vom Abbau kann man heute auch von einem Neubeginn sprechen, von neuer Aufrüstung oder mit Heller-Roazen von einer "beständigen Vorbereitung auf den Frieden durch Krieg". Die Entscheidung darüber, wer heute alle sind und wer deren Feind, bleibt eine Machtfrage. Recht und Politik sollten deshalb nicht nur auf den Feind, sondern auch aufeinander acht geben, denn die Geschichte der Piraterie lehrt, dass staatliche Monopole zäh- und langlebiger sind als jene wüsten Gesellen, deren Motto "A short life and a happy one" lautete.
Daniel Heller-Roazen: Der Feind aller. Der Pirat und das Recht
Deutsch von Horst Brühmann.
Fischer Verlag, 348 Seiten, 22,95 Euro
Michael Kempe: Fluch der Weltmeere. Piraterie, Völkerrecht und internationale Beziehungen
Campus Verlag, 437 Seiten, 39,90 Euro
In dem Band "Der Feind aller" analysiert der amerikanische Literaturwissenschaftler Daniel Heller-Roazen die rechtsgeschichtlichen Aspekte der Piraterie. Bereits im alten Rom waren Seeräuber auch juristisch schwer zu fassen. Cicero habe den Piraten als "communis hostis omnium" definiert, als "gemeinsamen Feind aller", für den weder Kriegs- noch Vertragsrecht gelte:
"Wenn du einem Räuber eine für dein Haupt ausgesetzte Summe nicht bringst, ist das kein Betrug, auch nicht wenn du trotz Schwur es nicht tust, denn der Pirat gehört nach der Definition nicht in die Zahl der Kriegsgegner, sondern ist der gemeinsame Feind aller. Mit dem darf weder ein Treuverhältnis noch ein Eid Gemeinschaft bilden."
Die kategorische Verdammung des Piraten aber wollte nicht gelingen. Ob christliche und muslimische Korsaren, ob britische "privateers" wie Francis Drake oder niederländische Freibeuter wie Piet Hein – immer fanden sich Staaten bereit, den Raub auf See zu legitimieren und sich so einen Anteil der Beute zu sichern. Der Aufstieg Großbritanniens und der Niederlande wurde auch mit der Beute finanziert, die sie Spaniern und Portugiesen abgejagt hatten. Doch die Geister, die man in Kriegszeiten gerufen hatte, wurde man nicht wieder los:
"Es muss für Pisa oder Genua mindestens ebenso schwierig gewesen sein, die Korsaren innerhalb der Grenzen der Legalität zu halten, wie es im achtzehnten Jahrhundert der britischen Regierung schwer fiel, dafür zu sorgen, dass die privateers den strengen Instruktionen folgten, die sie bei Anbruch des Krieges erhielten."
Das ist noch zurückhaltend formuliert. Was heute auch mit Satelliten und Fernkommunikation schwer fällt, war zur Hochzeit des Piratenwesens im 17. und 18. Jahrhundert unmöglich: Jenseits der Kanonenschussweite, aus der später die Dreimeilenzone wurde, tat sich auf dem Meer ein Raum auf, den selbst Weltmächte wie Großbritannien nicht flächendeckend kontrollieren konnten.
Heller-Roazen verfolgt die Entwicklung des Seerechts, zu dessen Begründern Männer wie der Niederländer Hugo Grotius zählten, doch hatten viele Länder ein Interesse an maritimen Grauzonen. Der Kaperbrief, den ein Staat einem Freibeuter ausstellte, war auch sein eigener Freibrief, den Krieg mit anderen, sprich privaten Mitteln zu führen. Die Devise sei:
"Nicht die Tat ist es, die sich selbst legitimiert, und nicht der Täter, sondern die Befugnis."
Diese Befugnis aber wurde nur einseitig anerkannt. Für die Europäer sei das Meer nie ein rechtsfreier Raum gewesen, schreibt der Historiker Michael Kempe in seinem Buch "Fluch der Weltmeere", sondern ein Raum, in dem um Rechte gestritten wurde:
"Piraterievorwürfe waren fast immer wechselseitig. Als Prototyp des illegalen Beutenehmers blieb die Bezeichnung 'Pirat' eine Fremdattribution, 'Kaperfahrer' als Prototyp des legalen Beutenehmers dagegen eine Selbstattribution. Im andauernden Wechselspiel zwischen Legitimität und Illegitimität von Gewalt und Güterwegnahme waren internationale Rechtsbeziehungen, meist im Zeichen gegenseitiger Konkurrenz stehend, für keine Seite transparent und berechenbar."
Mochte legale Freibeuterei die Staatskasse füllen, so konnte sie doch jederzeit in unkontrollierte Piraterie umschlagen. Kempe beschreibt, wie das indische Mogulreich seine britischen und niederländischen Handelspartner unter Druck setzte, dem Piratenwesen im indischen Ozean Einhalt zu gebieten. Ende des 17. Jahrhunderts nämlich hatte sich das System der so genannten "Piratenrunde" entwickelt, das von Neufundland und um Afrika herum bis nach Indonesien reichte.
Dabei akzentuiert Kempe, dass Piraterie nicht nur eine Bedrohung, sondern stets auch ein Teil des internationalen Handels gewesen sei. Anders als in "Stevensons" Schatzinsel raubten Piraten nicht nur Gold und Silber, sondern vor allem Handelsgüter, die sie so bald wie möglich verkauften. Hehler- und Schmugglerware aber ist günstiger als legale, und Kempe führt aus:
"Bezüglich der 'Piratenrunde' kam hinzu, dass sie den Bewohnern der amerikanischen Kolonien neben der Möglichkeit, günstig an europäische Waren oder afrikanische Sklaven heranzukommen, ebenso Gelegenheit gab, rare Luxusgüter wie feine Textilwaren, Edelmetalle und Schmuck direkt aus Ostindien erhalten zu können. (…) Man könnte hier insofern von einem verdeckten Logistikunternehmen sprechen, das subkutan zu den offiziellen Handelsbeziehungen eine alternative Marktverflechtung erzeugte, die zwar auf der Schattenseite der durch Monopole und staatliche Lizenzen dominierten internationalen Handelspolitik lag, zugleich aber als Reaktion auf diese zu ihr gehörte, wie die zweite Seite ein und derselben Medaille."
Dass solche Helden einer freien Marktwirtschaft Räuber, Mörder und Vergewaltiger waren, provozierte die Entwicklung des internationalen See- und Völkerrechts. Doch wie beim "Krieg gegen den Terror" war auch der Kampf gegen die Piraterie von nationalen Interessen geprägt:
"Nach dem Wiener Kongress sahen die europäischen Großmächte, allen voran Frankreich und Großbritannien, den Zeitpunkt für gekommen die Städte im Maghreb nicht mehr als gleichwertige Kriegsgegner zu bekämpfen, sondern als ungleichwertige Piraten und Räuber, um daraus die Berechtigung abzuleiten, das von den zu Verbrechern deklassierten Korsaren gesäuberte Land als Kolonialmacht zu okkupieren."
Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, ob die Freiheitskämpfer, Luftpiraten und Terroristen unserer Tage nicht die Nachfahren des gemeinsamen Feindes aller sind. Mögen Motive und Selbstverständnis auch unterschiedlich sein, so urteilt Kempe doch:
"In welthistorischer Perspektive markieren Piraterie und Terrorismus zwei korrespondierende Schwellenphänomene: den Aufbau und den Abbau des staatlichen Gewaltmonopols, den Anfang der Neuzeit und das Ende des Zeitalters klassischer Staatenpolitik, das manche Beobachter mit der sich im 21. Jahrhundert voll entfaltenden Globalisierung kommen sehen."
Statt vom Abbau kann man heute auch von einem Neubeginn sprechen, von neuer Aufrüstung oder mit Heller-Roazen von einer "beständigen Vorbereitung auf den Frieden durch Krieg". Die Entscheidung darüber, wer heute alle sind und wer deren Feind, bleibt eine Machtfrage. Recht und Politik sollten deshalb nicht nur auf den Feind, sondern auch aufeinander acht geben, denn die Geschichte der Piraterie lehrt, dass staatliche Monopole zäh- und langlebiger sind als jene wüsten Gesellen, deren Motto "A short life and a happy one" lautete.
Daniel Heller-Roazen: Der Feind aller. Der Pirat und das Recht
Deutsch von Horst Brühmann.
Fischer Verlag, 348 Seiten, 22,95 Euro
Michael Kempe: Fluch der Weltmeere. Piraterie, Völkerrecht und internationale Beziehungen
Campus Verlag, 437 Seiten, 39,90 Euro
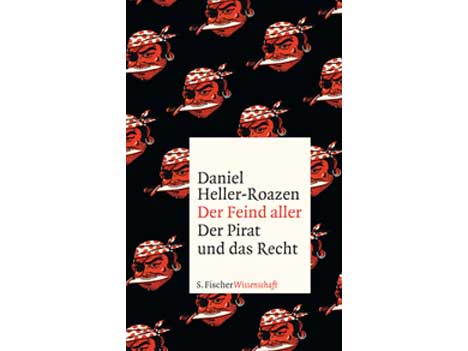
Buchcover: Daniel Heller-Roazen - "Der Feind aller"© Fischer
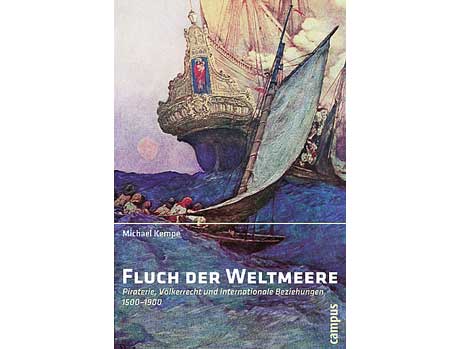
Buchcover: Michael Kempe - "Fluch der Weltmeere"© Campus Verlag
