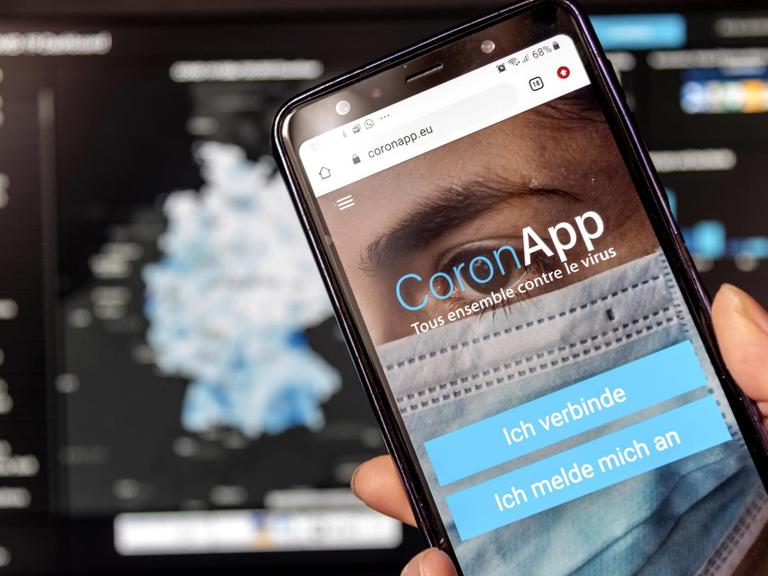Matthias Buth wurde 1951 in Wuppertal geboren. Er ist Lyriker und Publizist und veröffentlichte zahlreiche Prosa- und Gedichtbände, 2019 die Sammlung mit neuer Lyrik "Weiß ist das Leopardenfell des Himmels", der sich im Frühjahr das Rumänien-Buch "Der Schnee stellt seine Leiter an die Ringmauer" anschließen wird. Der promovierte Jurist war bis Ende 2016 Justiziar im Kanzleramt bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und ist nunmehr Rechtsanwalt.
Wie viel Staat wollen wir?
04:18 Minuten

Die Coronapandemie erschüttert Gesundheitssysteme und Staaten selbst. Doch welche Form der Staatlichkeit kann die Herausforderung am besten bewältigen, fragt sich der Jurist Matthias Buth. Brauchen wir mehr Abschottung oder Kooperation?
Die Grenzen für Nicht-EU-Bürger sind geschlossen, ebenso wie die Schengen-Grenzen: Der Binnenmarkt ist hin, die EU-Staaten schotten sich ab – ohne Rücksicht auf Verluste. Handelt die EU wie ein Staat? Nein, sie handelt fast gar nicht und schon gar nicht als Staat. Das lassen die Nationalstaaten nicht zu. Und auch nicht die EU-Verträge. Die Union der 27 ist eben ein Staatenbund am Zügel der Regierungen. Die Pandemie macht die Devise deutlich: Rette sich wer kann! Und auch: Die EU versagt.
Dies alles offenbart Hilflosigkeit. Die Virenplage, die weiße Pest, stellt uns auch vor Systemfragen: Was können einzelne Staaten leisten und: Wieviel staatlicher Zentralismus muss sein, um Leiden und Sterben zu begrenzen? Diejenigen, die die EU abschaffen wollen und in Deutschland, Italien oder Ungarn nach der gelenkten Demokratie à la Putin rufen, sehen sich ideologisch im Aufwind. Und Putin sieht politische Chancen. Er schickt Militär-LKWs nach Bergamo, "with love from Russia".
Auch demokratische Staaten brauchen Führung
Dass die russischen Medien die Menschen-Steuerung von China bewundern, liegt nahe. Denn die neue Verfassung von Moskau will den totalen Überwachungsstaat. Die Krise zeigt uns, dass auch demokratische Staaten Führung brauchen und dass die Bürger diese auch erwarten. Angst ist demokratisch, sie erfasst alle. Aber sie ist – hoffentlich – beherrschbar durch Erkennen, Sprechen und Handeln.
Wenn sich etwa 60 bis 70 Prozent der 83 Millionen Menschen in Deutschland infizieren, wäre die Konsequenz, dass bis zu 200.000 Menschen daran sterben könnten. Diese Lage erfordert den handlungsstarken Staat. Den haben wir zwar nicht in allen Bereichen der föderalen Republik der 16, aber der Staat steuert überraschend gut durch seine Repräsentanten. Die Bundeskanzlerin ist oberste Exekutive, aber nur beim Bund. Den Notstand konnte sie aber nicht ausrufen. Diese Gesundheitskatastrophe wird von Artikel 35 Grundgesetz eben nicht erfasst, es liegt ja keine Naturkatastrophe vor.
Wenn sich etwa 60 bis 70 Prozent der 83 Millionen Menschen in Deutschland infizieren, wäre die Konsequenz, dass bis zu 200.000 Menschen daran sterben könnten. Diese Lage erfordert den handlungsstarken Staat. Den haben wir zwar nicht in allen Bereichen der föderalen Republik der 16, aber der Staat steuert überraschend gut durch seine Repräsentanten. Die Bundeskanzlerin ist oberste Exekutive, aber nur beim Bund. Den Notstand konnte sie aber nicht ausrufen. Diese Gesundheitskatastrophe wird von Artikel 35 Grundgesetz eben nicht erfasst, es liegt ja keine Naturkatastrophe vor.
Der Begriff "Staat" erfährt ein Revival
Die rasch beschlossene Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ist eine verkappte Notstandsgesetzgebung, aber ohne Grundgesetzänderung. Das geht verfassungsrechtlich nicht. Die Verfassungsorgane werden sich nach der Viruskatastrophe damit befassen müssen.
Und damit wird die Frage gestellt werden, wie viel Staat wir wollen, wie wir zwischen Freiheit und Leben abwägen. Dass "der Staat" als Begriff nun ein Revival erfährt, darf nämlich nicht dazu führen, der Idee "des Politischen" à la Carl Schmitt Vorschub zu geben. Was der Deutschen Vaterland ist und wie es – auch für andere – bestehen soll, bleibt Frage des Rechtsstaats in der repräsentativen Demokratie, auch nach der Coronakrise.
Und bald werden wir nach den Zerstörungen in den Industrien sowie in der Dienstleistungswirtschaft fragen: Hat sich die Globalisierung überlebt?
Und bald werden wir nach den Zerstörungen in den Industrien sowie in der Dienstleistungswirtschaft fragen: Hat sich die Globalisierung überlebt?
Pandemien kennen keine Staatsgrenzen
Die globale Viruskrise zeigt zweierlei: Die Staaten handeln nach nationalem Selbstverständnis und mit eigener Wirtschaftskraft erst einmal für sich, wollen also mehr Staat sein als vor der Katastrophe und zum anderen rückt die Welt zusammen. Denn Pandemien kennen keine Staatsgrenzen.
Ihre nationale Bekämpfung muss deshalb verbunden werden mit der Unterstützung anderer Staaten, wie es bereits durch die Bundeswehr geschieht. Wenn Deutschland weiterhin – und besonders ab Juli im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft – politisch führt und die Panik eindämmt, bleiben wir auch nach der Coronakrise politisch wie emotional verbunden.