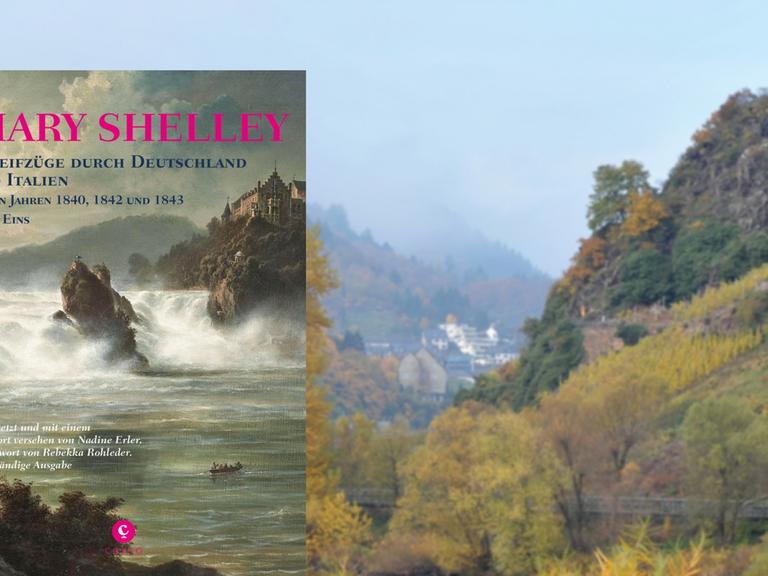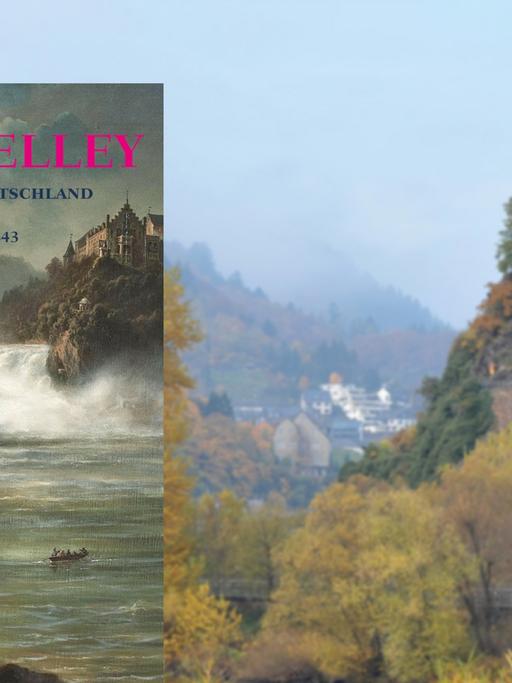"Mary Shelley", Regie: Haifaa Al Mansour, Hauptrollen: Elle Fanning (Mary Shelley), Douglas Booth (Percy Bysshe Shelley), Ben Hardy (John Polidori), 2018, ab 12 Jahren
Nüchtern betrachtet, hat sich wenig getan

Mit "Mary Shelley", "Colette" und "Die Frau des Nobelpreisträgers" starten gleich drei Filme in den Kinos, die vom Leben von Schriftstellerinnen erzählen. Sie zeigen, dass sich die Probleme für schreibende Frauen kaum verändert haben.
"Mary Shelley" spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts und zeigt anfangs vor allem die Herkunft der Frau, die 1818 "Frankenstein oder Der moderne Prometheus" schreiben wird. In der ersten Szene sitzt sie am Grab ihrer Mutter Mary Wollstonecraft und schreibt fieberhaft etwas auf. Danach wird sie von der Stiefmutter gescholten, von ihrem Vater William Goodwin aber ermuntert. Zwei Reformer als Eltern, doch Mary Shelley muss erst noch ihre eigene Stimme finden.
Genau darauf konzentriert sich nun auch der Film von Haifaa Al-Mansour: Mary Shelley wird von ihrem Vater nach Schottland geschickt, dort lernt sie ihren späteren Ehemann Percy kennen und erfährt zu spät, dass er bereits verheiratet ist. Mit ihrer Stiefschwester haut sie von zu Hause ab, um mit Percy zusammen zu sein. Die Gesellschaft verstößt sie, sie haben immer wieder finanzielle Probleme. Aber Percy hat geerbt, also kommen sie zurecht. Dann reisen sie im Sommer 1816 zu Lord Byron, mit dem Mary Shelleys Stiefschwester eine Affäre hat.
Legendäre Begegnung der Literaturgeschichte
In der Literaturgeschichte ist dieses Zusammentreffen legendär. Es brachte John William Polidoris "Der Vampir" und Mary Shelleys "Frankenstein" hervor. Im Film aber wird hier ein wichtiger Unterschied gemacht: Dieses Zusammentreffen ist lediglich ein Funke, der Mary Shelley inspiriert.
Für "Frankenstein" entscheidend ist indes das Leid, das ihr widerfährt. Kurz vorher ist ihr Kind verstorben – Mary Shelleys weitere Fehlgeburten werden wie der Tod ihrer Schwester ausgespart – und sie muss mit ansehen, dass Percys Konzept von freier Liebe beinhaltet, dass er selbst schlafen kann, mit wem er will - aber eifersüchtig darüber wacht, wem sie sich nähert.

Die britische Schriftstellerin und Autorin von "Frankenstein" Mary Shelley - Porträtbild von Richard Rothwell (1800-1868)© Imago/Leemage
Radikale Selbstentfaltung können sich nur Männer leisten – und zwar Männer mit Geld. Mary Shelley hingegen muss weiterhin die Übergriffe anderer Männer mit einem Lächeln erdulden.
Es ist schade, dass "Mary Shelley" einen so konservativen Ansatz im Hinblick auf weibliche Kreativität wählt: Bei Männern geht es um Genie - bei Frauen um das Gefühl. Ebenso ist bedauerlich, dass ein Film, der von Mary Shelley erzählt, ihrem Mann so viel Raum einräumt: Immer wieder sind seine Worte aus dem Off zu hören. Sicherlich ist er zu der Zeit der bekanntere von beiden. Aber es sollte viel weniger um die Ehe als um sie gehen.
Darüber hinaus steckt in dem Film viel Gegenwärtiges: Als Mary Shelley einen Verleger für "Frankenstein" sucht, wird entweder offen bezweifelt, dass sie und nicht ihr Mann diesen Roman geschrieben hat, oder sie wird darauf verwiesen, dass sich diese Art Roman – noch dazu ohne Happy End! – für eine Frau nicht schickt. Das Genre sei nicht angemessen.
Als "Frankenstein" dann anonym publiziert wird, wird er von der Öffentlichkeit aus diesen Gründen ihrem Mann zugeschrieben. Diese Mechanismen sind – freundlich ausgedrückt – zeitlos.
Die Anfangsjahre einer Schriftstellerin

Keira Knightley spielt die französische Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Colette.© imago stock&people
Während Mary Shelley stets weiß, dass sie schreiben will, hat Colette die Fantasie und die Geschichte, aber ihr fehlt das Selbstbewusstsein. Geboren 1873 heiratete sie mit 20 Jahren Henry Gauthier-Villars, der sich unter dem Pseudonym "Willy" einen Namen als Großschriftsteller gemacht hat.
Obwohl sowohl Mary Shelley als auch Colette ihr Leben lang geschrieben haben, konzentrieren sich beide Filme auf die Anfangsjahre der Schriftstellerin: Ihre Suche nach der eigenen Stimme und den Willen, ihren Platz zu behaupten.
Biografische Filme müssen immer auswählen, was sie erzählen, in diesem Fall aber ist die Entscheidung sehr interessant: Sowohl Mary Shelley als auch insbesondere Colette hatten nach dieser Zeit ein bewegtes Leben, das sehr viel Erzählstoff böte.
Indem die Filme aber nun die Anfangsjahre auswählen, haben sie zunächst ein Happy End: Die Frauen haben sich behauptet. Dass danach nicht alles gut ist, wird nicht gezeigt. Noch dazu ist dies eine Zeit, die viele Anknüpfungspunkte für das Publikum bietet: eine schwierige Liebe, unsichere jungen Frauen.
Gerade bei "Colette" aber ist es dort auch möglich, innerhalb der Konventionen des Arthouse-Biopics zu bleiben: Eine junge Frau heiratet einen älteren Mann und findet zu sich selbst. Dieser Rahmen kann einerseits stärken: So ist wundervoll zu sehen, wie selbstverständlich beispielsweise Colettes Bisexualität und ihre Beziehung zu der Transgender Natalie geschildert wird. Aber wenn man sich ein wenig mit Colettes weiterem Leben auskennt, stellt sich auch die Frage, warum das Leben einer so unkonventionellen, widersprüchlichen Frau so konventionell geschildert wird.
"Colette", Regie: Wash Westmoreland, Hauptrolle: Keira Knightley, 2018, ab 6 Jahre
Er will Schriftsteller sein, sie hat das Talent zum Schreiben

Glenn Close spielt "Die Frau des Nobelpreisträgers" © picture alliance/Geisler-Fotopress/Clemens Niehaus
Nimmt man nun noch "Die Frau des Nobelpreisträgers" hinzu – die fiktive Geschichte von Joan Castleman, die Meg Wolitzer in dem Roman "Die Ehefrau" geschildert hat – fällt bei den Lebensgeschichten der Schriftstellerinnen noch etwas auf: Die mittleren Jahre finden auch nicht statt. Also die Phase, in der viel geschrieben wurde, in der mit Ehe und gegebenenfalls Kindern die Parameter gesetzt waren. Sicherlich ist Schreiben auch schwer zu verfilmen, oft ist es hier das Kratzen eines Stifts auf Papier ("Mary Shelley", "Colette") bzw. das energische Tippen ("Die Frau des Nobelpreisträgers").
"Die Frau des Nobelpreisträgers" erzählt von der älteren Joan Castleman, die anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an ihren Ehemann Joe im Jahr 1992 erkennt, dass sie in dieser Ehe nicht mehr glücklich ist.
In Rückblenden wird das Kennenlernen des Paares gezeigt – und es wird auch deutlich, dass er davon träumt, ein Schriftsteller zu sein, während sie das Talent zum Schreiben hat, aber nicht gerne in der Öffentlichkeit steht.
Erziehung und Gesellschaft halten sie vom Schreiben ab
Im Roman wird noch viel deutlicher, dass es Joans Erziehung und die damalige Gesellschaft ist, die sie davon abhält, selbst als Schriftstellerin zu arbeiten und unter ihrem Namen zu publizieren. Hier spricht Joan aus, dass sie – wenn es damals schon Pionierinnen gegeben hätte, an die sie hätte anknüpfen können – sich vielleicht anders entschieden hätte. Doch stattdessen hat sie an der einzigen Entscheidung festgehalten, die sie jemals selbstständig getroffen hat: Mit John durchzubrennen.
Die Verfilmung leidet nun ein wenig darunter, dass diese wichtige Phase zwischen Kennenlernen und der Veröffentlichung des ersten Romans nur wenig Raum bekommt und sich noch dazu sehr auf das Ziel – den ersten Roman – konzentriert.
Die Komplexität dieses Arrangements und der Beziehung auszudrücken, wird vor allem den Schauspielerinnen und Schauspielern aufgebürdet - und während Glenn Close (Joan Castleman) und Jonathan Pryce (Joe Castleman) dies mühelos gelingt, bleiben ihre jüngeren Versionen allzu blass.
Es sind im Film nur kurze Szenen, die andeuten, mit welchen Schwierigkeiten Joan zu kämpfen hätte, wenn sie hätte schreiben wollen. Eine betrunkene ältere Schriftstellerin rät ihr, die Finger davon zu lassen, weil die Männer sie niemals ernst nehmen werden. Und es sind nun einmal Männer, die Romane verlegen und besprechen. (Ein Ungleichgewicht, das es ja auch heute noch gibt.)
Als Joan im Büro in einem Verlag arbeitet, bekommt sie ebenfalls mit, wie sich die anwesenden Männer über Bücher von Frauen unterhalten. (Auch das gibt es ja heute noch, wenngleich es wohl nur noch wenige zugeben.)
Nüchtern betrachtet hat sich also von Mary Shelley bis zu Joan Castleman kaum etwas getan – weiterhin wird Männern der Ruhm für die Arbeit zugerechnet, die Frauen verrichten.
Und gewissermaßen spiegelt das auch die Filmindustrie wider: Es gibt viel weniger Biopics über Frauen als über Männer – und oftmals werden dann die Geschichten erzählt, die gewissermaßen einen Bonus bieten: eine prominente Ehe, Bisexualität.
Es ist an der Zeit, schreibende Frauen stärker ins Rampenlicht zu rücken - diese Filme sind erst der Anfang.
"Die Frau des Nobelpreisträgers", Original: The Wife, Regie: Björn Runge, Hauptrollen: Glenn Close, Jonathan Pryce, 2017, ab 6 Jahre