Naomi Schenck: Mein Großvater stand vor dem Fenster und trank Tee Nr. 12
Hanser Berlin, 2016
333 Seiten, 22,90 Euro, E-Book 16,99 Euro
War Günther Schenck ein Nazi?

Kurz vor seinem Tod gab der Chemiker Günther Otto Schenck seiner Enkelin Naomi Schenck den Auftrag, seine Biografie zu schreiben. Dann entdeckt sie, dass der unpolitische Großvater Mitglied der SA war. Hat er sich schuldig gemacht?
Wenn man bei Google den Namen Günther Schenck eingibt, erhält man Informationen über zwei Männer: beide Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, beide promovierte Naturwissenschaftler, beide traten 1933 in die SA und 1937 in die NSDAP ein. Der eine, Ernst Günther Schenck, war ein skrupelloser Karrierist im NS-Staat. Der andere, Günther Otto Schenck, war ein Pionier der Strahlenchemie, unpolitisch, in innerer Distanz zu den Nazis und doch ein "Bystander", wie seine Enkelin Naomi Schenck feststellt.
Was macht einen zum Täter?
Die 1970 geborene Szenenbildnerin und Autorin versucht mit ihrem Buch "Mein Großvater stand vor dem Fenster und trank Tee Nr. 12" seine Biografie zu verfassen. Und obwohl sie darin die Geschichte ihrer Vorfahren bis zu den Bauernkriegen zurückverfolgt, taucht der SS-Schenck nicht auf. Vermutlich gehört er einem anderen Geschlecht an, spannend aber wäre es gewesen, seinen Werdegang mit dem ihres Großvaters zu vergleichen. Vielleicht wären viele Fragen, die Naomi Schenck umtreiben, klarer zu beantworten gewesen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Verantwortung eines Menschen in unmenschlicher Zeit: Was macht einen zum Täter, zum Widerständler, zum Mitläufer oder Zuschauer?
Hat sich der von Naomi Schenck verehrte Großvater in der Nazizeit schuldig gemacht? Warum hat er seine SA-Vergangenheit später verschwiegen? Als Günther Otto Schenck seine Enkelin vor seinem Tod im Herbst 2003 beauftragte, eines Tages seine Biografie zu schreiben, wusste niemand in der Familie von seiner Mitgliedschaft in der SA. Die Nachgeborene stößt zufällig auf diese Information – und wird sich der Verantwortung und des Dilemmas bewusst, in das sie die Erbschaft ihres Großvaters bringt:
"Ich will etwas über ihn herausfinden, doch zugleich will ich mein Bild von ihm bestätigt finden – die Ambivalenz wird mich begleiten, wenn ich weiter nachforsche, und ich bin gespannt, wie mein Weg zwischen Recherche und Loyalität verlaufen wird. Ob ich Fragwürdiges beleuchten und zugleich dem Vertrauen, das Günther in mich hatte, gerecht werden kann? Es gibt eine Antwort darauf, jedenfalls möchte ich das glauben: Günthers Wunsch, dass ich seine Biographie schreibe, entsprang nicht nur seiner Eitelkeit. Er kannte mich. Es war auch der Wunsch, dass aufgeräumt wird. Und er hat mir vertraut, dass ich gut damit umgehe."
Keine stringente Biografie, eher ein Tasten
Das "gute Umgehen" mit Fakten, Eindrücken und den eigenen, ambivalenten Gefühlen macht den Reiz des Buches aus. Es ist keine stringente Biografie, sondern ein Tasten und Verlaufen, Finden und Vermuten, ein Versuch, die Stimmung zu erfassen, aus der sich der Nazismus entwickeln konnte. Zu klären, wie der Bildungsbürger Günther Schenck, ein begabter Musiker und hervorragender Wissenschaftler, in einem ihm innerlich fremden System seine Karriere beginnt und bruchlos nach dem Krieg fortsetzt. Wie er seine Verantwortung für sich, seine Familie und seine Arbeit sah.
Die Autorin will nicht richten, nicht verurteilen, sondern verstehen. Anders als noch die Generation der Kriegskinder es konnte oder wollte, schreibt hier jemand aus der Generation der Kriegsenkel. Gelassener und selbstkritischer setzen sie sich mit der Verstrickung von Familienangehörigen in der Nazizeit auseinander.
Außergewöhnlich an diesem Buch ist, dass der Großvater selbst den Auftrag zur Durchleuchtung seiner Vergangenheit gegeben hat und dadurch post mortem eine Recherche in Gang setzt, die seine ganze Familie in jene Auseinandersetzung mit Moral und Schuld zwingt, die er selbst zu Lebzeiten vermieden hat.
Moralische Fragen an die Enkelin
Die Autorin aber wird, je tiefer sie Günthers Leben durchdringt, auf sich selbst zurück geworfen. Und tatsächlich ist das der eigentliche Inhalt von Günther Schencks Erbschaft: die Nachgeborene zu veranlassen, sich selbst Fragen zu stellen und sich ihres moralischen Kompasses gewiss zu werden.
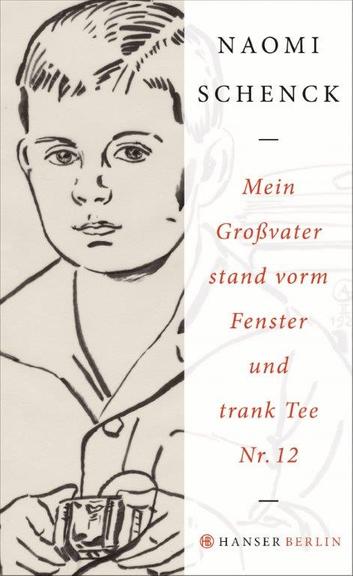
Cover: "Mein Großvater stand vorm Fenster und trank Tee Nr. 12" von Naomi Schenck© Hanser Berlin
"Ich denke, es ist davon auszugehen, dass Günther wusste, wer unter seinen Kollegen Nazi war und wer eher nicht – und ich frage mich, warum er sich später nicht häufiger oder klarer von diesen Leuten abgegrenzt hat. Oder ist es unrealistisch von mir, zu hoch gegriffen, mehr nach außen gerichtete Distanzierungen zu erwarten? Welche Unterlassungssünden werde ich mir mal vorwerfen lassen müssen?"
Naomi Schenck schildert Leben und Persönlichkeit ihres Großvaters aufgrund vieler Dokumente. Sie trifft noch seine ehemaligen Kollegen und Studenten. Führt zahllose Gespräche mit Menschen, die ihre Großeltern gekannt haben. Lässt sich Familiengeschichten von Verwandten erzählen, sichtet Günthers Aufzeichnungen und stößt auf eine "Chronik Wildwest 1930 – 1999", das Zeugnis einer lebenslangen Freundschaft von acht jungen, immer älter werdenden Männern in politisch bewegten und später ruhigeren Zeiten. Sie hatten sich als Fahrradclub organisiert, machten Ausflüge, feierten, musizierten, teilten sich sogar ein Auto. Auf einem Foto posieren sie in Uniform: SA, SS, Luftwaffe, Marine. Die Autorin staunt, wie Privates offensichtlich von Politischem getrennt war.
"Ich empfinde die Chronik als irritierend unpolitisch. 1935, in dem Jahr, in dem die Nürnberger Rassegesetze erlassen wurden, geht es hier vor allem darum, wer die beste Bowle mixen konnte, welche Damen anwesend waren. Was hat diese Männer ihr Leben lang zusammengehalten? Gemeinsame Unternehmungen, die gemeinsame Heimat? Gemeinsame Werte wie Treue oder Freundschaft? Das immerhin waren sie – treue Freunde. Aber was ist, wenn sich Treue vor andere Werte schiebt? Wenn sie wichtiger wird als Mitgefühl, Gerechtigkeit und Wahrheit?"
Keine absolute Beurteilung möglich
Naomi Schencks Buch macht deutlich, wie schwer es im Nachhinein ist, sich in Lebensumstände und innere Entscheidungsprozesse anderer Menschen, selbst nahestehender, hineinzuversetzen. Wie wenig wir Nachgeborenen die Fähigkeit und das Recht haben, Moral rückwirkend einzuklagen. Und auch, dass es unmöglich ist, eine objektive Perspektive auf andere Familienmitglieder einzunehmen. Das Konglomerat aus Emotionen, Prägungen, Legenden und Wissen erlaubt einfach keine absolute Beurteilung. Insofern gibt das Buch vor allem Auskunft über zeitgeschichtliche Konstellationen, damals wie heute. Über die Zerrissenheit, mit der die meisten Deutschen mehr als siebzig Jahre nach Ende der Naziherrschaft leben müssen. Über ihr Schuldbewusstsein und das gleichzeitige Bedürfnis, die eigene Familie "sauber" zu halten. Es gibt eben keinen Schlussstrich.
Naomi Schenck bekennt sich zu dieser Zerrissenheit und macht sie produktiv, indem sie mit den Fragen, die sie an die Biografie ihres Großvaters stellt, am Ende auf die eigene Generation weist. Günther Schenck war Partei-und SA-Mitglied, doch kein Nazi wie sein Namensvetter. Das Uneindeutige macht die Beschäftigung mit seiner Persönlichkeit lohnenswert. Für die Autorin und den Leser.


