Nähe zur Kunst
Dass die Nationalsozialisten reaktionär waren, gilt als gesichert. Im Unterschied zu den Kommunisten. Die gelten oder galten zumindest lange Zeit als fortschrittlich. Wenn man aber die politische und mediale Selbstdarstellung des Kommunismus, des Faschismus und des Nationalsozialismus betrachtet und die darin dokumentierte Nähe zur modernen Kunst, muss man umdenken. Das wird in Steven Hellers Buch besonders deutlich.
Im 20. Jahrhundert begannen totalitäre Staaten zu ihrer Selbstdarstellung die gleichen graphischen Verfahren zu benützen wie private Unternehmen. Sowohl Diktatoren als auch Unternehmer setzten Markensymbole ein, um ihre Produkte und Programme durchzusetzen.
"Natürlich kann man die totalitären Parteien auf der Schiene links-rechts einordnen, aber das ist möglicherweise zu eingleisig. Es geht auch um Strategien der Selbstdarstellung, und die sind vielleicht aufschlussreicher als die ideologischen Kategorien des 19. Jahrhunderts. Die Aufmärsche auf dem Roten Platz am 1. Mai und die Reichsparteitage in Nürnberg zeigen eine beeindruckende Gemeinsamkeit. Aber noch immer stellen wir die falschen Fragen und bekommen weiterhin die falschen Antworten. Alle Jahre wieder regt man sich auf: Darf Hitlers "Mein Kampf" zum Verkauf freigegeben werden? Die Bayerische Staatsregierung, die die Rechte an dem Buch hält, beschwört die Gefahr, dass dessen Lektüre zur Wiederkehr des Nationalsozialismus und vielleicht sogar zu seiner ideologischen Machtergreifung in Deutschland führen könnte.
Was sich hier als christlich-soziale Antifa geriert, ist vor allem mangelnde Bildung. Gibt es denn eindeutige Belege dafür, dass ein moderner Deutscher durch die Lektüre von Hitlers "Mein Kampf", Nationalsozialist werden könnte? Oder dafür, dass jemand durch die Lektüre der drei Bände "Das Kapital" Kommunist geworden wäre? Politische Überzeugungen, politische Loyalitäten und politisches Handeln sind nur bedingt das Ergebnis von Lesen und Denken. Der Gitarre spielende Jimi Hendrix hat wahrscheinlich mehr zum Anti-Vietnam Protest beigetragen als irgendeine, noch so lange Analyse von Max Horkheimer. Steven Heller macht klar, wie sehr Musik und Bild und Ritual die eigentlichen Bausteine unseres modernen Bewusstseins sind."
Ein Vergleich der Selbstdarstellungsstrategien von privaten Unternehmen und von Diktaturen ist unüblich. Trotzdem entsprechen sich deren Werbe-Methoden. Die einen verkaufen eine Ideologie, die anderen einen Konsum-Artikel.
Politisches Bewusstsein ist in diesem Sinne ein Markenartikel, den der Politiker produziert und den der Bürger kauft. Dahinter steht die Vorstellung, dass Politik eine ideologische Ware liefert, die verschwommene, aber starke Sehnsüchte weckt.
"Erfolgreiche Markenzeichen verkünden immer eine Botschaft. Mit ihren Symbolen und ihren Ritualen entfesseln und steuern auch totalitäre Staaten Leidenschaften, sowohl Hass als auch Hoffnung. Sie schaffen damit ihre eigene politische Utopie."
Das nennt man Agitation. Agitation ist die Einheit von Kunst und Kampf, von Hingabe und Hass. Von Schdanow und Goebbels, von Churchill und Hitler, von "Panzerkreuzer Potemkin" und von "Iwan der Schreckliche", von "Triumph des Willens" und von "Fest der Schönheit". Agitation ist, kurz gesagt, Kunst, die nützt. Dagegen steht ein anderer, ein sehr viel älterer Begriff. Der heißt: L’art pour l’art. Er formuliert die entgegengesetzte Vorstellung, nämlich dass Kunst sich selbst genügt. Kunst einem Zweck zu unterwerfen, gilt hier als vulgär. L’art pour l’art feiert das Individuum, so wie es Caspar David Friedrich gemalt hat: fern und fremd und einsam.
Gelegentlich gibt es auch die Verschmelzung beider Tendenzen. Bei Ezra Pound etwa, dem radikalen Puristen und zugleich radikalen Agitator. Damit konnten seine Landsleute nicht umgehen und erklärten ihn zum Irren.
Walter Benjamin hat mit dem Begriff von der "Ästhetisierung der Politik" die Einheit von Politik und Sinnlichkeit auf den Nenner gebracht. Sie zielt auf Affekt und auf Rausch, auf das Irrationale und Unbewusste - nicht auf Logik und Argument und Besinnung. Sie macht klar, dass politische Kräfte sich aus dem Untergrund speisen, sich als Bewegung verstehen.
Dass die totalitären Regierungen nicht bodenständig sind, sondern bodenlos, dass ihre Kraft nicht aus dem Volk kommt und auch nicht aus dem Gedanken, sondern aus dem Design. Politik und Kunst werden zu einem eng verwobenen Artefakt.
Sie sind Event-Kultur: kosmopolitisch, preziös und nomadisch.
Der Totalitarismus zielt auf die im Kern entleerte, einsame Masse, wie David Riesman sie genannt hat, auf rastlos streunende Konsumenten in Stadien, in Kaufhäusern, bei Demonstrationen. Zusammengehalten durch mediale Kunststücke, reizempfindlich und immer in irgend einer Art von Aufbruch. Hier ist Solidarität das ideologische Konstrukt. Mit ihr möglich sind die größten Verbrechen und die größten Heldentaten.
Der amerikanische Soziologe Samuel Stouffer ist in seinem Buch "The American Soldier" der Frage nachgegangen, wieso die deutschen Soldaten bis zur letzten Stunde des Zweiten Weltkrieges, den Untergang vor Augen, so heldenhaft weitergekämpft haben. Die Antwort lautete: weil sie ihre Kameraden nicht in Stich lassen wollten. Das Gefühl, Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, eben Teil eines Größeren zu sein, das ist vielen Menschen wichtiger als allein zu sich zu finden.
Steven Hellers fulmimantes, eindrucksvoll bebildertes Buch "Iron fists" offenbart ungeahnte, schöne und auch schreckliche Bruderschaften. Es entlarvt, gewissermaßen mit linker Hand, den Zeitgeist.
"In Politik und Religion verträgt sich Schönheit sowohl mit Unsinn wie mit Terror."
Steven Heller: Iron fists. Branding the 20th-Century totalitarian state
Phaidon Verlag, London/New York/Berlin
"Natürlich kann man die totalitären Parteien auf der Schiene links-rechts einordnen, aber das ist möglicherweise zu eingleisig. Es geht auch um Strategien der Selbstdarstellung, und die sind vielleicht aufschlussreicher als die ideologischen Kategorien des 19. Jahrhunderts. Die Aufmärsche auf dem Roten Platz am 1. Mai und die Reichsparteitage in Nürnberg zeigen eine beeindruckende Gemeinsamkeit. Aber noch immer stellen wir die falschen Fragen und bekommen weiterhin die falschen Antworten. Alle Jahre wieder regt man sich auf: Darf Hitlers "Mein Kampf" zum Verkauf freigegeben werden? Die Bayerische Staatsregierung, die die Rechte an dem Buch hält, beschwört die Gefahr, dass dessen Lektüre zur Wiederkehr des Nationalsozialismus und vielleicht sogar zu seiner ideologischen Machtergreifung in Deutschland führen könnte.
Was sich hier als christlich-soziale Antifa geriert, ist vor allem mangelnde Bildung. Gibt es denn eindeutige Belege dafür, dass ein moderner Deutscher durch die Lektüre von Hitlers "Mein Kampf", Nationalsozialist werden könnte? Oder dafür, dass jemand durch die Lektüre der drei Bände "Das Kapital" Kommunist geworden wäre? Politische Überzeugungen, politische Loyalitäten und politisches Handeln sind nur bedingt das Ergebnis von Lesen und Denken. Der Gitarre spielende Jimi Hendrix hat wahrscheinlich mehr zum Anti-Vietnam Protest beigetragen als irgendeine, noch so lange Analyse von Max Horkheimer. Steven Heller macht klar, wie sehr Musik und Bild und Ritual die eigentlichen Bausteine unseres modernen Bewusstseins sind."
Ein Vergleich der Selbstdarstellungsstrategien von privaten Unternehmen und von Diktaturen ist unüblich. Trotzdem entsprechen sich deren Werbe-Methoden. Die einen verkaufen eine Ideologie, die anderen einen Konsum-Artikel.
Politisches Bewusstsein ist in diesem Sinne ein Markenartikel, den der Politiker produziert und den der Bürger kauft. Dahinter steht die Vorstellung, dass Politik eine ideologische Ware liefert, die verschwommene, aber starke Sehnsüchte weckt.
"Erfolgreiche Markenzeichen verkünden immer eine Botschaft. Mit ihren Symbolen und ihren Ritualen entfesseln und steuern auch totalitäre Staaten Leidenschaften, sowohl Hass als auch Hoffnung. Sie schaffen damit ihre eigene politische Utopie."
Das nennt man Agitation. Agitation ist die Einheit von Kunst und Kampf, von Hingabe und Hass. Von Schdanow und Goebbels, von Churchill und Hitler, von "Panzerkreuzer Potemkin" und von "Iwan der Schreckliche", von "Triumph des Willens" und von "Fest der Schönheit". Agitation ist, kurz gesagt, Kunst, die nützt. Dagegen steht ein anderer, ein sehr viel älterer Begriff. Der heißt: L’art pour l’art. Er formuliert die entgegengesetzte Vorstellung, nämlich dass Kunst sich selbst genügt. Kunst einem Zweck zu unterwerfen, gilt hier als vulgär. L’art pour l’art feiert das Individuum, so wie es Caspar David Friedrich gemalt hat: fern und fremd und einsam.
Gelegentlich gibt es auch die Verschmelzung beider Tendenzen. Bei Ezra Pound etwa, dem radikalen Puristen und zugleich radikalen Agitator. Damit konnten seine Landsleute nicht umgehen und erklärten ihn zum Irren.
Walter Benjamin hat mit dem Begriff von der "Ästhetisierung der Politik" die Einheit von Politik und Sinnlichkeit auf den Nenner gebracht. Sie zielt auf Affekt und auf Rausch, auf das Irrationale und Unbewusste - nicht auf Logik und Argument und Besinnung. Sie macht klar, dass politische Kräfte sich aus dem Untergrund speisen, sich als Bewegung verstehen.
Dass die totalitären Regierungen nicht bodenständig sind, sondern bodenlos, dass ihre Kraft nicht aus dem Volk kommt und auch nicht aus dem Gedanken, sondern aus dem Design. Politik und Kunst werden zu einem eng verwobenen Artefakt.
Sie sind Event-Kultur: kosmopolitisch, preziös und nomadisch.
Der Totalitarismus zielt auf die im Kern entleerte, einsame Masse, wie David Riesman sie genannt hat, auf rastlos streunende Konsumenten in Stadien, in Kaufhäusern, bei Demonstrationen. Zusammengehalten durch mediale Kunststücke, reizempfindlich und immer in irgend einer Art von Aufbruch. Hier ist Solidarität das ideologische Konstrukt. Mit ihr möglich sind die größten Verbrechen und die größten Heldentaten.
Der amerikanische Soziologe Samuel Stouffer ist in seinem Buch "The American Soldier" der Frage nachgegangen, wieso die deutschen Soldaten bis zur letzten Stunde des Zweiten Weltkrieges, den Untergang vor Augen, so heldenhaft weitergekämpft haben. Die Antwort lautete: weil sie ihre Kameraden nicht in Stich lassen wollten. Das Gefühl, Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, eben Teil eines Größeren zu sein, das ist vielen Menschen wichtiger als allein zu sich zu finden.
Steven Hellers fulmimantes, eindrucksvoll bebildertes Buch "Iron fists" offenbart ungeahnte, schöne und auch schreckliche Bruderschaften. Es entlarvt, gewissermaßen mit linker Hand, den Zeitgeist.
"In Politik und Religion verträgt sich Schönheit sowohl mit Unsinn wie mit Terror."
Steven Heller: Iron fists. Branding the 20th-Century totalitarian state
Phaidon Verlag, London/New York/Berlin
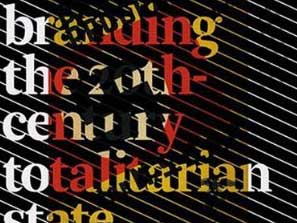
Cover: "Steven Heller: Iron fists"© Phaidon Verlag
