Mit Optimismus in die Zukunft
Wirtschaftskrise, katastrophale demographische Entwicklung, Generationenkonflikt. Deutschlands Zukunftsperspektiven sind keineswegs rosig. Doch Norbert Röttgen, derzeit Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, verbreitet Optimismus: "Deutschlands beste Jahre kommen noch" hat Röttgen sein Buch genannt, mit dem er sich zugleich für höhere Ämter empfehlen will.
Das sogenannte Legitimationsbuch ist aus und in der Wissenschaft bekannt. Das Wort meint Bücher, die geschrieben werden, um den Anspruch des Autors auf die nächste Stufe der akademischen Weihen zu begründen. Bücher dieser Art werden auch von Politikern verfasst; einer der letzten, die dies getan haben, ist Norbert Röttgen, zurzeit erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, demnächst aber wohl mehr. Sein Buch trägt den forschen Titel "Deutschlands beste Jahre kommen noch" und verspricht Antwort auf die Frage, warum wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen.
Das ist eine Antwort, die den Zweifel nährt, den sie zerstreuen will, schiebt sie die trübe Frage nach der Zukunft des Landes und den Gründen, die an ihr zweifeln lassen, doch vor sich her. Jeder Zeitungsleser kennt diese Gründe: die katastrophale Bevölkerungsstatistik, die wachsende Entfremdung zwischen Alt und Jung, die Verlangsamung, Vereinsamung und Verödung des Daseins und ihre absehbare Folge, das Scheitern der sozialen Sicherheit, die ohne ausreichenden Nachwuchs nicht glaubwürdig versprochen werden kann. Nicht ohne Grund sind die Sozialpolitiker so einsilbig geworden.
Röttgen ist ein Mann der Wirtschaft und schon deswegen gegen den Berufsoptimismus der Sozialpolitiker gefeit. Er formuliert bescheiden, wenn er am Schluss des Buches notiert:
"Dass Deutschlands beste Jahre noch kommen, wird auch angesichts der Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte der letzten 60 Jahre nicht zur Gewissheit."
Nicht zur Gewissheit: Das klingt vorsichtiger und ehrlicher als die wilden Fanfarenstöße, mit denen sich seine Kollegen von der sozialen Front hervorgetan haben. Was jeder Unternehmer weiß, das weiß auch Norbert Röttgen: dass Autos keine Autos kaufen. Dazu braucht man Menschen, lebendige, einfallsreiche, hoffnungsvolle und zahlungskräftige Menschen. Wo die knapp werden, wird alles andere auch knapp.
Röttgen will nicht weniger als eine Neubegründung der Politik und setzt dazu auf die Gestalt des Bürgers.
"Welche Begrifflichkeiten man auch wählt, die Aussage bleibt doch stets die gleiche: Deutschlands Zukunft sind seine Bürger."
Wenn das so ist, muss diese Zukunft umso düsterer aussehen, je schlechter es ihrem Träger, dem Bürger, geht; und dem geht es ganz offensichtlich an den Kragen. Beide Koalitionsparteien sind sich einig in der Absicht, den selbstständigen Bürger auf das Niveau eines Almosenempfängers herabzudrücken; sie unterscheiden sich nur in der Entschlossenheit, mit der sie dieses Ziel verfolgen. Wo die CDU zögert und bremst, kann es der SPD nicht schnell genug vorangehen.
Als Mittel dazu dient die Umstellung des sozialen Leistungskatalogs von der Beitrags- auf die Steuerfinanzierung. Nur Beiträge begründen ja Rechte, nur sie erlauben es dem Bürger, den Behörden selbstbewusst entgegenzutreten und aus eigenem Recht Ansprüche geltend zu machen; Steuern begründen gar nichts, nicht einmal den Anspruch auf Almosen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, hält Röttgen daran fest,
"dass die auf Arbeitsleistung beruhende und im Kern durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanzierte Rentenversicherung vorrangig gegenüber dem staatlichen, durch Steuermittel finanzierten Unterstützungssystem ist. Die Vermischung beider Systeme ... wäre unter dem Gesichtspunkt der Anerkennung von Leistung verheerend."
Schön und gut, wird man sagen; doch eben dazu muss es ja kommen, weil die Sozialversicherungssysteme, kaufmännisch betrachtet, heute schon pleite sind. Früher oder später wird das Versicherungsprinzip, das in den sozial genannten Zweigen der Betreuungsindustrie schon immer eine Lüge war, auch offiziell zu Grabe getragen und der Bürger zum Subventionsempfänger degradiert werden. Die Rente nach Kassenlage wird dann zur traurigen Regel; und nicht nur sie, weil für die Arbeitslosenversicherung längst schon das Gleiche gilt und die Umstellung der gesetzlichen Krankenversicherung auf Steuerfinanzierung in vollem Gange ist.
Röttgen will demgegenüber am Leistungsprinzip festhalten. Aber was versteht er darunter? Was kann, was soll die Berufung auf Leistung bedeuten, wenn ein Mann wie Jürgen Schrempp, der frühere Vorstandschef von Daimler-Chrysler, seine Optionen, Boni oder wie die erfolgsabhängig genannten Gehaltsbestandteile sonst noch heißen, in dem Moment einlöst, in dem der Aktienkurs des von ihm gesteuerten Unternehmens, erleichtert über die Nachricht vom Ausscheiden dieses habgierigen Mannes, steil in die Höhe schießt? So dass Schrempp nicht etwa für seine Leistung, sondern für seine Unfähigkeit mit einem Millionengewinn belohnt worden ist?
Der auch von Röttgen verwendete Begriff Risikogesellschaft passt nicht auf eine Gesellschaft, die solche Exzesse hervorbringt oder duldet. Denn sie zerlegt das Risiko ja ganz bewusst und folgenreich in seine Bestandteile: in die Chancen, die sie den wenigen vorbehält, die über die Höhe ihres Einkommens selbst bestimmen können, und in die Gefahren, die für die vielen vorgesehen sind, die sich von anderen vorrechnen lassen müssen, was sie wert sind. Ein Land, das es sich bieten lässt, das Risiko in dieser Weise aufzuspalten, ist keine Risikogesellschaft, sondern ein schlecht maskierter Ständestaat.
Anders als Röttgen das will, hat die Globalisierung eben nicht
"aus dem Hochlohnland Deutschland im Handumdrehen ein gefühltes Hochrisikoland gemacht - quer durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten."
Oh nein. Zusammen mit der Möglichkeit, Gefahren und Chancen höchst ungleich zu verteilen, hat die Globalisierung auch einen Menschentyp hervorgebracht, der schamlos genug ist, diese Möglichkeit bis zum letzten auszunutzen. Es ist ein moralischer Defekt, der die Globalisierung um ihren Kredit gebracht hat. Weshalb sie erst dann und nur dann Freunde finden wird, wenn sich die Moral, wie das Sprichwort es will, wieder von selbst versteht.
Norbert Röttgen: Deutschlands beste Jahre kommen noch
Piper Verlag, München/ 2008
Das ist eine Antwort, die den Zweifel nährt, den sie zerstreuen will, schiebt sie die trübe Frage nach der Zukunft des Landes und den Gründen, die an ihr zweifeln lassen, doch vor sich her. Jeder Zeitungsleser kennt diese Gründe: die katastrophale Bevölkerungsstatistik, die wachsende Entfremdung zwischen Alt und Jung, die Verlangsamung, Vereinsamung und Verödung des Daseins und ihre absehbare Folge, das Scheitern der sozialen Sicherheit, die ohne ausreichenden Nachwuchs nicht glaubwürdig versprochen werden kann. Nicht ohne Grund sind die Sozialpolitiker so einsilbig geworden.
Röttgen ist ein Mann der Wirtschaft und schon deswegen gegen den Berufsoptimismus der Sozialpolitiker gefeit. Er formuliert bescheiden, wenn er am Schluss des Buches notiert:
"Dass Deutschlands beste Jahre noch kommen, wird auch angesichts der Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte der letzten 60 Jahre nicht zur Gewissheit."
Nicht zur Gewissheit: Das klingt vorsichtiger und ehrlicher als die wilden Fanfarenstöße, mit denen sich seine Kollegen von der sozialen Front hervorgetan haben. Was jeder Unternehmer weiß, das weiß auch Norbert Röttgen: dass Autos keine Autos kaufen. Dazu braucht man Menschen, lebendige, einfallsreiche, hoffnungsvolle und zahlungskräftige Menschen. Wo die knapp werden, wird alles andere auch knapp.
Röttgen will nicht weniger als eine Neubegründung der Politik und setzt dazu auf die Gestalt des Bürgers.
"Welche Begrifflichkeiten man auch wählt, die Aussage bleibt doch stets die gleiche: Deutschlands Zukunft sind seine Bürger."
Wenn das so ist, muss diese Zukunft umso düsterer aussehen, je schlechter es ihrem Träger, dem Bürger, geht; und dem geht es ganz offensichtlich an den Kragen. Beide Koalitionsparteien sind sich einig in der Absicht, den selbstständigen Bürger auf das Niveau eines Almosenempfängers herabzudrücken; sie unterscheiden sich nur in der Entschlossenheit, mit der sie dieses Ziel verfolgen. Wo die CDU zögert und bremst, kann es der SPD nicht schnell genug vorangehen.
Als Mittel dazu dient die Umstellung des sozialen Leistungskatalogs von der Beitrags- auf die Steuerfinanzierung. Nur Beiträge begründen ja Rechte, nur sie erlauben es dem Bürger, den Behörden selbstbewusst entgegenzutreten und aus eigenem Recht Ansprüche geltend zu machen; Steuern begründen gar nichts, nicht einmal den Anspruch auf Almosen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, hält Röttgen daran fest,
"dass die auf Arbeitsleistung beruhende und im Kern durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanzierte Rentenversicherung vorrangig gegenüber dem staatlichen, durch Steuermittel finanzierten Unterstützungssystem ist. Die Vermischung beider Systeme ... wäre unter dem Gesichtspunkt der Anerkennung von Leistung verheerend."
Schön und gut, wird man sagen; doch eben dazu muss es ja kommen, weil die Sozialversicherungssysteme, kaufmännisch betrachtet, heute schon pleite sind. Früher oder später wird das Versicherungsprinzip, das in den sozial genannten Zweigen der Betreuungsindustrie schon immer eine Lüge war, auch offiziell zu Grabe getragen und der Bürger zum Subventionsempfänger degradiert werden. Die Rente nach Kassenlage wird dann zur traurigen Regel; und nicht nur sie, weil für die Arbeitslosenversicherung längst schon das Gleiche gilt und die Umstellung der gesetzlichen Krankenversicherung auf Steuerfinanzierung in vollem Gange ist.
Röttgen will demgegenüber am Leistungsprinzip festhalten. Aber was versteht er darunter? Was kann, was soll die Berufung auf Leistung bedeuten, wenn ein Mann wie Jürgen Schrempp, der frühere Vorstandschef von Daimler-Chrysler, seine Optionen, Boni oder wie die erfolgsabhängig genannten Gehaltsbestandteile sonst noch heißen, in dem Moment einlöst, in dem der Aktienkurs des von ihm gesteuerten Unternehmens, erleichtert über die Nachricht vom Ausscheiden dieses habgierigen Mannes, steil in die Höhe schießt? So dass Schrempp nicht etwa für seine Leistung, sondern für seine Unfähigkeit mit einem Millionengewinn belohnt worden ist?
Der auch von Röttgen verwendete Begriff Risikogesellschaft passt nicht auf eine Gesellschaft, die solche Exzesse hervorbringt oder duldet. Denn sie zerlegt das Risiko ja ganz bewusst und folgenreich in seine Bestandteile: in die Chancen, die sie den wenigen vorbehält, die über die Höhe ihres Einkommens selbst bestimmen können, und in die Gefahren, die für die vielen vorgesehen sind, die sich von anderen vorrechnen lassen müssen, was sie wert sind. Ein Land, das es sich bieten lässt, das Risiko in dieser Weise aufzuspalten, ist keine Risikogesellschaft, sondern ein schlecht maskierter Ständestaat.
Anders als Röttgen das will, hat die Globalisierung eben nicht
"aus dem Hochlohnland Deutschland im Handumdrehen ein gefühltes Hochrisikoland gemacht - quer durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten."
Oh nein. Zusammen mit der Möglichkeit, Gefahren und Chancen höchst ungleich zu verteilen, hat die Globalisierung auch einen Menschentyp hervorgebracht, der schamlos genug ist, diese Möglichkeit bis zum letzten auszunutzen. Es ist ein moralischer Defekt, der die Globalisierung um ihren Kredit gebracht hat. Weshalb sie erst dann und nur dann Freunde finden wird, wenn sich die Moral, wie das Sprichwort es will, wieder von selbst versteht.
Norbert Röttgen: Deutschlands beste Jahre kommen noch
Piper Verlag, München/ 2008
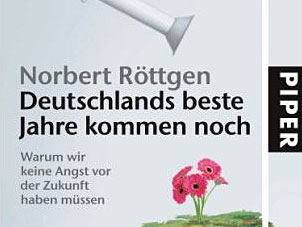
Norbert Röttgen:Deutschlands beste Jahre kommen noch© Piper Verlag
