Mit eiserner Hand
Der amerikanische Bürgerkrieg ist wohl eines der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte. Mit äußerster Härte geführt, führte er zur Einheit der Nation, markierte aber auch den Beginn einer Ära verlustreicher Kriege, die Kennzeichen des zwanzigsten Jahrhunderts werden sollten.
Man müsse den Bewohnern eines Feindeslandes so viel Leiden zufügen, hatte sich Bismarck zu Zeiten des deutsch-französischen Krieges von General Philip Sheridan, einem Veteranen des amerikanischen Bürgerkriegs, bei einem Abendessen raten lassen, dass sie sich nach Frieden sehnen. Man sollte alle feindlichen französischen Dörfer sofort ausbrennen und alle männlichen Einwohner hängen, meinte er.
Bismarck war entschieden dagegen, doch diese Art von Kriegsführung blieb, folgt man John Keegans neuem Buch über den amerikanischen Bürgerkrieg, tatsächlich das bleibende Erbe der Jahre 1861 bis 1865. Ein Stil der Kriegsführung, der Schlimmes für die Zukunft erwarten ließ. Keegan, der lange Zeit an der Royal Military Academy Sandhurst lehrte und durch Bücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg einem größeren Publikum bekannt ist, geht sogar so weit, die Linien bis zu Hitlers Vernichtungsfeldzug im Osten zu ziehen.
Dem mag man zustimmen oder eher mit angemessener Zurückhaltung begegnen. Doch es stimmt: William Tecumseh Shermans berühmter Marsch der Unionsarmeen durch Georgia und die beiden Carolinas war in weiten Teilen ein Kampf gegen die Zivilbevölkerung, die er durch äußerste Härte zum Aufgeben zwingen wollte.
Er hatte die erklärte Absicht, Georgia zum Heulen zu bringen und hinterließ eine Schneise verbrannter Erde, in deren Ergebnis Atlanta einem zusammengeschossenen Schutthaufen glich, Plantagenhäuser in Flammen standen und die Lebensmittel auch der einfachen Leute durch unnachgiebige Requisitionen zur Neige gingen. Sherman wollte gegen Ende des Krieges mit eiserner Hand eine Entscheidung herbeiführen. Er schrieb:
"Man kann Krieg nicht in schärfere Begriffe fassen, als ich es tue. Krieg ist Grausamkeit, und daran lässt sich nichts verbessern; und jene, die den Krieg in unser Land trugen, haben alle Flüche und Verwünschungen verdient, die man ausstoßen kann."
Merkwürdigerweise sind solche Ansichten ein Ergebnis der Demokratisierung des Krieges. Moderne Kriege, so Ulysses S. Grant, der letzte Oberkommandierende der Nordstaaten und spätere amerikanische Präsident, werden nicht zwischen Armeen, sondern zwischen Völkern ausgefochten.
Nicht zufällig galt das Kürzel seines Vornamens, U.S., vielen als Synonym für "Unconditional Surrender", bedingungslose Kapitulation. Tatsächlich standen sich in der Neuen Welt damals zwei amerikanische Völker gegenüber, die sich politisch und kulturell auseinanderentwickelt hatten. Die Sezessionisten der Konföderation des Südens waren für Grant in erster Linie rechtlose Rebellen.
Keegans Buch beginnt deshalb auch mit der Geschichte der Spaltung der Nation, die Abraham Lincoln schon vor Beginn der Gefechte als ein geteiltes Haus bezeichnete. Selbst der britische Liberale William Gladstone war damals der Ansicht, südlich des Potomac sei eine neue Nation im Entstehen begriffen. Dass sie auf Sklavenwirtschaft beruhte, störte ihn wenig, so lange ihre Baumwolle die englische Textilindustrie versorgte. Und im Süden selbst redete man sich ein, die eigene aristokratische Lebensweise sei der kalten Geldgier der Yankees im Norden weit überlegen.
Keegan erzählt sehr eindrücklich, wie aus Amerikanern, die sich auf die gleiche Unabhängigkeitserklärung beriefen, plötzlich Feinde wurden, die sich mit unnachgiebiger Härte gegenseitig bekämpften und sich dabei verlustreiche blutige Massenschlachten lieferten, die alles in den Schatten stellten, was man bis zum Ersten Weltkrieg kannte.
Nach der entscheidenden Schlacht bei Gettysburg sprach Lincoln im November 1863 in seiner berühmtesten, nur zwei Minuten dauernden Rede den öffentlichen Eid aus,
" …dass diese Nation unter Gottes Fügung zu neuer Freiheit geboren werde und dass die Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von dieser Erde verschwinde."
Doch auf dem Soldatenfriedhof von Gettysburg gibt es keine konföderierten Gräber. So weit ging und geht die Spaltung in Sieger und Besiegte. Kein Wunder, dass die Rekonstruktion des zerstörten Südens und der Kampf um die Gleichheit der Rassen noch über hundert Jahre beanspruchen würde, um erste Erfolge zu zeigen. Keegans lesenswertes Buch erwähnt auch diese Wunde.
In erster Linie jedoch erzählt es die Geschichte aus der Perspektive eines Militärhistorikers, der manchmal der Versuchung nicht widerstehen kann, sich zu sehr in Details über militärische Operationen, Waffentechnik, Geländebeschaffenheiten und Gefechtsverläufe zu verlieren. Doch eins bleibt nach der Lektüre unvergesslich. In diesen amerikanischen Schicksalsjahren begann die Ära der verlustreichen modernen Kriege, die Kennzeichen des dunklen zwanzigsten Jahrhunderts werden sollten.
John Keegan: Der amerikanische Bürgerkrieg
Rowohlt Verlag, Berlin 2010
Bismarck war entschieden dagegen, doch diese Art von Kriegsführung blieb, folgt man John Keegans neuem Buch über den amerikanischen Bürgerkrieg, tatsächlich das bleibende Erbe der Jahre 1861 bis 1865. Ein Stil der Kriegsführung, der Schlimmes für die Zukunft erwarten ließ. Keegan, der lange Zeit an der Royal Military Academy Sandhurst lehrte und durch Bücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg einem größeren Publikum bekannt ist, geht sogar so weit, die Linien bis zu Hitlers Vernichtungsfeldzug im Osten zu ziehen.
Dem mag man zustimmen oder eher mit angemessener Zurückhaltung begegnen. Doch es stimmt: William Tecumseh Shermans berühmter Marsch der Unionsarmeen durch Georgia und die beiden Carolinas war in weiten Teilen ein Kampf gegen die Zivilbevölkerung, die er durch äußerste Härte zum Aufgeben zwingen wollte.
Er hatte die erklärte Absicht, Georgia zum Heulen zu bringen und hinterließ eine Schneise verbrannter Erde, in deren Ergebnis Atlanta einem zusammengeschossenen Schutthaufen glich, Plantagenhäuser in Flammen standen und die Lebensmittel auch der einfachen Leute durch unnachgiebige Requisitionen zur Neige gingen. Sherman wollte gegen Ende des Krieges mit eiserner Hand eine Entscheidung herbeiführen. Er schrieb:
"Man kann Krieg nicht in schärfere Begriffe fassen, als ich es tue. Krieg ist Grausamkeit, und daran lässt sich nichts verbessern; und jene, die den Krieg in unser Land trugen, haben alle Flüche und Verwünschungen verdient, die man ausstoßen kann."
Merkwürdigerweise sind solche Ansichten ein Ergebnis der Demokratisierung des Krieges. Moderne Kriege, so Ulysses S. Grant, der letzte Oberkommandierende der Nordstaaten und spätere amerikanische Präsident, werden nicht zwischen Armeen, sondern zwischen Völkern ausgefochten.
Nicht zufällig galt das Kürzel seines Vornamens, U.S., vielen als Synonym für "Unconditional Surrender", bedingungslose Kapitulation. Tatsächlich standen sich in der Neuen Welt damals zwei amerikanische Völker gegenüber, die sich politisch und kulturell auseinanderentwickelt hatten. Die Sezessionisten der Konföderation des Südens waren für Grant in erster Linie rechtlose Rebellen.
Keegans Buch beginnt deshalb auch mit der Geschichte der Spaltung der Nation, die Abraham Lincoln schon vor Beginn der Gefechte als ein geteiltes Haus bezeichnete. Selbst der britische Liberale William Gladstone war damals der Ansicht, südlich des Potomac sei eine neue Nation im Entstehen begriffen. Dass sie auf Sklavenwirtschaft beruhte, störte ihn wenig, so lange ihre Baumwolle die englische Textilindustrie versorgte. Und im Süden selbst redete man sich ein, die eigene aristokratische Lebensweise sei der kalten Geldgier der Yankees im Norden weit überlegen.
Keegan erzählt sehr eindrücklich, wie aus Amerikanern, die sich auf die gleiche Unabhängigkeitserklärung beriefen, plötzlich Feinde wurden, die sich mit unnachgiebiger Härte gegenseitig bekämpften und sich dabei verlustreiche blutige Massenschlachten lieferten, die alles in den Schatten stellten, was man bis zum Ersten Weltkrieg kannte.
Nach der entscheidenden Schlacht bei Gettysburg sprach Lincoln im November 1863 in seiner berühmtesten, nur zwei Minuten dauernden Rede den öffentlichen Eid aus,
" …dass diese Nation unter Gottes Fügung zu neuer Freiheit geboren werde und dass die Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von dieser Erde verschwinde."
Doch auf dem Soldatenfriedhof von Gettysburg gibt es keine konföderierten Gräber. So weit ging und geht die Spaltung in Sieger und Besiegte. Kein Wunder, dass die Rekonstruktion des zerstörten Südens und der Kampf um die Gleichheit der Rassen noch über hundert Jahre beanspruchen würde, um erste Erfolge zu zeigen. Keegans lesenswertes Buch erwähnt auch diese Wunde.
In erster Linie jedoch erzählt es die Geschichte aus der Perspektive eines Militärhistorikers, der manchmal der Versuchung nicht widerstehen kann, sich zu sehr in Details über militärische Operationen, Waffentechnik, Geländebeschaffenheiten und Gefechtsverläufe zu verlieren. Doch eins bleibt nach der Lektüre unvergesslich. In diesen amerikanischen Schicksalsjahren begann die Ära der verlustreichen modernen Kriege, die Kennzeichen des dunklen zwanzigsten Jahrhunderts werden sollten.
John Keegan: Der amerikanische Bürgerkrieg
Rowohlt Verlag, Berlin 2010
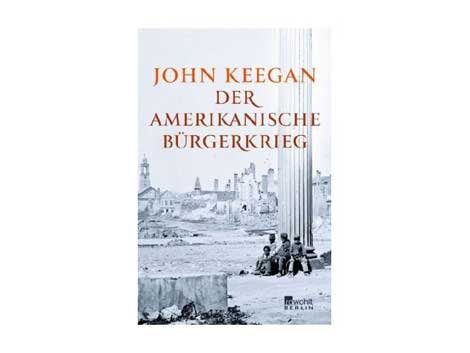
Cover: "Der amerikanische Bürgerkrieg" von John Keegan© Rohwolt Verlag
