Missionierung mit Gelehrten
In ihrem Buch "Von Jesuiten, Kaisern und Kanonen" beschreibt Claudia von Collanis ein friedliches Kapitel der europäischen Expansionsgeschichte. Eine spannende Kulturgeschichte über das Verhältnis zwischen dem Westen und dem fernen Osten vom späten Mittelalter bis zum Imperialismus.
Seit dem späten 16. Jahrhundert entfaltete sich in China eines der paradoxesten Kapitel christlicher Missionsgeschichte. Während die katholische Kirche in Europa den neuen, wissenschaftlich begründeten Weltbildern skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, entsandte sie gelehrte Jesuiten als Missionare an den chinesischen Kaiserhof.
Statt das einfache Volk zu bekehren und damit die Obrigkeit der größten Wirtschaftsmacht der Welt zu provozieren, wandten sie sich an deren politische Führung. Die Naturwissenschaft diente dabei als Magd der Theologie - oder sollte es zumindest, wie der Flame Ferdinand Verbiest 1678 schrieb:
""Die Astronomie und alle anderen mathematischen Disziplinen, besonders die attraktiven wie Optik, Statik, endlich auch die theoretische und praktische Mechanik mit ihrem ganzen Drumherum sind, besonders in den Augen der Chinesen, die schönsten der Musen. Unsere heilige Religion führt sich bei den Fürsten und Provinzgouverneuren leichter ein unter dem Sternenmantel der Astronomie.""
Pater Verbiest war nicht nur ein scharfsinniger Denker, sondern auch ein genialer Konstrukteur, der dem jugendlichen Kaiser Kangxi ein automatisches Dampfwägelchen baute und ihn so für europäische Technik begeisterte. Papst Innozenz XI. zeigte sich in einem Breve, einem kurzen Schriftstück vom 3. Dezember 1681 erfreut:
""Nichts aber hat uns mehrers erlustiget / als aus besagt deinem Send-Schreiben zu vernehmen / wie weis- und geschicklich du den Gebrauch dern Sinesischen obschon weltlichen Wissenschafften dahin verleitest / dass sie denselbigen Völckern zu ihrer Seeligkeit / auch zum Aufnahm und Nutzen des Christenthums ein Antrieb sind". "
Claudia von Collani beschreibt, wie die Ordensleute sich im China der Ming- und Qing-Dynastie Zugang zu höchsten Würdenträgern, ja zum Kaiser selbst verschafften. Das gelang auch deshalb, weil das Reich der Mitte seinen Zenit überschritten hatte und gegenüber dem innovationsfreudigen Europa ins Hintertreffen geraten war.
So staunte man im Land, das einst Schießpulver und Kompass hervorgebracht hatte, über Uhren und mechanisches Spielzeug, astronomische Instrumente und perspektivische Malerei. Und man las neben den mathematischen Lehrbüchern, die von Jesuiten auf Chinesisch verfasst wurden, auch deren theologische Abhandlungen.
Gelehrte Jesuiten unterstützen den kaiserlichen Hof bei einer Kalenderreform, betrieben das Observatorium, leiteten sogar auch Fabriken. Zwar unterzeichnete der Kaiser 1692 ein Toleranzedikt, das Missionaren und chinesischen Christen Freiräume gewährte. Doch wurde es nicht mit den religiösen Vorzügen des Christentums begründet, sondern mit den Verdiensten der Europäer "in der Astronomie und beim Kanonengießen".
Letztlich war auch der Vatikan nicht von der Methode der Akkommodation überzeugt, also davon, dass sich die fremde Religion regionalen Gegebenheiten anpasst, auslotet, wieweit die konfuzianische Staatsphilosophie mit dem Christentum vereinbar ist, und versucht, traditionelle Bräuche in die eigenen Riten einzubeten.
Darüber gerieten die Missionare - Jesuiten, Dominikaner und Franziskaner - untereinander in den sogenannten "Ritenstreit", den Rom 1704 entschied. Der Papst verbot, den chinesischen Gläubigen, an der Verehrung des Himmels, der Obrigkeit, der Eltern, Lehrer und Ahnen teilzunehmen. Seinem Gesandten, der dies starrsinnig verkündet hatte, gab Kaiser Kangxi Folgendes mit auf den Weg:
"Unsere Regierung basiert ganz auf den Lehren des Konfuzius. Wenn die christliche Religion nicht völlig mit dieser Lehre im Einklang stehen kann, dann können die Europäer nicht in China bleiben."
Der Versuch war gescheitert, den Glauben einerseits von oben mithilfe der Wissenschaft, also mit rationalen Mitteln, zu verbreiten, andererseits von unten durch kulturelle Toleranz. Die Wahrer dieses Glaubens beharrten auf dem Vorrang der christlichen Botschaft.
Claudia von Collani lehrt am Institut für Missionswissenschaft der westfälischen Wilhelms-Universität Münster und geht dementsprechend der Sichtweise der missionierenden Ordensleute nach. Gleichwohl zeigt ihr Buch die ironischen Volten, die die Geschichte damals schlug. Der Versuch, eine fremde Kultur nicht mit Schwert und Bibel, sondern mit Gelehrten und Lehrbüchern für das Christentum einzunehmen, löste Folgen aus, die über sein Scheitern hinausführten.
Europas Geisteselite von Leibniz bis Voltaire war fasziniert von der wohlgeordneten Gesellschaft Chinas, seiner konfuzianischen Lehre und von seinem staatlichen Prüfungssystem, bei dem nicht die Herkunft, sondern bestandene Examina über Beamtenkarrieren entschieden:
""Schon am Hof des Kurfürsten von Brandenburg befasste sich Samuel Freiherr von Pufendorf mit konfuzianischen Ideen und speziell mit der chinesischen Beamtenprüfung. Auf seinen Einfluss hin fanden bereits 1693 in Berlin die ersten schriftlichen und mündlichen Beamtenprüfungen der europäischen Geschichte statt und im Jahr 1791 wurden in Frankreich nach dem Vorbild Chinas Examina zur Prüfung der Beamten eingeführt.""
So hat die gescheiterte Missionierung Chinas ungewollt zur Säkularisierung Europas beigetragen, indem sie das Vorbild der konfuzianischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie verbreitete. Claudia von Collanis Buch führt uns nicht nur ein bemerkenswert friedliches Kapitel der europäischen Expansionsgeschichte vor Augen, sondern zeigt auch, dass der Sternenmantel der Astronomie am Ende mehr Licht, sprich mehr Aufklärung verbreitet hat, als beabsichtigt.
Statt das einfache Volk zu bekehren und damit die Obrigkeit der größten Wirtschaftsmacht der Welt zu provozieren, wandten sie sich an deren politische Führung. Die Naturwissenschaft diente dabei als Magd der Theologie - oder sollte es zumindest, wie der Flame Ferdinand Verbiest 1678 schrieb:
""Die Astronomie und alle anderen mathematischen Disziplinen, besonders die attraktiven wie Optik, Statik, endlich auch die theoretische und praktische Mechanik mit ihrem ganzen Drumherum sind, besonders in den Augen der Chinesen, die schönsten der Musen. Unsere heilige Religion führt sich bei den Fürsten und Provinzgouverneuren leichter ein unter dem Sternenmantel der Astronomie.""
Pater Verbiest war nicht nur ein scharfsinniger Denker, sondern auch ein genialer Konstrukteur, der dem jugendlichen Kaiser Kangxi ein automatisches Dampfwägelchen baute und ihn so für europäische Technik begeisterte. Papst Innozenz XI. zeigte sich in einem Breve, einem kurzen Schriftstück vom 3. Dezember 1681 erfreut:
""Nichts aber hat uns mehrers erlustiget / als aus besagt deinem Send-Schreiben zu vernehmen / wie weis- und geschicklich du den Gebrauch dern Sinesischen obschon weltlichen Wissenschafften dahin verleitest / dass sie denselbigen Völckern zu ihrer Seeligkeit / auch zum Aufnahm und Nutzen des Christenthums ein Antrieb sind". "
Claudia von Collani beschreibt, wie die Ordensleute sich im China der Ming- und Qing-Dynastie Zugang zu höchsten Würdenträgern, ja zum Kaiser selbst verschafften. Das gelang auch deshalb, weil das Reich der Mitte seinen Zenit überschritten hatte und gegenüber dem innovationsfreudigen Europa ins Hintertreffen geraten war.
So staunte man im Land, das einst Schießpulver und Kompass hervorgebracht hatte, über Uhren und mechanisches Spielzeug, astronomische Instrumente und perspektivische Malerei. Und man las neben den mathematischen Lehrbüchern, die von Jesuiten auf Chinesisch verfasst wurden, auch deren theologische Abhandlungen.
Gelehrte Jesuiten unterstützen den kaiserlichen Hof bei einer Kalenderreform, betrieben das Observatorium, leiteten sogar auch Fabriken. Zwar unterzeichnete der Kaiser 1692 ein Toleranzedikt, das Missionaren und chinesischen Christen Freiräume gewährte. Doch wurde es nicht mit den religiösen Vorzügen des Christentums begründet, sondern mit den Verdiensten der Europäer "in der Astronomie und beim Kanonengießen".
Letztlich war auch der Vatikan nicht von der Methode der Akkommodation überzeugt, also davon, dass sich die fremde Religion regionalen Gegebenheiten anpasst, auslotet, wieweit die konfuzianische Staatsphilosophie mit dem Christentum vereinbar ist, und versucht, traditionelle Bräuche in die eigenen Riten einzubeten.
Darüber gerieten die Missionare - Jesuiten, Dominikaner und Franziskaner - untereinander in den sogenannten "Ritenstreit", den Rom 1704 entschied. Der Papst verbot, den chinesischen Gläubigen, an der Verehrung des Himmels, der Obrigkeit, der Eltern, Lehrer und Ahnen teilzunehmen. Seinem Gesandten, der dies starrsinnig verkündet hatte, gab Kaiser Kangxi Folgendes mit auf den Weg:
"Unsere Regierung basiert ganz auf den Lehren des Konfuzius. Wenn die christliche Religion nicht völlig mit dieser Lehre im Einklang stehen kann, dann können die Europäer nicht in China bleiben."
Der Versuch war gescheitert, den Glauben einerseits von oben mithilfe der Wissenschaft, also mit rationalen Mitteln, zu verbreiten, andererseits von unten durch kulturelle Toleranz. Die Wahrer dieses Glaubens beharrten auf dem Vorrang der christlichen Botschaft.
Claudia von Collani lehrt am Institut für Missionswissenschaft der westfälischen Wilhelms-Universität Münster und geht dementsprechend der Sichtweise der missionierenden Ordensleute nach. Gleichwohl zeigt ihr Buch die ironischen Volten, die die Geschichte damals schlug. Der Versuch, eine fremde Kultur nicht mit Schwert und Bibel, sondern mit Gelehrten und Lehrbüchern für das Christentum einzunehmen, löste Folgen aus, die über sein Scheitern hinausführten.
Europas Geisteselite von Leibniz bis Voltaire war fasziniert von der wohlgeordneten Gesellschaft Chinas, seiner konfuzianischen Lehre und von seinem staatlichen Prüfungssystem, bei dem nicht die Herkunft, sondern bestandene Examina über Beamtenkarrieren entschieden:
""Schon am Hof des Kurfürsten von Brandenburg befasste sich Samuel Freiherr von Pufendorf mit konfuzianischen Ideen und speziell mit der chinesischen Beamtenprüfung. Auf seinen Einfluss hin fanden bereits 1693 in Berlin die ersten schriftlichen und mündlichen Beamtenprüfungen der europäischen Geschichte statt und im Jahr 1791 wurden in Frankreich nach dem Vorbild Chinas Examina zur Prüfung der Beamten eingeführt.""
So hat die gescheiterte Missionierung Chinas ungewollt zur Säkularisierung Europas beigetragen, indem sie das Vorbild der konfuzianischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie verbreitete. Claudia von Collanis Buch führt uns nicht nur ein bemerkenswert friedliches Kapitel der europäischen Expansionsgeschichte vor Augen, sondern zeigt auch, dass der Sternenmantel der Astronomie am Ende mehr Licht, sprich mehr Aufklärung verbreitet hat, als beabsichtigt.
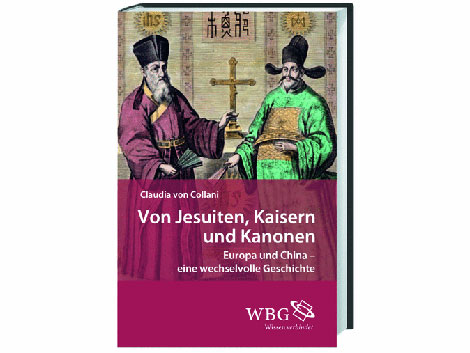
Cover - Claudia von Collani: Von Jesuiten, Kaisern und Kanonen© Rough Trade
Claudia von Collani: Von Jesuiten, Kaisern und Kanonen. Europa und China - eine wechselvolle Geschichte
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2012
195 Seiten, 29,90 Euro
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2012
195 Seiten, 29,90 Euro
