Missbraucht - und seelisch verwundet
"Mein Abschied vom Himmel" von Hamed Abdel-Samad ist die Geschichte eines in seiner Kindheit missbrauchten muslimischen Mannes.
Vier Jahre war Hamed Abdel-Samad alt, als seine Welt zusammenbrach; nein, nicht zusammenbrach, sondern in Stücke geschlagen wurde, in so viele, dass sie sich kaum mehr zusammensetzen ließ. In diesem Alter wurde er – zum ersten Mal - von einem zehn Jahre älteren Handwerkslehrling vergewaltigt.
Die Folgen des Missbrauchs sind kaum zu unterschätzen: Vertrauensverlust, Selbsthass, Rückzug auf sich selbst. Die Vergewaltigung verstärkt die nicht ungefährliche Neigungen eines ohnehin zur Absonderung neigenden Einzelgängers: Der junge Abdel-Samad entwickelt ein distanziertes Verhältnis zur Welt; nicht so sehr zu den Menschen als zu dem, was sie glauben und ergeben hinnehmen. Er durchlebt das Drama des begabten Kindes, eingepfercht in eine Welt, die intellektuell zu eng für ihn ist.
Der Vater, Prediger in einem Dorf 60 Kilometer von Kairo, drängt ihn, den Koran auswendig zu lernen - und zwar den gesamten, bis zum zwölften Lebensjahr, so wie es der Vater als junger Mensch selbst geschafft hatte. Der Sohn schafft es – beinahe, aber eben nicht ganz.
Ohnehin beschäftigen ihn andere Probleme: Warum schlägt der Vater, der gottergebene Prediger, wie so viele ägyptische Männer, seine Ehefrau? Darum, antwortet Abdel-Samad, weil in Ägypten nichts offen ausgesprochen wird, die Gesellschaft sich selbst abschottet.
"Je geschlossener eine Gesellschaft ist, desto weniger kommt sie in Kontakt mit der Außenwelt. Isolation verhindert, dass die innere Spannung einer Gesellschaft nach außen getragen wird. Zwei Sorten von Menschen leiden besonders unter solchen Verhältnissen: die Schwachen, das heißt, Frauen, Kinder und Tiere einerseits, und die Abtrünnigen andererseits, die das System in Frage stellen.
Der wahre Gott sind die Dogmen, die Verborgenheit und Solidarität versprechen und dafür die Individualität des Menschen und seine elementaren Rechte aufsaugen. Misshandlung, Gewalt und Unterdrückung sind in so einem System zwar weder vorgesehen noch gewollt, sie sind jedoch vorprogrammiert."
Auch wenn Abdel-Samad vor dieser Welt nach Deutschland flieht, ist sein Buch alles andere als eine Abrechnung mit der alten Heimat und deren Religion. Man kann, schreibt er, nicht alle Missstände in der arabischen Welt auf den Islam zurückführen.
Wer das tut, kritisiert er die deutsch-türkische Soziologin Necla Kelek, denke kaum weniger fundamentalistisch als die islamistischen Hardliner selbst: Denn auch sie konzentrieren ihr gesamtes Weltbild ja auf den Islam, leiten alles und jedes von ihm ab. Doch die Wirklichkeit, schreibt Abdel-Samad, ist komplexer: wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Westen und seinem technologischen Vorsprung und der Verlust überzeugender Ideale.
All dies sind Probleme, die den Menschen der arabischen Welt bis heute zu schaffen machen. Das führt zu weltanschaulicher Zerrissenheit, so auch bei dem jungen Abdel-Samad selbst, der während seiner Studienzeit in Kairo zu ganz unterschiedlichen Gruppen Kontakt hatte. Dort stieß er auf die Muslimbrüder. Aber:
"Den Kontakt zu den Marxisten hatte ich trotz meiner neuen Ausrichtung nicht ganz abgebrochen. Ich war somit mit verschiedenen Menschen befreundet, die sich, wenn sie sich einmal getroffen, die Köpfe eingeschlagen hätten. Ich war einer der aktivsten Missionare im Wohnheim. Es gelang mir sogar, einen der hartnäckigsten Marxisten für die Muslimbrüder zu werben."
Abdel-Samad kommt als Student nach Deutschland. Rasch lernt er die Sprache, zudem auch Japanisch. In Japan verbringt er mehrere Monate, immer auf spiritueller Suche. Doch es hilft nichts. Gott schweigt, auch in Japan. Aber er lernt dort: Die Götter leben nur zeitweilig: Immer dann, wenn der Mensch sie anruft. Sie werden erst durch den Menschen zum Leben erweckt. Die Erkenntnis bringt ihn weiter.
Der Koran verzaubert ihn nach wie vor ästhetisch, doch in religiöser Hinsicht sagt er sich von ihm los. Irgendwann, zu Besuch bei seinen Eltern, sieht er seine ehemaligen Landsleute mit einem neuen, versöhnlichen Blick.
"Sie sahen nicht aus wie Menschen, die morgens aufstehen und vorsätzlich beschlossen, ihre Mitmenschen zu quälen. Sie jagten einfach ihrem Brot nach und hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, in welchem System sie lebten. Meine Schmerzen hatten mich all die Jahre daran gehindert, die vielen gütigen Augen um mich wahrzunehmen."
Abdel-Samad hat ein sehr feinsinniges, aufmerksames Buch geschrieben, und es ist nicht übertrieben, sein Buch, auch wenn es kein fiktionales ist, in die Tradition der großen deutschen Entwicklungsromane, eines Herman Hesse oder Robert Musil, zu stellen. So verschieden die Tonlagen und Themen sind, die Sensibilität ist die gleiche.
Im Dialog Orient und Okzident brauchen wir keine Kampfschriften. Wir brauchen wache, empfindsame Beobachter wie Hamed Abdel-Samad.
Hamed Abdel-Samad: Mein Abschied vom Himmel. Aus dem Leben eines Muslims in Deutschland
Fackelträger Verlag, 312 Seiten, 19,95 Euro
Die Folgen des Missbrauchs sind kaum zu unterschätzen: Vertrauensverlust, Selbsthass, Rückzug auf sich selbst. Die Vergewaltigung verstärkt die nicht ungefährliche Neigungen eines ohnehin zur Absonderung neigenden Einzelgängers: Der junge Abdel-Samad entwickelt ein distanziertes Verhältnis zur Welt; nicht so sehr zu den Menschen als zu dem, was sie glauben und ergeben hinnehmen. Er durchlebt das Drama des begabten Kindes, eingepfercht in eine Welt, die intellektuell zu eng für ihn ist.
Der Vater, Prediger in einem Dorf 60 Kilometer von Kairo, drängt ihn, den Koran auswendig zu lernen - und zwar den gesamten, bis zum zwölften Lebensjahr, so wie es der Vater als junger Mensch selbst geschafft hatte. Der Sohn schafft es – beinahe, aber eben nicht ganz.
Ohnehin beschäftigen ihn andere Probleme: Warum schlägt der Vater, der gottergebene Prediger, wie so viele ägyptische Männer, seine Ehefrau? Darum, antwortet Abdel-Samad, weil in Ägypten nichts offen ausgesprochen wird, die Gesellschaft sich selbst abschottet.
"Je geschlossener eine Gesellschaft ist, desto weniger kommt sie in Kontakt mit der Außenwelt. Isolation verhindert, dass die innere Spannung einer Gesellschaft nach außen getragen wird. Zwei Sorten von Menschen leiden besonders unter solchen Verhältnissen: die Schwachen, das heißt, Frauen, Kinder und Tiere einerseits, und die Abtrünnigen andererseits, die das System in Frage stellen.
Der wahre Gott sind die Dogmen, die Verborgenheit und Solidarität versprechen und dafür die Individualität des Menschen und seine elementaren Rechte aufsaugen. Misshandlung, Gewalt und Unterdrückung sind in so einem System zwar weder vorgesehen noch gewollt, sie sind jedoch vorprogrammiert."
Auch wenn Abdel-Samad vor dieser Welt nach Deutschland flieht, ist sein Buch alles andere als eine Abrechnung mit der alten Heimat und deren Religion. Man kann, schreibt er, nicht alle Missstände in der arabischen Welt auf den Islam zurückführen.
Wer das tut, kritisiert er die deutsch-türkische Soziologin Necla Kelek, denke kaum weniger fundamentalistisch als die islamistischen Hardliner selbst: Denn auch sie konzentrieren ihr gesamtes Weltbild ja auf den Islam, leiten alles und jedes von ihm ab. Doch die Wirklichkeit, schreibt Abdel-Samad, ist komplexer: wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Westen und seinem technologischen Vorsprung und der Verlust überzeugender Ideale.
All dies sind Probleme, die den Menschen der arabischen Welt bis heute zu schaffen machen. Das führt zu weltanschaulicher Zerrissenheit, so auch bei dem jungen Abdel-Samad selbst, der während seiner Studienzeit in Kairo zu ganz unterschiedlichen Gruppen Kontakt hatte. Dort stieß er auf die Muslimbrüder. Aber:
"Den Kontakt zu den Marxisten hatte ich trotz meiner neuen Ausrichtung nicht ganz abgebrochen. Ich war somit mit verschiedenen Menschen befreundet, die sich, wenn sie sich einmal getroffen, die Köpfe eingeschlagen hätten. Ich war einer der aktivsten Missionare im Wohnheim. Es gelang mir sogar, einen der hartnäckigsten Marxisten für die Muslimbrüder zu werben."
Abdel-Samad kommt als Student nach Deutschland. Rasch lernt er die Sprache, zudem auch Japanisch. In Japan verbringt er mehrere Monate, immer auf spiritueller Suche. Doch es hilft nichts. Gott schweigt, auch in Japan. Aber er lernt dort: Die Götter leben nur zeitweilig: Immer dann, wenn der Mensch sie anruft. Sie werden erst durch den Menschen zum Leben erweckt. Die Erkenntnis bringt ihn weiter.
Der Koran verzaubert ihn nach wie vor ästhetisch, doch in religiöser Hinsicht sagt er sich von ihm los. Irgendwann, zu Besuch bei seinen Eltern, sieht er seine ehemaligen Landsleute mit einem neuen, versöhnlichen Blick.
"Sie sahen nicht aus wie Menschen, die morgens aufstehen und vorsätzlich beschlossen, ihre Mitmenschen zu quälen. Sie jagten einfach ihrem Brot nach und hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, in welchem System sie lebten. Meine Schmerzen hatten mich all die Jahre daran gehindert, die vielen gütigen Augen um mich wahrzunehmen."
Abdel-Samad hat ein sehr feinsinniges, aufmerksames Buch geschrieben, und es ist nicht übertrieben, sein Buch, auch wenn es kein fiktionales ist, in die Tradition der großen deutschen Entwicklungsromane, eines Herman Hesse oder Robert Musil, zu stellen. So verschieden die Tonlagen und Themen sind, die Sensibilität ist die gleiche.
Im Dialog Orient und Okzident brauchen wir keine Kampfschriften. Wir brauchen wache, empfindsame Beobachter wie Hamed Abdel-Samad.
Hamed Abdel-Samad: Mein Abschied vom Himmel. Aus dem Leben eines Muslims in Deutschland
Fackelträger Verlag, 312 Seiten, 19,95 Euro
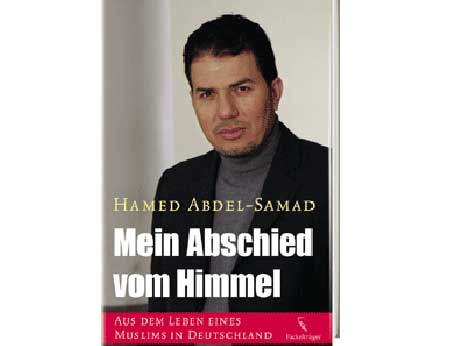
Cover: "Hamed Abdel-Samad: Mein Abschied vom Himmel"© Fackelträger-Verlag
