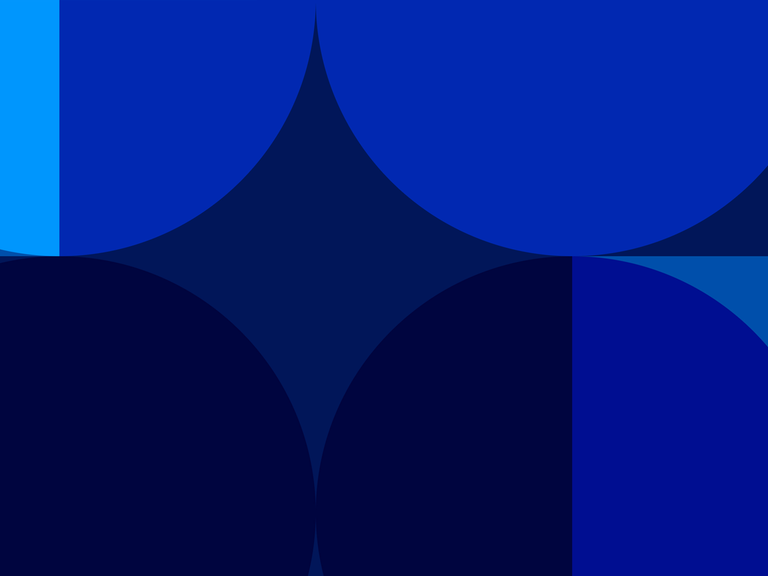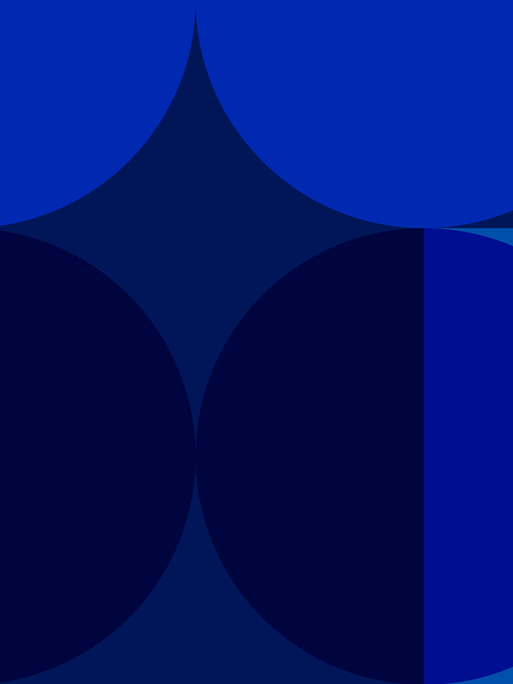Inklusion

Die Rechtslage in Deutschland sieht die Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor. Doch überall warten Hindernisse. © picture alliance / imageBROKER / Rainer F. Steussloff
Mühevoller Kampf um Teilhabe

Teilhabe am öffentlichen Leben: Das sollte für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein. Doch in der Realität müssen sie oft um notwendige Hilfen kämpfen. Der Fall von Stefanie Ulrich und ihrem Sohn Johannes zeigt, wie viel Kraft das kostet.
Stefanie Ulrich ist fast einen Kopf kleiner als ihr Sohn Johannes. Sie schiebt seinen Rollstuhl über die Kirmes in Freiburg, redet und lacht. Ihr Ziel: der Autoscooter.
2001 kam Johannes zur Welt. Für seine Behinderung gab es zuerst keine Erklärung. Bis zur Diagnose vergingen drei bange Jahre. Schließlich hieß es, ein kleines doppeltes Chromosomen-Stückchen sei verantwortlich.
Seit einem knappen Vierteljahrhundert betreut Ulrich nun ihren Sohn und versucht, ihm ein Leben mit einem gewöhnlichen Alltag in der Gesellschaft zu ermöglichen. Johannes soll teilhaben.
Was erst einmal selbstverständlich klingt und auch von der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert wird, scheitert in Deutschland allerdings nicht selten an Strukturen, Behörden oder Wohnheimen, die es aufgrund des knappen Personals oft kaum über den Satt-und-sauber-Zustand hinaus schaffen.
Streit mit Ämtern und Krankenkassen
Das stellt Betreuungspersonen, die für ihre Angehörigen mit Behinderung mehr als das wollen, vor enorme Herausforderungen. Über Gesetze und deren Ausgestaltung kann mit der zuständigen Stelle kleinteilig gestritten werden – welcher Antrag ist berechtigt, welcher nicht? Schon um den ersten Rollstuhl für Johannes musste seine Mutter kämpfen.
Allein die Bürokratie, um einen Menschen mit Behinderung zu betreuen, sei schon sehr aufwendig, sagt Dagmar Schnürer, Stefanie Ulrichs Anwältin: „Das ist auf jeden Fall ein Teilzeitjob.“
Johannes Ulrich lebt seit 2022 in einem Wohnheim in Heitersheim, eine halbe Autostunde von Freiburg entfernt. In Johannes' Wohngruppe leben 18 Personen mit schweren Behinderungen.
Doch noch immer verbringt er auch viel Zeit zu Hause bei seiner Mutter. Von klein auf ist Stefanie Ulrich mit ihm zur Logopädin gegangen. Dank der Therapie kann er sich heute gut verständigen. Bei anderen alltäglichen Dingen braucht er aber viel Unterstützung, zum Beispiel bei der Körperpflege.
Johannes hat ein „H“ und „B“ im Schwerbehindertenausweis. Das „H“ steht für „hilflos“. Es zeigt an, dass er dauernd fremde Hilfe benötigt. Das „B“ steht für „Begleitperson“, die Johannes im Alltag braucht; zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Burnout und Tumor-OP
2009 hatte Stefanie Ulrich den ersten pflegebedingten Burnout, 2017 dann auch noch eine Tumor-OP. Danach war sie offiziell fünf Jahre lang nicht arbeitsfähig. Trotzdem kümmerte sie sich weiter ohne Pause um ihren Sohn. Momentan lebt sie im Wesentlichen von dem, was sie eigentlich für das Alter zurückgelegt hat.
Parallel muss sie immer wieder um die Rechte ihres Sohnes kämpfen. Laut der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention und dem Bundesteilhabegesetz steht jedem Menschen mit Behinderung ein selbständiges Leben mit Assistenz in einem eigenen Zuhause zu. Doch es gibt nicht ausreichend geeigneten Wohnraum für Menschen mit Behinderungen, und was staatlicherseits an Hilfen und Assistenz bezahlt wird, hängt erst einmal von der Einschätzung der Ämter ab.
Jahrelange Briefwechsel über Zuständigkeiten
In Johannes‘ Fall lehnen Ämter und Krankenkasse Hilfen nicht selten ab und schieben sich in jahrelangen Briefwechseln die Zuständigkeiten gegenseitig zu. Seit 2022 kämpft Stefanie Ulrich um eine Teleskop-Rampe für ihr Auto, in das sie den fast 50 kg schweren Rollstuhl allein nicht einladen kann. Bis heute ist die Rampe nicht genehmigt. Das Landratsamt meint: Johannes Ulrich sei im Heim ausreichend versorgt. Darüber hinaus sei es nicht zuständig.
Das Besondere am Fall von Johannes Ulrich sei nicht, dass er Bedarfe hätte, die andere Behinderte nicht hätten, sagt Roland Rosenow, Professor für „Recht der Sozialen Sicherung“ an der Katholischen Hochschule in Freiburg. „Das Besondere ist einzig und allein, dass er eine Betreuerin hat, seine Mutter, die sich wehrt, die dem System Widerstand entgegensetzt.“
Ulrich sei schlicht nicht damit einverstanden, dass ihr Kind in einer Situation bleibe, die wie das Amen in der Kirche zu klassischer Hospitalisierung führe, meint der Sozialrechtsexperte. Fälle wie den der Kleinfamilie Ulrich gibt es viele. Nur geben die Eltern in der Regel früher auf.
„Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe“
Stefanie Ulrich wandte sich 2022 an das Projekt "RechtSo!", das von Rosenow mitgeleitet wird. Er ist deswegen mit dem Fall vertraut. Nach Ansicht der Mutter wurde Johannes im Heim nicht gut unterstützt, sie wollte sein Recht auf „Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe“ einklagen.
Nach mehr als drei Jahren Rechtsstreit verurteilte das Sozialgericht Freiburg im Mai 2025 den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dazu, Johannes Ulrich eine tägliche Anzahl von Assistenz-Stunden zur sozialen Teilhabe zu gewähren – im Umfang von drei Stunden wochentags, wenn Johannes in einer Werkstatt betreut wird, sowie 6,5 Stunden an Wochenend- und Feiertagen.
Ein Rechtsstreit nimmt kein Ende
Nur ein halbes Jahr später schreibt das Landratsamt an Johannes Ulrich: „Es sind drei Viertel Ihres Bedarfes an Assistenzleistungen in Abzug zu bringen, da Ihre Mutter und rechtliche Betreuerin in dieser Zeit freiwillig mit Ihnen am sozialen Leben partizipiert. Ein Bedarf für eine persönliche Assistenz darüber hinaus konnten wir nicht feststellen.“ Der Rechtsstreit geht weiter. Presseöffentlich möchte sich das Landratsamt nicht äußern, solange das Gerichtsverfahren läuft.
Die Akte, die den Streit um Hilfen für Johannes Ulrich dokumentiert, umfasst inzwischen über 3500 Seiten – das ist das bürokratische Ergebnis eines Versuchs, einem Menschen mit Behinderung in Deutschland Teilhabe zu ermöglichen.
Folgt man Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte, steckt der Fehler auch im System. Der deutsche Staat gebe sehr viel Geld zum Beispiel für sogenannte besondere Wohnformen aus, sagt sie – gemeint sind Wohnheime. Das sei frustrierend, weil man das Geld auch für inklusive Strukturen verwenden könnte. Doch für die Auflösung der Sonderstrukturen gebe es noch keinen gesellschaftlichen Willen, beklagt Schlegel.
Stattdessen sind Menschen mit Behinderung oft davon abhängig, ob der Träger des Wohnheims genug Personal für ein bisschen Inklusion hat. Der Sozialrechtler Rosenow erinnert sich an die mündliche Verhandlung vor dem Sozialgericht im Fall Ulrich. Dort habe Ulrichs Anwältin Beschäftigte der Einrichtung befragt, berichtet er.
„Gehen Sie denn mal mit ihm spazieren?“ wollte die Anwältin demnach wissen. Die Antwort sei gewesen: „Ja, das kommt schon mal vor.“
Nachfrage: „Wie oft gehen Sie denn mit ihm raus?“ Antwort: „Kann ich nicht sagen.“
Nachfrage: „Waren Sie in diesem Jahr schon mal mit ihm draußen?“ Die Antwort laut Rosenow: „Nein, in diesem Jahr noch nicht.“
Nachfrage: „Waren Sie im letzten Jahr mit ihm draußen?“ Die Antwort laut Rosenow: „Nein, im letzten Jahr auch nicht.“
Onlinetext: ahe / Recherche und Feature-Text: Natalie Kreisz