Marx interpretiert Marx
Der Mann, der "Das Kapital" noch einmal geschrieben hat, ist kein bärtiger Revoluzzer, sondern der kämpferische Erzbischof von München und Freising. "Es gibt neue und gute Gründe, Karl Marx noch nicht ad acta zu legen", bekennt der streitbare Katholik. Seine Analyse: Nie triumphierte das Kapital schamloser als heute.
Der Scherz mit dem Titel des Buches zeigt, worum es geht. Auch die katholische Kirche hat ein durchaus diesseitiges Interesse. Sie will im moralischen Feldzug gegen die derzeitigen Übel in vorderster Front mitmarschieren und da kommt die Namensgleichheit zwischen Karl Marx, dem Autor des Kapitals, und Reinhard Marx, dem derzeitigen Erzbischof von München und Freising natürlich gelegen. In Zeiten wie diesen, in denen das medial vermittelte Moralunternehmertum sich gegen die Wirtschaft richtet, ist mit Titeln wie Das Kapital von Reinhard Marx natürlich gut Staat zu machen. Um ein moralunternehmerisches Traktat handelt es sich bei diesem Buch allemal. Da werden im ersten Kapitel, das als Brief des Autors an seinen Namensvetter Karl gestaltet ist, die bekannten Stellen aus den Werken von Karl Marx zitiert, Fragmente, wie man sie in der jüngsten Vergangenheit auch in der Financial Times immer wieder findet, um es danach umso kräftiger menscheln zu lassen. Aber wo Karl den analytischen Blick ansetzt, da keimt bei Reinhard die Hoffnung.
"Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern hat, wie Alexander Rüstow einmal treffend gesagt hat, ‚Dienerin der Menschlichkeit’ zu sein. Ich hoffe und glaube auch, dass das sehr viele andere Menschen genauso empfinden und denken. Aber auch denen, die diese moralische Überzeugung nicht teilen, rate ich, sich zu überlegen, ob sie nicht wenigstens aus Klugheitserwägungen eine Soziale Marktwirtschaft einem grenzenlosen Kapitalismus vorziehen wollen, denn ein ‚primitiver Kapitalismus’ richtet sich gegen die Menschen und wird deshalb niemals auf Dauer akzeptiert werden."
In acht Hauptkapiteln, nebst Einleitung und Schlusswort werden die bekannten Themen abgehandelt. Globalisierung, soziale Gerechtigkeit vor Ort und weltweit, soziale Verantwortung der Unternehmen, Armut und Reichtum, Ethik und Wirtschaft – alles kommt vor und wird mit den teils bekannten Beispielen belegt.
Frappierend an solchen Texten sind die Leerstellen. Seitenweise wird detailliert aufgelistet, was die internationalen Großunternehmen für Sünden begehen, wo sie moralisch versagt, die vorhandenen Spielräume rücksichtslos ausgenutzt haben und zu welch grausamen Folgen das für die Arbeiter führte. Diese langen Anläufe landen dann aber immer wieder im Nebulösen. Gefordert wird die Moral von Unternehmern und Politikern. Da heißt es dann
"Es ist eine herausragend wichtige Aufgabe der Politik, alles zu unterlassen und zu unterbinden, was auch nur den bösen Anschein erwecken könnte, dass Regierung und Parlament nicht nach den Belangen des Gemeinwohls, sondern nach den Profitinteressen bestimmter Wirtschaftsunternehmen entscheiden. Es ist wichtig, dass Manager eine hohe Moral haben und nicht nur auf das rechtlich geschuldete schauen. Und genauso wichtig ist, dass Politiker glaubwürdig und integer sind."
Da war nicht nur Marx, sondern schon Immanuel Kant weiter, der das Problem klarer formulierte in der Frage, wie es möglich sei, aus einem Volk von Teufeln ein gutes Staatswesen zu formen.
Man fragt sich bei der Lektüre dieses Buchs immer wieder, ob die Autoren denn wirklich Karl Marx gelesen oder einmal über die Zitate, die über den Text verstreut sind, nachgedacht haben. Es sind, wie man bei etwas näherer Beschäftigung mit dessen Werken schnell herausfinden wird, die Verhältnisse und nicht das Verhalten, auf die es ankommt. Und die sind ziemlich ehern und gesichert.
Wenn das Verhalten der Einzelnen, gar der zum aufmüpfigen Volk versammelten Einzelnen, einmal unbotmäßig sich gegen den scheinbar unveränderbaren Sachzwang oder die real existierenden Eigentumsverhältnisse wendet, dann kommt unter dem samtenen Handschuh der moralisierenden Schönwetterpolitik in prosperierenden Zeiten während der wirtschaftlichen Krise schnell die Eiserne Faust des staatlichen Gewaltmonopols zum Vorschein.
Vermutlich hatte Karl Marx schon recht wenn er meinte, der Kapitalismus würde aus sich heraus den Umsturz und damit den eigenen Untergang hervor treiben. Seine Vorstellungen von der Revolution mögen in ihrer historischen Ausformulierung heute antiquiert wirken, aber den Mechanismus dürfte er durchaus zutreffend beschrieben haben. Jedenfalls findet sich bekanntlich in seinen Schriften nirgendwo der Hinweis, dass moralische Läuterung der Kapitalisten, Appelle an die politische Klasse oder wohlmeinende Predigten aufgeklärter Kleriker die Dinge zum Besseren verändern würden. All das und damit wohl auch dieses Buch, fällt bei Marx unter den Begriff der Ideologie, die er bekanntlich als notwendig falsches Bewusstsein definiert hat.
Bleibt am Ende der für Reinhard Marx und seinen Koautoren und Verleger wenig erbauliche Rat, sich doch lieber mit dem Original auseinanderzusetzen. Über den Kapitalismus und seine derzeitigen sowie alle früheren Krisen lernt man dort mehr – und das gesteht auch Bischof Reinhard Marx in seinem Brief an den Namensvetter neidlos zu – so hellsichtig wie er war keiner weder davor noch danach, wenn es um die diesseitigen Verhältnisse geht. Das Reden über die Verhältnisse im Jenseits, im Reich, das nicht von dieser Welt ist, wollen wir aber auch weiterhin den kirchlichen Experten überlassen.
Reinhard Marx: Das Kapital - Ein Plädoyer für den Menschen
Pattloch Verlag, München 2008
"Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern hat, wie Alexander Rüstow einmal treffend gesagt hat, ‚Dienerin der Menschlichkeit’ zu sein. Ich hoffe und glaube auch, dass das sehr viele andere Menschen genauso empfinden und denken. Aber auch denen, die diese moralische Überzeugung nicht teilen, rate ich, sich zu überlegen, ob sie nicht wenigstens aus Klugheitserwägungen eine Soziale Marktwirtschaft einem grenzenlosen Kapitalismus vorziehen wollen, denn ein ‚primitiver Kapitalismus’ richtet sich gegen die Menschen und wird deshalb niemals auf Dauer akzeptiert werden."
In acht Hauptkapiteln, nebst Einleitung und Schlusswort werden die bekannten Themen abgehandelt. Globalisierung, soziale Gerechtigkeit vor Ort und weltweit, soziale Verantwortung der Unternehmen, Armut und Reichtum, Ethik und Wirtschaft – alles kommt vor und wird mit den teils bekannten Beispielen belegt.
Frappierend an solchen Texten sind die Leerstellen. Seitenweise wird detailliert aufgelistet, was die internationalen Großunternehmen für Sünden begehen, wo sie moralisch versagt, die vorhandenen Spielräume rücksichtslos ausgenutzt haben und zu welch grausamen Folgen das für die Arbeiter führte. Diese langen Anläufe landen dann aber immer wieder im Nebulösen. Gefordert wird die Moral von Unternehmern und Politikern. Da heißt es dann
"Es ist eine herausragend wichtige Aufgabe der Politik, alles zu unterlassen und zu unterbinden, was auch nur den bösen Anschein erwecken könnte, dass Regierung und Parlament nicht nach den Belangen des Gemeinwohls, sondern nach den Profitinteressen bestimmter Wirtschaftsunternehmen entscheiden. Es ist wichtig, dass Manager eine hohe Moral haben und nicht nur auf das rechtlich geschuldete schauen. Und genauso wichtig ist, dass Politiker glaubwürdig und integer sind."
Da war nicht nur Marx, sondern schon Immanuel Kant weiter, der das Problem klarer formulierte in der Frage, wie es möglich sei, aus einem Volk von Teufeln ein gutes Staatswesen zu formen.
Man fragt sich bei der Lektüre dieses Buchs immer wieder, ob die Autoren denn wirklich Karl Marx gelesen oder einmal über die Zitate, die über den Text verstreut sind, nachgedacht haben. Es sind, wie man bei etwas näherer Beschäftigung mit dessen Werken schnell herausfinden wird, die Verhältnisse und nicht das Verhalten, auf die es ankommt. Und die sind ziemlich ehern und gesichert.
Wenn das Verhalten der Einzelnen, gar der zum aufmüpfigen Volk versammelten Einzelnen, einmal unbotmäßig sich gegen den scheinbar unveränderbaren Sachzwang oder die real existierenden Eigentumsverhältnisse wendet, dann kommt unter dem samtenen Handschuh der moralisierenden Schönwetterpolitik in prosperierenden Zeiten während der wirtschaftlichen Krise schnell die Eiserne Faust des staatlichen Gewaltmonopols zum Vorschein.
Vermutlich hatte Karl Marx schon recht wenn er meinte, der Kapitalismus würde aus sich heraus den Umsturz und damit den eigenen Untergang hervor treiben. Seine Vorstellungen von der Revolution mögen in ihrer historischen Ausformulierung heute antiquiert wirken, aber den Mechanismus dürfte er durchaus zutreffend beschrieben haben. Jedenfalls findet sich bekanntlich in seinen Schriften nirgendwo der Hinweis, dass moralische Läuterung der Kapitalisten, Appelle an die politische Klasse oder wohlmeinende Predigten aufgeklärter Kleriker die Dinge zum Besseren verändern würden. All das und damit wohl auch dieses Buch, fällt bei Marx unter den Begriff der Ideologie, die er bekanntlich als notwendig falsches Bewusstsein definiert hat.
Bleibt am Ende der für Reinhard Marx und seinen Koautoren und Verleger wenig erbauliche Rat, sich doch lieber mit dem Original auseinanderzusetzen. Über den Kapitalismus und seine derzeitigen sowie alle früheren Krisen lernt man dort mehr – und das gesteht auch Bischof Reinhard Marx in seinem Brief an den Namensvetter neidlos zu – so hellsichtig wie er war keiner weder davor noch danach, wenn es um die diesseitigen Verhältnisse geht. Das Reden über die Verhältnisse im Jenseits, im Reich, das nicht von dieser Welt ist, wollen wir aber auch weiterhin den kirchlichen Experten überlassen.
Reinhard Marx: Das Kapital - Ein Plädoyer für den Menschen
Pattloch Verlag, München 2008
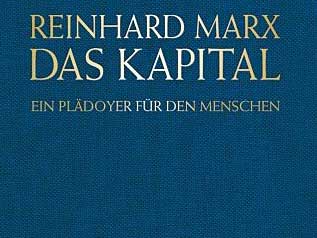
Reinhard Marx: "Das Kapital"© Pattloch Verlag
