Mariam Kühsel-Hussaini: Tschudi
Rowohlt, Hamburg 2020
320 Seiten, 24 Euro
Kampf um eine neue Epoche
04:57 Minuten
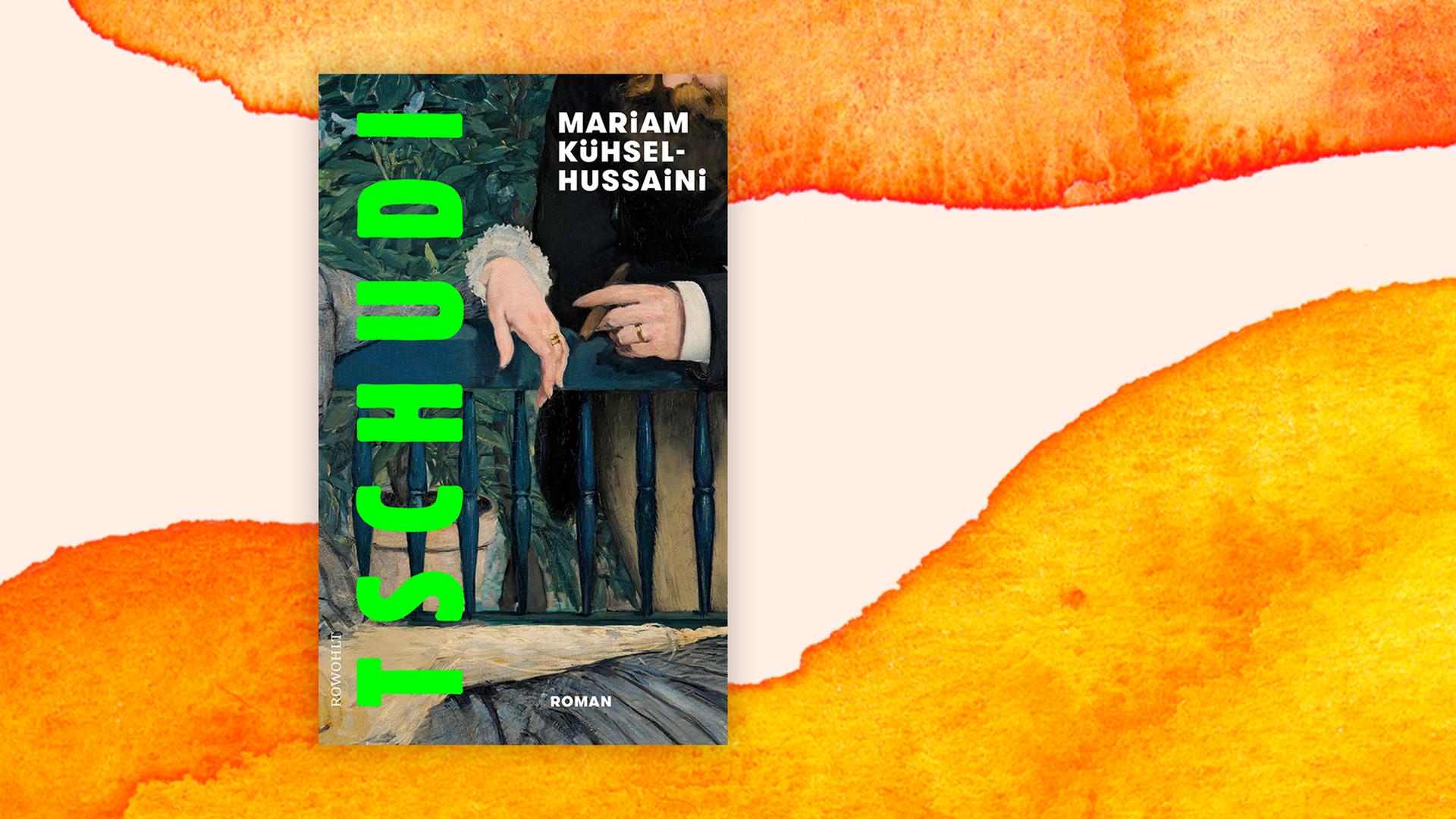
In "Tschudi" erzählt Mariam Kühsel-Hussaini vom Kampf um die Kunst an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Held des Romans ist der Berliner Museumsdirektor Hugo von Tschudi, der Werke der Moderne von Manet, Monet oder Renoir nach Berlin holte.
"Er war nicht nur ein großer Mann, sondern auch ein Großer Mann": Gut möglich, dass sich Mariam Kühsel-Hussaini für ihren neuen Roman an Wassily Kandinskys Charakterisierung Hugo Tschudis orientiert hat. Denn in ihrem gleichnamigen Roman erstrahlt der Schweizer Kunsthistoriker und Museumsmann als übernatürliche Lichtgestalt.
In ihrem vierten Roman unternimmt die 1987 in Kabul geborene Autorin den spannenden Versuch, eine kunsthistorische Revolution literarisch zu rekonstruieren: Wie nämlich Tschudi, als Chef der Berliner Nationalgalerie, dem aus Frankreich kommenden Impressionismus in Berlin gegen die Deutschnationalen den Weg in den Tempel bahnte, an dessen Giebel noch heute die Inschrift "Der Deutschen Kunst" prangt.
Faszinierendes Epochenbild
In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nimmt Kühsel-Hussaini mit ihrer poetisch-expressiven Sprache eine Sonderstellung ein. Damit gelingt ihr ein faszinierendes, gleichsam porentiefes Epochenbild. Die Lesenden erleben das kaiserliche Deutschland der Gründerzeit und die entscheidenden Stationen des Impressionisten-Streits in einer sinnesschweren, farbenprächtigen Nahaufnahme.
Sie begleiten Tschudi bei einem Frühlingsspaziergang auf Berlins Prachtboulevard Unter den Linden, gehen mit ihm zum Abendessen mit Max Liebermann ins luxuriöse Weinhaus Rheingold am Potsdamer Platz. Oder sie werden Zeugen des legendären Zusammentreffen Tschudis mit Kaiser Wilhelm 1899 in der Nationalgalerie, bei dem der Monarch anordnet, die "Franzosenwirtschaft müsse aufhören".
Ein Roman wie ein Gemälde
Kühsel-Hussaini entwickelt den Kampf um eine neue Epoche aus dem Kräfteparallelogramm dreier beschädigter Protagonisten: Wilhelm II. will mit markigen Gesten seinen verkrüppelten linken Arm und das Gefühl eigener Unfähigkeit überspielen, der berlinernde Adolph Menzel kompensiert seine Zwergen-Gestalt mit manischer Zeichensucht. Tschudi selbst verbirgt seine tödliche Hautkrankheit mit einer Maske.
Mit ihrem forcierten Lyrismus zeichnet Kühsel-Hussaini einen Roman wie ein Gemälde. Mal lädt sie es pathetisch auf. Etwa wenn sie Tschudi die Nationalgalerie bei einem Spaziergang wie einen "Eisberg" wahrnehmen lässt, "in dessen Hauptgeschoss ein verträumter Feuerstrom das Glühen aufnahm".
Dann tupft sie es in impressionistischem Staccato. "Im Prado alles riesig. Schweigende Bilder. Goya. Energisch wie Rembrandt. Zart wie Tizian. Goya. Ein Maler, der nicht überlegt. Tschudi schluckt." Das notiert ein unbekanntes, höheres Wesen bei Tschudis Besuch in Spanien, bei dem er seine Frau Angela kennenlernt.
Verkehrung ins Antimoderne
Ästhetisch ist das reizvoll. Mit dem schwelgerischen Pathos, das die Autorin dabei anschlägt, rehabilitiert sie freilich eine überholte Genieästhetik. Tschudi zeichnet sie als Mischung aus todgeweihtem Schmerzensmann und somnambulem Propheten. "Solche Wesen sind in Besitz anderer Kräfte", stimmt der Erzähler gleich zu Beginn auf einen Seher ein, der über den Dingen und den Menschen steht.
Kühsel-Hussaini schafft es, das Drama um die Durchsetzung der Moderne in Deutschland in dem Moment plastisch zu machen, wo mit dem Neubau am Potsdamer Platz eine neue Etappe für die Nationalgalerie beginnt. Ihre Ästhetik verkehrt diese Hommage jedoch ins Antimoderne - so wie bei ihr ein großer Mann Geschichte macht.


