Lesart spezial
Die Türkei, Europa und der Islam - ein nur schwieriges oder gar ein unmögliches Verhältnis? Deutschlandradio Kultur sprach darüber auf der Leipziger Buchmesse mit dem Träger des Buchpreises zur Europäischen Verständigung, Geert Mak aus Amsterdam, und dem Laudator Johannes Willms.
Florian Felix Weyh: Heute von der Leipziger Buchmesse. Sie hören es vermutlich im Hintergrund. Es ist ein Rauschen und ein Raunen, ein Gehen und ein Trappeln hier auf dem Messegelände in Leipzig. Und leider ist auch einer unserer beiden Studiogäste noch unterwegs zu uns ins Studio. Das soll uns aber nicht stören. Wir fangen mit der Sendung an. Es begrüßt Sie dazu Florian-Felix Weyh. Neben mir sitzt im gläsernen Studio der Laudator des Preisträgers des aktuellen Buchpreises zur Europäischen Verständigung, der Journalist und Historiker Johannes Willms. Und der zweite, auf den wir warten, ist natürlich der Preisträger Geert Mak aus Amsterdam.
Herr Willms, war das für Sie eine große Freude, Geert Mak bepreisen und beloben zu dürfen?
Johannes Willms: Das war es in der Tat, weil ich habe sehr viel von ihm gelesen, vor allem sein großes Buch "Das Jahrhundert meines Vaters". Das habe ich dann auch rezensiert. Ich fand das beeindruckend und genauso beeindruckend sein "Opus Magnum in Europa". Das war für mich insofern eine große Freude, als ich gefragt wurde, die Laudatio dazu zu machen. Ohne zu Zögern habe ich sofort Ja gesagt.
Weyh: Und das ist auch kein Wunder für Sie gewesen, dass Geert Mak diesen Preis endlich bekommen hat?
Willms: Nein, überhaupt nicht. Er hätte ihn längst verdient. Und ich glaube, man könnte ihn im nächsten Jahr gerade wieder mit dem Preis auszeichnen, denn ich kenne niemanden, der so wie er eine Lanze für Europa bricht und das so intelligent macht und vor allem in einem so angenehmen Parlando wie er. Selbst die schwierigsten Zusammenhänge vermag er zu vermitteln. Das zeigt eben, dass er auch ein guter Journalist ist.
Weyh: Geert Mak hat ein neues Buch in diesem Frühjahr, das in der Türkei spielt. Wir werden sicher gleich, wenn er kommt, darüber noch reden. Aber auch Sie, Herr Willms, haben ein neues Buch in diesem Frühjahr herausgebracht, ein Buch, das ebenfalls über Europa handelt, das sich mit Europa beschäftigt, allerdings mit dem Europa des 19. Jahrhunderts. Das ist die Biografie von Napoleon III. Nun haben wir alle mal in der Schule Geschichte gehabt und wissen, da gab's Napoleon. Aber wer zum Teufel war dann der zweite und wer war der dritte?
Willms: Der zweite war der Sohn von Napoleon I., der als Herzog von Reichstadt gewissermaßen in Gefangenschaft in Österreich sehr früh verstarb. Der ist nie zum Zuge gekommen und der wusste auch, dass er nie eine Chance haben würde. Und der dritte ist ein Neffe des bekannten, des großen Napoleon. Das war der Sohn eines Bruders von Napoleon Bonaparte und der Königin Hortense. Und die hat diesen Sohn ganz im Sinne des Erbes des Vaters aufgezogen, sodass der arme Junge wahrscheinlich gar keine andere Wahl hatte, als eben auch Kaiser von Frankreich zu werden.
Weyh: Wer hat denn diese Reihenfolge festgelegt? Normalerweise werden doch nur regierende Häupter mit Nummern versehen. Hat das Napoleon III. bei seiner Krönung selbst gesagt: "Ich bin der dritte" und dem zweiten die Referenz erwiesen?
Willms: Nein, der zweite wurde noch mal proklamiert. Kurz vor der Abdankung Napoleons wurde der Sohn von Napoleon, obwohl er gar nicht zum Zuge kommen konnte, zum Kaiser, zum Nachfolger proklamiert. Deshalb war er der Zählung nach Napoleon II., aber er kam eben - wie gesagt, das Kaiserreich Napoleons ging ja zugrunde - nicht zum Zuge. Deshalb wurde er als der zweite nach wie vor gerechnet und deshalb war der dritte der dritte, und er war der Chef des zweiten Kaiserreichs.
Weyh: Inzwischen, liebe Hörer, hat sich die Tür des gläsernen Studios einmal geöffnet und Geert Mak ist eingetroffen. Herzlich willkommen bei uns und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Haben Sie nach Ihrem Buch in Europa damit gerechnet, diesen Preis irgendwann zu bekommen?
Geert Mak: Nein, nein. Als ich dieses Projekt, denn es war wirklich ein verrücktes megalomanes Projekt, anfing, war ich schon froh, das in meiner Zeitung zu überleben. Ein ganzes Jahr kreuz und quer durch Europa reisen, durch den Kontinent und zugleich durch das 20. Jahrhundert, um jeden Tag ein kleines Stücklein auf die ersten paar Seiten von meiner Zeitung zu schreiben, das war schon total verrückt. Und danach ist daraus ein ganzes Buch geworden. Und das ist populär geworden. Ich habe niemals gedacht, dass ich hier bei Ihnen sitzen sollte.
Weyh: Sie sind überhaupt sehr, sehr populär in Holland, in den Niederlanden. 500.000-mal hat sich Ihr Buch über Ihren Vater verkauft. Bei einem so kleinen Sprachraum ist das doch ein gigantischer Erfolg.
Mak: Gut. Auch Europa, das ist natürlich interessant, Europa ist jetzt 400.000-mal verkauft. Das ist wunderschön für einen Autor, aber es sagt auch etwas über die Mentalität in den Niederlanden und - ich glaube - auch von anderen Teilen Europas. Niederland hat Nein gesagt gegen die Konstitution und jedermann dachte, die Holländer sind gegen Europa. Nein, nein. Ich glaube, man hat Probleme mit der Konstitution und vielleicht mit der Europäischen Union als Institut, aber man fühlt sich selbst auch als Europäer. Sogar die zuweilen provinzialistischen Holländer wollten etwas wissen von ihren Nachbarn, weil wir sind alle mehr und mehr Bürger Europas - ob wir wollen oder nicht.
Weyh: Jetzt versuche ich mal tollkühn die beiden Fäden zusammenzubringen. Es gibt tatsächlich auch einen inhaltlichen Bogen. Wir haben schon über sein Napoleon-Buch geredet, bevor Sie kamen. Sie haben ein neues Buch über eine Brücke in Istanbul, also, also sozusagen über die Nachbarn, die man am fernsten und am misstrauischsten betrachtet in Zentral-, also in Mitteleuropa. Diese Brücke hatte den Besuch Napoleons III., habe ich gelesen, im Jahr 1863 zur Eröffnung.
Willms: Der war dort, kurz, ja, hat das eröffnet, wie er überhaupt ja gern reiste und an Schauplätzen war. Ja, natürlich, aber er hatte mit der Türkei eigentlich politisch nicht so viel am Hut. Die Türkei war ja, wie Sie wissen, der "kranke Mann Europas" im 19. Jahrhundert, das Osmanische Reich. Aber das war ein Einflussbereich, den wollte er den Russen und den Österreichern überlassen. Damit sollten die sich möglichst beschäftigen.
Weyh: Diese Brücke, was ist das für eine Brücke, die Galatabrücke?
Mak: Ja, die Galatabrücke. Das ist die Brücke zwischen dem mehr modernen Teil Istanbuls, Pera, und dem alten traditionellen Teil Istanbuls. Das ist nicht die Brücke über den Bosporus. Das ist eine sehr moderne Brücke. Aber die Galatabrücke, die erste Galatabrücke, ich glaube, wir haben jetzt fünf oder sechs Generationen gehabt und die Brücke von Napoleon war eine ganz andere Brücke als die heutige, aber die Brücke war immer eine Stadt in der Stadt, voll mit Leuten, die Sachen verkauften und kleinen Cafés usw. Und man begegnete einander auch auf der Brücke, ein gewisser Boulevard Istanbuls. Und weil es zwischen dem alten traditionellen Teil und dem modernen Teil war, war es zugleich auch eine gewisse Konfrontation zwischen Kulturen. Es sind wirklich immer sehr interessante 430 Meter gewesen.
Weyh: Wie sind Sie über diese Brücke gestolpert?
Mak: Bei meiner Europareise kam ich nach Istanbul. Ich sah diese Brücke mit all den Fischern dort und all den Leuten. Und ich dachte gleich, das ist eine Geschichte in dieser Brücke. Dann habe ich auch gefunden, dass in Istanbul viele von diesen Stadtschriftstellern, die man dort hat, über die Brücke geschrieben haben. So ist das nicht nur mein Gedanke, sondern auch in Istanbul selbst. Auch diese Stadt in der Stadt hat eine wunderbare Geschichte gehabt.
Weyh: Man muss vielleicht dazu beschreiben, das ist nicht eine Brücke, wie wir sie uns vorstellen über die Donau oder den Rhein, sondern sie ist in zwei Etagen.
Mak: Die hat zwei Etagen. Seit 1912 hat die Brücke zwei Etagen. Es war erstens eine hölzerne Schiffbrücke und jetzt ist sie eine ziemlich große Verkehrsbrücke, aber noch immer mit vielen Cafeterias, Restaurants, immer mit Leuten, die fotografieren, versuchen, Bleistifte zu verkaufen usw., usw. Alles, was eine Stadt hat, hat die Brücke auch.
Weyh: Aber Sie beschreiben das ja nicht nur, weil es so pittoresk ist, sondern Sie entdecken da ja sehr viel einer türkischen Welt und dann auch wieder einer europäischen Welt. Sie beschreiben zum Beispiel, dass bestimmte Berufsgruppen an bestimmte Herkunftsorte und Ethnien gebunden sind.
Mak: Ja, überall bei Emigranten sieht man das, dass Emigranten von einem gewissen Teil Europas - das nennt man Emigrantenbrücken. Und das sieht man auch bei der eigenen Brücke. Zum Beispiel war ich in einem gewissen Städtchen in Anatolien. Und die Leute von dieser Stadt waren die Einzigen, die Fischbacken machen. Die Fischbäcker sind gewisse Leute. Die das verkaufen sind auch Leute von einem gewissen Städtchen. Das war alles verteilt.
Aber das Interessante war, dass auch diese Leute in Istanbul oft über die Bauern, die aus Anatolien kamen, auf gleiche Weise wie meine Bekanntschaften, Gösefelds, redeten. Ich entdeckte auch auf der Brücke, viele von diesen Problemen mit türkischen Emigranten, die man in gewissen Teilen Europas erlebt, haben vielleicht mehr mit der Distanz zu tun zwischen dem traditionellen Dorf und einer sehr postmodernen Stadt und nicht so viel mit Türkei und Europa. Die Leute, die von Istanbul selbst emigrieren, nach Amsterdam zum Beispiel, sind wie Italiener. Das hat vielleicht zum Teil vielleicht auch etwas mit dem Islam zu tun, aber viel mehr wieder mit dem Gegensatz zwischen dem Alten, Stadt und Land. Mein Gefühl ist, das wichtiger denn viele andere Gegensätze in der heutigen Welt.
Weyh: Sie hören Lesart Spezial von der Leipziger Buchmesse. Zu Gast im Studio ist Geert Mak, der gerade über die Brücke in Istanbul, über die Galatabrücke, über das Goldene Horn berichtet hat. Das ist auch sein neues Buch "Die Brücke von Istanbul", erschienen bei Pantheon. Wenn man das liest, das ist wunderbar beschrieben, was Sie da schreiben, Herr Mak, dann sieht man doch tatsächlich die Probleme, die zum Beispiel in Berlin mit den Kreuzberger Türken sind, schon in dieser modernen Istanbuler Stadt auch, also dieses Abspalten in verschiedene Ethnien, diese Familienzentrierung und - ein ganz wichtiges Thema - die Ehre. Das beschreiben Sie sehr genau.
Mak: Ja, die Ehre ist immer wichtig, weil arme Leute haben oft nichts anderes mehr als Ehre. Ehre ist die einzige Kostbarkeit, die man noch hat. Ehre ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, die man hat. Wenn man arm ist, das ist Tag für Tag Erniedrigung, speziell, wenn die Leute um einen herum reich sind. Wenn alle arm sind im gleichen Dorf, weit vom Fernsehen und allem, dann hat man das gleiche Gefühl. Aber jetzt, in der heutigen Zeit, und das macht auch die Globalisierung, lebt man sehr arm und zugleich sieht man im Fernsehen eine total andere, reiche Welt. Und man weiß, dies ist normal und wir sind nicht normal. Wie geht man um mit diesem permanenten Gefühl von Erniedrigung, ohne total verrückt zu werden, ohne abzugleiten in Kriminalität oder Terrorismus oder Radikalität? Das war auch ein Teil meines Ziels, wenn ich auf die Brücke lebte. Wie machen die Leute das? Und ich habe sehr viel Respekt vor ihnen bekommen.
Weyh: Nun ist der Unterschied zwischen Arm und Reich ja kein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert hat dieser Unterschied zu politischen Revolutionen geführt. Johannes Willms, unser zweiter Gast im Studio, wie war das im 19. Jahrhundert für die Leute, die da arm waren? Die haben doch auch gesehen, dass zum Beispiel Napoleon III. einen unglaublichen Pomp praktiziert hat.
Willms: Ja, das hat die Leute nicht interessiert, weil der Pomp gehörte natürlich mit zur Repräsentation, zur Funktion des Amtes. Was die Armut im 19. Jahrhundert verschärfte war der Umstand, dass sie sozusagen auf neue Art arm wurden. Wenn Sie ein armer Bauer waren, dann war das ein Schicksal, was Ihnen seit Generationen verhängt war. Aber im 19. Jahrhundert kam die Armut des Industrieproletariats, dass sie also 14 Stunden am Tag gearbeitet haben, aber trotzdem arm waren. Das ist etwas, was uns heute ja wieder einholt. Die Leute, die Hartz-IV-Empfänger sind oder die Minijobs haben, arbeiten den ganzen Tag, aber können von dem Geld nicht leben, das sie für ihre Arbeit bekommen, obwohl sie acht, zehn Stunden am Tag arbeiten. Das war das Problem der Armut im 19. Jahrhundert, dieses Erlebnis, dass ich zwar arbeite, sogar viel arbeite, aber davon nicht leben kann, während andere, eben die Fabrikherren, die von meiner Arbeit sich mästeten, die Reichen waren und diesen Reichtum ausstellten.
Weyh: Da tritt plötzlich eine völlig neue politische Figur in den Vordergrund im 19. Jahrhundert. Sie beginnt eigentlich mit Napoleon, in dem sie den Bonapartismus erfindet, nämlich die Figur, die gleichzeitig etwas Majestätisches hat, aber den Rückhalt in den Massen sucht. Das brauchte ja das 18. Jahrhundert nicht.
Willms: Das brauchte das 18.Jahrhundert nicht. Napoleon III. ist, wenn Sie so wollen, nicht der Erfinder, aber derjenige, der das allgemeine Wahlrecht, wir müssen sagen "Männerwahlrecht", denn die Mehrheit der Frauen kriegte ja erst nach dem Ersten Weltkrieg das Wahlrecht zugestanden, der also das allgemeine Wahlrecht eingeführt hat. Früher war die Ausübung des Wahlrechts ja an einen Steuerzensus gebunden, und er führte das allgemeine Wahlrecht ein. Das heißt, er sagte sich: "Ich stütze meine Herrschaft auf die Zustimmung der meisten." Das war natürlich sehr modern. Er hat erkannt, dass man mit dem allgemeinen Wahlrecht eine sehr konservative, um nicht zu sagen, eine diktatorische Politik machen muss, die ihn natürlich zwang, auf die Interessen der meisten auch Rücksicht zu nehmen. Also, er war paternalistisch ausgerichtet. Er sagte: "Schluss mit der Ausbeutung, ich muss auch den Arbeitern garantieren, dass es ihnen besser geht, beispielsweise."
Weyh: Wenn man das Buch liest, denkt man sich zunächst einmal bei dem Titel "Napoleon III.", das ist etwas in der Vergangenheit Angesiedeltes. Dann stößt man aber doch, obwohl Sie nun streng historisch schreiben und arbeiten, auf seltsame Parallelen zur Gegenwart. Ich lese mal zwei Sätze vor und lasse den Namen aber weg. Dann erschließt es sich ganz anders. Da schreiben Sie:
"Was sich ihm jetzt noch in den Weg stellte, war die schiere Existenz des Parlaments sowie der Umstand, dass die Amtszeit des Präsidenten im Mai 1852 endete. Dass er sich damit nicht abfände, war von nun an ein offenes Geheimnis. Die Frage war nur, wie und wann der Präsident versuchen würde, den von der Verfassung vorgeschriebenen Lauf der Dinge zu ändern."
Da gehen doch bei mir alle Alarmlichter an und ich sage: Putin.
Willms: Ja, genau. Das ist die Parallele dazu, dass Sie sagen, Putin will sich auch im Amt verewigen. Und jetzt macht er eben seinen früheren Ministerpräsidenten zum Präsidenten, um dann in vier oder fünf Jahren - nach der Verfassung möglich - wieder als Präsident zu kandidieren. Und selbstverständlich wird er die Wahl dann auch wieder gewinnen.
Weyh: Ist Napoleon III. sozusagen das Urbild der modernen autokratischen, diktatorischen, auf Masse basierenden Herrscher?
Willms: Das kann man so sagen, zumal im Falle Putin. Man hat früher immer mal versucht, Napoleon III. als einen Vorläufer von Hitler oder Mussolini zu sehen, aber dieses Argument oder diese Übereinstimmung trifft nicht zu, weil Napoleon III. hat sich nie, im Unterschied zu Hitler oder zu Mussolini, auf die Basis einer Partei gestützt. Die Bonapartisten waren zu Herrschaftszeiten Napoleons III. keine Partei. Er stützte sich nicht auf eine Partei, die seinen Willen dann im Land durchsetzte. Da war er immer noch auf die alten Eliten angewiesen, was ein Grund mit war für sein Scheitern. Er hatte keine Partei, die das, was er wollte, durchsetzte. Aber das macht ihn wieder ähnlich mit Putin, der ja in dem Sinne auch keine Partei hat, sondern das ist ein Sammelbecken, das ihn unterstützt. Im Grunde genommen geht es nur um ihn, um seine Person und seinen Durchsetzungswillen. Und das gelingt ihm. Putin ist, wenn Sie so wollen - Mutatis mutandi - eine Figur wie Napoleon III., ja.
Weyh: Napoleon IV.
Willms: Napoleon IV.
Weyh: Vielleicht noch eine kleine Bildungsfrage am Rande: Wie würden Sie diesen seltsamen Umstand, den man Bonapartismus nennt, definieren? Was ist das? Es ist keine Ideologie. Es ist eine Handlungsweise.
Willms: Es ist von allem etwas. Es hat auch eine Ideologie. Die Franzosen haben ja in der Revolution einen König geköpft. Das haben sie dann ganz schnell bereut. Seither sind sie immer wieder auf der Suche nach einem Ersatzkönig. Und der Bonapartismus bot ihnen das an: Ihr habt einen König, aber gleichzeitig eine Republik. Das ist der Bonapartismus. Ihr habt eine starke Figur, die sich für Euch sorgt, die paternalistisch ist und Eure Interessen wahrnimmt, aber gleichzeitig über allen Sonderinteressen steht.
Mak: Das ist immer noch interessant. Das sieht man, wenn ein großer Staatsbesuch des französischen Präsidenten in den Niederlanden ist. Wir sind ein Königreich. Wir haben eine Königin. Aber unsere Königin ist eine Königin in einer Republik. Man sieht, der französische Präsident ist ja der Präsident eines Königreichs. Das sieht man auch, wenn beide zusammen sind, dass der französische Präsident mit allen Fanfaren eines Königs… Unsere nette Königin ist sehr professionell, aber es ist mehr, wie sagt man das?
Weyh: Sie hat eine Aura.
Mak: Sie hat eine persönliche Aura, aber sie ist zugleich das Haupt eines modernen Staats und nicht die Sonnenkönigin. Für uns Niederländer ist es erstaunlich, wie der französische Präsident königlich ist und wie präsidentiell unsere Königin ist.
Weyh: Ja, aber das hat sich mit Sarkozy ja noch mal um eine Ebene verschoben.
Willms: Das hat sich noch mal gedreht. Der verkörpert, wenn Sie so wollen, wenn man bösartig wäre, nicht nur den König, sondern auch noch den Hofnarren.
Weyh: Dann haben wir ja in Europa tatsächlich eine sehr vielschichtige Form von Staaten, Regierungsformen und Mentalitäten. Das macht es ja nicht einfach. Geert Mak, wie soll ein Europa funktionieren, in dem es eine Republik gibt, die eigentlich einen Wahlkönig hat, auf der anderen Seite echte konstitutionelle Monarchien und dann noch die an die Tür pochende Türkei, die einem anderen Kulturkreis angehört.
Mak: Nicht nur, auch Italien denkt ganz anders über den Staat als zum Beispiel die Deutschland oder die Niederlande, Polen, die eine religiöse Haltung gegenüber dem Staat hat. Und jeder projektiert das auf die Europäische Union. Da ist wirklich eine Mischung von Einflüssen. Das wird Zeit brauchen. Wir können nicht sagen, oh, Europa ist deutsch. Jeder Staat entwickelt sich, indem man gute und schlechte Sachen durchlebt. Das ist eine Staatengemeinschaft, aber auch eine Arbeitsgemeinschaft, die sich selbst entwickelt, sodass man zusammen durch die Zeit geht. Jetzt fangen wir Europäer an, wirklich bewusst als europäische Bürger durch die Zeit zu gehen und nicht mehr nur Kriege miteinander zu führen. Das muss sich entwickeln. Ich kann jetzt nicht sagen: Was ist die europäische Identität? Die europäische Identität ist, dass wir sehr unterschiedliche Länder sind. Das ergibt viele Probleme, aber das hat der Geschichte auch immer viel Dynamik, viel Kraft gegeben. Jetzt werden wir uns mehr und mehr entwickeln. Zum Beispiel Frankreich im 19. Jahrhundert war auch nicht ein Land.
Weyh: Das klingt immer etwas pessimistisch, Herr Mak. Ich glaube, wir müssen doch eins feststellen: Wir haben in Europa doch schon einen ganz, ganz entscheidenden Schritt gemacht. Kein Land in Europa, kein Staatsmann, kein Politiker in Europa denkt heute mehr daran, einen Konflikt zu wagen, um etwas zu lösen. Das ist doch der entscheidende Schritt für mich, ich glaube, in Europa ist das jetzt allgemeine Meinung, dass Kriege zur Durchsetzung von Interessen kein Mittel sind. Das war die Erschütterung des Jugoslawienkonflikts, dem wir alle hilflos gegenüberstanden in Europa, weil wir natürlich meinten, so weit, wie wir sind, müssen sie überall sein. Irrtum, der Balkan ist doch etwas anderes als das restliche Europa. Aber ich glaube, wenn wir davon mal absehen, das ist doch der ganz große, entscheidende Schritt, dass Kriege auf absehbare Zeit in Europa, europäischer Staaten untereinander, völlig ausgeschlossen sind.
Mak: Ja, und das auch nicht nur, weil man pazifistisch oder realistisch ist. Das ist die Realität. Das ist jetzt die heutige Realität. Der andere Schritt ist, dass wir gelernt haben zu akzeptieren, dass man nicht nur staatliche Abkommen macht, sondern dass über die Staaten ein System und Institute entstehen, die die Sachen organisieren. Wir haben gelernt, dass die Nationalstaaten sehr gut waren, um Sachen zu organisieren, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, sogar im Anfang des 20. Jahrhunderts. Für das 21. Jahrhundert brauchen wir andere Methoden, brauchen wir wirklich supranationale Methoden. Europa ist ein unglaublich wichtiges Experiment.
Weyh: Da muss ich Ihnen eigene Worte entgegenhalten, Herr Mak. Sie haben in einem Interview einen sehr schönen Begriff geprägt. Sie sagten da: "Wir sind in Europa eine paradoxe Föderation. Denn das, was eine Föderation eigentlich ausmacht, gemeinsame Außenpolitik, Sicherheitspolitik, das haben wir nicht. Aber wir haben eine Binnenpolitik, die Gurken- und Bananenkrümmungen und -größen den Einzelstaaten auferlegt, was beispielsweise in Amerika niemals der Fall wäre."
Mak: Das habe ich auch gesehen als das größte Problem Europas, die europäischen Institutionen im Augenblick. Das muss sich auch ändern. Aber die Methode, um zum Beispiel die Klimaprobleme supranational zu regeln, ich glaube, wir sind daran mehr und mehr gewöhnt. Aber jetzt müssen wir auch den Schritt machen, um unsere Außenpolitik und auch speziell unsere Verteidigungspolitik mehr und mehr gemeinsam zu organisieren. Denn wir können nicht immer abhängig bleiben von den Vereinigten Staaten.
Willms: Das war auch schon ein zaghafter Fortschritt. Bis 1918 hießen die einschlägigen Ministerien "Kriegsministerium". Seither heißen sie nur noch "Verteidigungsministerium". Die Sprachregelung hat zwar nichts an der Sache geändert, wie wir wissen, aber seither ist es eben so.
Mak: Das ist ein gutes Vorbild.
Weyh: Aber wenn wir es mal zugespitzt betrachten, zehn Jahre, zwanzig Jahre ins Land gehen lassen, wird es nicht dann doch irgendwann wieder auf die Frage zulaufen: Von welcher Nationalität ist der Oberste in Europa, der dann das Amt hat? Und wie wird das Amt aussehen? Ist es ein präsidiales Amt, wie in Frankreich? Ist es ein eher föderales System?
Willms: Ich glaube, da machen wir uns Sorgen, das wird sich alles schon erledigen. Die Nationalstaaten pfeifen noch nicht auf dem letzten Loch, um es mal ganz populär auszudrücken. Wir sehen das ja gerade in Frankreich. Das ist der Versuch, das französische Nationalbewusstsein neu zu stärken unter der Präsidentschaft von Sarkozy, nicht unbedingt in Europa förderlich zu wirken, sondern Frankreich first. Aber ich glaube, das wird sich verlieren. Denn wie schon Geert Mak sagte, es gibt so viele Probleme, die können nicht mehr im nationalen Rahmen gelöst werden, sondern die müssen übernational gelöst werden, ob das jetzt Klimapolitik ist, ich würde auch sagen, Industriepolitik, Energiepolitik. Es ist ja so: Nicht nur wir hängen vom russischen Erdgas ab, sondern auch Europa hängt vom russischen Erdgas ab. Es ist ja nicht damit getan einerseits, dass wir überall Windkraftwerke hinstellen, die die Landschaft verschandeln, oder dass wir wieder Kernkraftwerke bauen. Das eine wie das andere scheint mir als Lösung für die Probleme, die wir haben, nicht sehr geeignet.
Aber noch absurder wird es, wenn ein Land auf Windkraft setzt und ein anderes Land auf Nuklearenergie. Denn die Franzosen konnten zwar, als das Unglück in Tschernobyl war, ihren Leuten klar machen, die Giftwolke hat genau am Rhein innegehalten und Frankreich wurde nicht verstrahlt. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Wenn da etwas passiert, sind alle anderen mit betroffen.
Mak: Ich glaube noch immer, der Nationalstaat ist noch ein guter Platz, um viele Sachen zu organisieren, vielleicht mehr als jetzt. Jetzt sind zu viele Sachen europäisch organisiert. Und andere Sachen sind zu wenig europäische organisiert. Das ist außer Balance. Zuweilen sagen Leute, Sie sind zu idealistisch und das ist alles Utopie. Ich sage, nein, unsere Realität ist international. Was Sie auch sagen, das ist die Realität. Es ist nur sehr realistisch, diese Sachen supranational zu organisieren. Es wird schwer sein und kompliziert, aber ich glaube nicht, dass wir oder unsere Enkelkinder auf andere Weise das 21. Jahrhundert gut überleben können. Wir müssen sehr gut zusammenarbeiten und mehr als das.
Weyh: Was sagt, Herr Mak, Ihr Realismus in Bezug auf den EU-Beitritt der Türkei? Sie gelten als jemand, der sagt, ja, das wird kommen und das muss kommen. Sehr interessant fand ich den Aspekt, dass Sie in einem Interview vor ein paar Monaten gesagt haben: Eigentlich hat die Integration des Orients ja mit Griechenland angefangen und nicht erst mit der Türkei.
Mak: Mit Griechenland, natürlich. Griechenland war ein Teil des Balkans. Natürlich ist ein großer Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland. Aber auf der anderen Seite ist ein Teil die Orthodoxie. Man kann sagen, das kleine Europa hat den gleichen Hintergrund, wenn man nur von Westeuropa redet, das nordische, protestantistische und das katholische. Italien und Spanien geht noch. Aber wir haben die großen kulturellen Grenzen Europas überschritten. Das ist nicht das Problem mit der Türkei und auch nicht, dass es ein islamistisches Land ist. Das Problem mit der Türkei ist, dass es wirklich ein sehr großes Land ist, wo ökonomisch noch viel geschehen muss, und dass auch in der Türkei die nationalistischen Gedanken sehr stark sind. Es wird mindestens noch eine neue Generation Politiker kommen müssen, die wirklich in der europäischen Gemeinschaft gut mitreden können. Das braucht Zeit. Aber es ist auch gut möglich, dass es plötzlich alles schneller geht, weil man innerhalb der arabischen Welt und auch innerhalb der Türkei die Leute sich entwickeln sieht - plötzlich, sehr schnell. Viele junge Leute sind jetzt sehr gut gebildet. All diese, diese ganze neue Generation muss noch auf den politischen Markt kommen. Das kann große Schnelligkeit und Veränderungen ergeben. Die werden nicht mehr auf die alten Fundamentalisten und alten Imams hören. Das wird ganz anders gehen. Darüber bin ich sicher.
Weyh: Eine optimistische Aussicht von Geert Mak zum Beitritt der Türkei zur EU. Wenn man es mal ganz zugespitzt sagen würde, Johannes Willms, ist es nicht so, dass auch Frankreich ein sehr, sehr starkes Nationalbewusstsein hat in der Bevölkerung, das weit über das hinausgeht, was andere Staaten in Europa haben?
Willms: Ja, natürlich, weil Frankreich sich immer noch eine Sache eingestehen muss: Frankreich lebt immer noch im Bewusstsein, eine Großmacht zu sein. Frankreich lebt immer noch in dem Bewusstsein, Siegermacht des Zweiten Weltkriegs zu sein. Das ist ganz entscheidend. Das ist natürlich eine Legende, ein Mythos, den De Gaulle damals in die Welt gesetzt hat und den es auch brauchte, um das Land zusammenzuhalten. Aber das ist natürlich heute ein Fluch, wenn Sie so wollen, überspitzt gesprochen, an dem Frankreich leidet.
Aber ich will noch etwas zum Beitritt der Türkei sagen. Ich möchte eine Voraussage wagen. Es wird noch mal der Zeitpunkt kommen, wo hier auf einmal alle Leute wollen, dass auch Abu Dhabi und Dubai und wie die Staaten alle heißen, die Öl haben und reich sind, in der EU drin sind. Das würde noch manchem irgendwann schmecken - ich sag’s Ihnen. Wir bauen jetzt schon den Louvre da hin. Dann wollen wir sie demnächst auch in der EU haben, weil die alle so viel schönes Geld haben.
Weyh: Das ist ein wunderbares Beinahe-Schusswort zu dieser Lesart Spezial aus Leipzig von der Leipziger Buchmesse. Ich überfalle Sie jetzt beide noch damit, dass sie einen Buchtitel jeweils mir und unseren Hörern sagen, welches Buch Sie besonders beeindruckt hat, was Sie zu lesen empfehlen. Sie dürfen nur eine Minute überlegen. Ich erwähnte noch mal für die Hörer, welche Titel wir hier besprochen haben. Das war zum einen der Titel "Die Brücke von Istanbul", erschienen bei Pantheon, von Geert Mak, und zum anderen die Biografie "Napoleon III.", erschienen bei C.H. Beck. So, Herr Willms, was empfehlen Sie unseren Hörern?
Willms: Ich würde sofort empfehlen, weil es eines meiner Lieblinge ist seit je: Stendhal "Die Kartause von Parma", und zwar natürlich in der neuen Übersetzung von Elisabeth Edl, im Hanser Verlag erschienen.
Mak: Ich kenne den deutschen Buchmarkt nicht so gut, aber ich empfehle eine Frau aus meinem eigenen Land, Margriet de Moor, und ich hoffe, dass es schon in Deutsch übersetzt ist: "Die Ertrunkene". Das ist ein wunderbares Buch über die Niederlande, über das Wasser. Und man liest es als einen Thriller. Es ist auch ein literarisches Buch, aber auch ein Thriller. Das kann ich sehr empfehlen.
Weyh: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie gehen ins Internet und werden bei Google das suchen und Sie werden es finden, was Geert Mak uns hier empfohlen hat.
Mak: Alles über die Niederlande.
Weyh: Das war Lesart Spezial, heute von der Leipziger Buchmesse. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Herr Willms, war das für Sie eine große Freude, Geert Mak bepreisen und beloben zu dürfen?
Johannes Willms: Das war es in der Tat, weil ich habe sehr viel von ihm gelesen, vor allem sein großes Buch "Das Jahrhundert meines Vaters". Das habe ich dann auch rezensiert. Ich fand das beeindruckend und genauso beeindruckend sein "Opus Magnum in Europa". Das war für mich insofern eine große Freude, als ich gefragt wurde, die Laudatio dazu zu machen. Ohne zu Zögern habe ich sofort Ja gesagt.
Weyh: Und das ist auch kein Wunder für Sie gewesen, dass Geert Mak diesen Preis endlich bekommen hat?
Willms: Nein, überhaupt nicht. Er hätte ihn längst verdient. Und ich glaube, man könnte ihn im nächsten Jahr gerade wieder mit dem Preis auszeichnen, denn ich kenne niemanden, der so wie er eine Lanze für Europa bricht und das so intelligent macht und vor allem in einem so angenehmen Parlando wie er. Selbst die schwierigsten Zusammenhänge vermag er zu vermitteln. Das zeigt eben, dass er auch ein guter Journalist ist.
Weyh: Geert Mak hat ein neues Buch in diesem Frühjahr, das in der Türkei spielt. Wir werden sicher gleich, wenn er kommt, darüber noch reden. Aber auch Sie, Herr Willms, haben ein neues Buch in diesem Frühjahr herausgebracht, ein Buch, das ebenfalls über Europa handelt, das sich mit Europa beschäftigt, allerdings mit dem Europa des 19. Jahrhunderts. Das ist die Biografie von Napoleon III. Nun haben wir alle mal in der Schule Geschichte gehabt und wissen, da gab's Napoleon. Aber wer zum Teufel war dann der zweite und wer war der dritte?
Willms: Der zweite war der Sohn von Napoleon I., der als Herzog von Reichstadt gewissermaßen in Gefangenschaft in Österreich sehr früh verstarb. Der ist nie zum Zuge gekommen und der wusste auch, dass er nie eine Chance haben würde. Und der dritte ist ein Neffe des bekannten, des großen Napoleon. Das war der Sohn eines Bruders von Napoleon Bonaparte und der Königin Hortense. Und die hat diesen Sohn ganz im Sinne des Erbes des Vaters aufgezogen, sodass der arme Junge wahrscheinlich gar keine andere Wahl hatte, als eben auch Kaiser von Frankreich zu werden.
Weyh: Wer hat denn diese Reihenfolge festgelegt? Normalerweise werden doch nur regierende Häupter mit Nummern versehen. Hat das Napoleon III. bei seiner Krönung selbst gesagt: "Ich bin der dritte" und dem zweiten die Referenz erwiesen?
Willms: Nein, der zweite wurde noch mal proklamiert. Kurz vor der Abdankung Napoleons wurde der Sohn von Napoleon, obwohl er gar nicht zum Zuge kommen konnte, zum Kaiser, zum Nachfolger proklamiert. Deshalb war er der Zählung nach Napoleon II., aber er kam eben - wie gesagt, das Kaiserreich Napoleons ging ja zugrunde - nicht zum Zuge. Deshalb wurde er als der zweite nach wie vor gerechnet und deshalb war der dritte der dritte, und er war der Chef des zweiten Kaiserreichs.
Weyh: Inzwischen, liebe Hörer, hat sich die Tür des gläsernen Studios einmal geöffnet und Geert Mak ist eingetroffen. Herzlich willkommen bei uns und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Haben Sie nach Ihrem Buch in Europa damit gerechnet, diesen Preis irgendwann zu bekommen?
Geert Mak: Nein, nein. Als ich dieses Projekt, denn es war wirklich ein verrücktes megalomanes Projekt, anfing, war ich schon froh, das in meiner Zeitung zu überleben. Ein ganzes Jahr kreuz und quer durch Europa reisen, durch den Kontinent und zugleich durch das 20. Jahrhundert, um jeden Tag ein kleines Stücklein auf die ersten paar Seiten von meiner Zeitung zu schreiben, das war schon total verrückt. Und danach ist daraus ein ganzes Buch geworden. Und das ist populär geworden. Ich habe niemals gedacht, dass ich hier bei Ihnen sitzen sollte.
Weyh: Sie sind überhaupt sehr, sehr populär in Holland, in den Niederlanden. 500.000-mal hat sich Ihr Buch über Ihren Vater verkauft. Bei einem so kleinen Sprachraum ist das doch ein gigantischer Erfolg.
Mak: Gut. Auch Europa, das ist natürlich interessant, Europa ist jetzt 400.000-mal verkauft. Das ist wunderschön für einen Autor, aber es sagt auch etwas über die Mentalität in den Niederlanden und - ich glaube - auch von anderen Teilen Europas. Niederland hat Nein gesagt gegen die Konstitution und jedermann dachte, die Holländer sind gegen Europa. Nein, nein. Ich glaube, man hat Probleme mit der Konstitution und vielleicht mit der Europäischen Union als Institut, aber man fühlt sich selbst auch als Europäer. Sogar die zuweilen provinzialistischen Holländer wollten etwas wissen von ihren Nachbarn, weil wir sind alle mehr und mehr Bürger Europas - ob wir wollen oder nicht.
Weyh: Jetzt versuche ich mal tollkühn die beiden Fäden zusammenzubringen. Es gibt tatsächlich auch einen inhaltlichen Bogen. Wir haben schon über sein Napoleon-Buch geredet, bevor Sie kamen. Sie haben ein neues Buch über eine Brücke in Istanbul, also, also sozusagen über die Nachbarn, die man am fernsten und am misstrauischsten betrachtet in Zentral-, also in Mitteleuropa. Diese Brücke hatte den Besuch Napoleons III., habe ich gelesen, im Jahr 1863 zur Eröffnung.
Willms: Der war dort, kurz, ja, hat das eröffnet, wie er überhaupt ja gern reiste und an Schauplätzen war. Ja, natürlich, aber er hatte mit der Türkei eigentlich politisch nicht so viel am Hut. Die Türkei war ja, wie Sie wissen, der "kranke Mann Europas" im 19. Jahrhundert, das Osmanische Reich. Aber das war ein Einflussbereich, den wollte er den Russen und den Österreichern überlassen. Damit sollten die sich möglichst beschäftigen.
Weyh: Diese Brücke, was ist das für eine Brücke, die Galatabrücke?
Mak: Ja, die Galatabrücke. Das ist die Brücke zwischen dem mehr modernen Teil Istanbuls, Pera, und dem alten traditionellen Teil Istanbuls. Das ist nicht die Brücke über den Bosporus. Das ist eine sehr moderne Brücke. Aber die Galatabrücke, die erste Galatabrücke, ich glaube, wir haben jetzt fünf oder sechs Generationen gehabt und die Brücke von Napoleon war eine ganz andere Brücke als die heutige, aber die Brücke war immer eine Stadt in der Stadt, voll mit Leuten, die Sachen verkauften und kleinen Cafés usw. Und man begegnete einander auch auf der Brücke, ein gewisser Boulevard Istanbuls. Und weil es zwischen dem alten traditionellen Teil und dem modernen Teil war, war es zugleich auch eine gewisse Konfrontation zwischen Kulturen. Es sind wirklich immer sehr interessante 430 Meter gewesen.
Weyh: Wie sind Sie über diese Brücke gestolpert?
Mak: Bei meiner Europareise kam ich nach Istanbul. Ich sah diese Brücke mit all den Fischern dort und all den Leuten. Und ich dachte gleich, das ist eine Geschichte in dieser Brücke. Dann habe ich auch gefunden, dass in Istanbul viele von diesen Stadtschriftstellern, die man dort hat, über die Brücke geschrieben haben. So ist das nicht nur mein Gedanke, sondern auch in Istanbul selbst. Auch diese Stadt in der Stadt hat eine wunderbare Geschichte gehabt.
Weyh: Man muss vielleicht dazu beschreiben, das ist nicht eine Brücke, wie wir sie uns vorstellen über die Donau oder den Rhein, sondern sie ist in zwei Etagen.
Mak: Die hat zwei Etagen. Seit 1912 hat die Brücke zwei Etagen. Es war erstens eine hölzerne Schiffbrücke und jetzt ist sie eine ziemlich große Verkehrsbrücke, aber noch immer mit vielen Cafeterias, Restaurants, immer mit Leuten, die fotografieren, versuchen, Bleistifte zu verkaufen usw., usw. Alles, was eine Stadt hat, hat die Brücke auch.
Weyh: Aber Sie beschreiben das ja nicht nur, weil es so pittoresk ist, sondern Sie entdecken da ja sehr viel einer türkischen Welt und dann auch wieder einer europäischen Welt. Sie beschreiben zum Beispiel, dass bestimmte Berufsgruppen an bestimmte Herkunftsorte und Ethnien gebunden sind.
Mak: Ja, überall bei Emigranten sieht man das, dass Emigranten von einem gewissen Teil Europas - das nennt man Emigrantenbrücken. Und das sieht man auch bei der eigenen Brücke. Zum Beispiel war ich in einem gewissen Städtchen in Anatolien. Und die Leute von dieser Stadt waren die Einzigen, die Fischbacken machen. Die Fischbäcker sind gewisse Leute. Die das verkaufen sind auch Leute von einem gewissen Städtchen. Das war alles verteilt.
Aber das Interessante war, dass auch diese Leute in Istanbul oft über die Bauern, die aus Anatolien kamen, auf gleiche Weise wie meine Bekanntschaften, Gösefelds, redeten. Ich entdeckte auch auf der Brücke, viele von diesen Problemen mit türkischen Emigranten, die man in gewissen Teilen Europas erlebt, haben vielleicht mehr mit der Distanz zu tun zwischen dem traditionellen Dorf und einer sehr postmodernen Stadt und nicht so viel mit Türkei und Europa. Die Leute, die von Istanbul selbst emigrieren, nach Amsterdam zum Beispiel, sind wie Italiener. Das hat vielleicht zum Teil vielleicht auch etwas mit dem Islam zu tun, aber viel mehr wieder mit dem Gegensatz zwischen dem Alten, Stadt und Land. Mein Gefühl ist, das wichtiger denn viele andere Gegensätze in der heutigen Welt.
Weyh: Sie hören Lesart Spezial von der Leipziger Buchmesse. Zu Gast im Studio ist Geert Mak, der gerade über die Brücke in Istanbul, über die Galatabrücke, über das Goldene Horn berichtet hat. Das ist auch sein neues Buch "Die Brücke von Istanbul", erschienen bei Pantheon. Wenn man das liest, das ist wunderbar beschrieben, was Sie da schreiben, Herr Mak, dann sieht man doch tatsächlich die Probleme, die zum Beispiel in Berlin mit den Kreuzberger Türken sind, schon in dieser modernen Istanbuler Stadt auch, also dieses Abspalten in verschiedene Ethnien, diese Familienzentrierung und - ein ganz wichtiges Thema - die Ehre. Das beschreiben Sie sehr genau.
Mak: Ja, die Ehre ist immer wichtig, weil arme Leute haben oft nichts anderes mehr als Ehre. Ehre ist die einzige Kostbarkeit, die man noch hat. Ehre ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, die man hat. Wenn man arm ist, das ist Tag für Tag Erniedrigung, speziell, wenn die Leute um einen herum reich sind. Wenn alle arm sind im gleichen Dorf, weit vom Fernsehen und allem, dann hat man das gleiche Gefühl. Aber jetzt, in der heutigen Zeit, und das macht auch die Globalisierung, lebt man sehr arm und zugleich sieht man im Fernsehen eine total andere, reiche Welt. Und man weiß, dies ist normal und wir sind nicht normal. Wie geht man um mit diesem permanenten Gefühl von Erniedrigung, ohne total verrückt zu werden, ohne abzugleiten in Kriminalität oder Terrorismus oder Radikalität? Das war auch ein Teil meines Ziels, wenn ich auf die Brücke lebte. Wie machen die Leute das? Und ich habe sehr viel Respekt vor ihnen bekommen.
Weyh: Nun ist der Unterschied zwischen Arm und Reich ja kein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert hat dieser Unterschied zu politischen Revolutionen geführt. Johannes Willms, unser zweiter Gast im Studio, wie war das im 19. Jahrhundert für die Leute, die da arm waren? Die haben doch auch gesehen, dass zum Beispiel Napoleon III. einen unglaublichen Pomp praktiziert hat.
Willms: Ja, das hat die Leute nicht interessiert, weil der Pomp gehörte natürlich mit zur Repräsentation, zur Funktion des Amtes. Was die Armut im 19. Jahrhundert verschärfte war der Umstand, dass sie sozusagen auf neue Art arm wurden. Wenn Sie ein armer Bauer waren, dann war das ein Schicksal, was Ihnen seit Generationen verhängt war. Aber im 19. Jahrhundert kam die Armut des Industrieproletariats, dass sie also 14 Stunden am Tag gearbeitet haben, aber trotzdem arm waren. Das ist etwas, was uns heute ja wieder einholt. Die Leute, die Hartz-IV-Empfänger sind oder die Minijobs haben, arbeiten den ganzen Tag, aber können von dem Geld nicht leben, das sie für ihre Arbeit bekommen, obwohl sie acht, zehn Stunden am Tag arbeiten. Das war das Problem der Armut im 19. Jahrhundert, dieses Erlebnis, dass ich zwar arbeite, sogar viel arbeite, aber davon nicht leben kann, während andere, eben die Fabrikherren, die von meiner Arbeit sich mästeten, die Reichen waren und diesen Reichtum ausstellten.
Weyh: Da tritt plötzlich eine völlig neue politische Figur in den Vordergrund im 19. Jahrhundert. Sie beginnt eigentlich mit Napoleon, in dem sie den Bonapartismus erfindet, nämlich die Figur, die gleichzeitig etwas Majestätisches hat, aber den Rückhalt in den Massen sucht. Das brauchte ja das 18. Jahrhundert nicht.
Willms: Das brauchte das 18.Jahrhundert nicht. Napoleon III. ist, wenn Sie so wollen, nicht der Erfinder, aber derjenige, der das allgemeine Wahlrecht, wir müssen sagen "Männerwahlrecht", denn die Mehrheit der Frauen kriegte ja erst nach dem Ersten Weltkrieg das Wahlrecht zugestanden, der also das allgemeine Wahlrecht eingeführt hat. Früher war die Ausübung des Wahlrechts ja an einen Steuerzensus gebunden, und er führte das allgemeine Wahlrecht ein. Das heißt, er sagte sich: "Ich stütze meine Herrschaft auf die Zustimmung der meisten." Das war natürlich sehr modern. Er hat erkannt, dass man mit dem allgemeinen Wahlrecht eine sehr konservative, um nicht zu sagen, eine diktatorische Politik machen muss, die ihn natürlich zwang, auf die Interessen der meisten auch Rücksicht zu nehmen. Also, er war paternalistisch ausgerichtet. Er sagte: "Schluss mit der Ausbeutung, ich muss auch den Arbeitern garantieren, dass es ihnen besser geht, beispielsweise."
Weyh: Wenn man das Buch liest, denkt man sich zunächst einmal bei dem Titel "Napoleon III.", das ist etwas in der Vergangenheit Angesiedeltes. Dann stößt man aber doch, obwohl Sie nun streng historisch schreiben und arbeiten, auf seltsame Parallelen zur Gegenwart. Ich lese mal zwei Sätze vor und lasse den Namen aber weg. Dann erschließt es sich ganz anders. Da schreiben Sie:
"Was sich ihm jetzt noch in den Weg stellte, war die schiere Existenz des Parlaments sowie der Umstand, dass die Amtszeit des Präsidenten im Mai 1852 endete. Dass er sich damit nicht abfände, war von nun an ein offenes Geheimnis. Die Frage war nur, wie und wann der Präsident versuchen würde, den von der Verfassung vorgeschriebenen Lauf der Dinge zu ändern."
Da gehen doch bei mir alle Alarmlichter an und ich sage: Putin.
Willms: Ja, genau. Das ist die Parallele dazu, dass Sie sagen, Putin will sich auch im Amt verewigen. Und jetzt macht er eben seinen früheren Ministerpräsidenten zum Präsidenten, um dann in vier oder fünf Jahren - nach der Verfassung möglich - wieder als Präsident zu kandidieren. Und selbstverständlich wird er die Wahl dann auch wieder gewinnen.
Weyh: Ist Napoleon III. sozusagen das Urbild der modernen autokratischen, diktatorischen, auf Masse basierenden Herrscher?
Willms: Das kann man so sagen, zumal im Falle Putin. Man hat früher immer mal versucht, Napoleon III. als einen Vorläufer von Hitler oder Mussolini zu sehen, aber dieses Argument oder diese Übereinstimmung trifft nicht zu, weil Napoleon III. hat sich nie, im Unterschied zu Hitler oder zu Mussolini, auf die Basis einer Partei gestützt. Die Bonapartisten waren zu Herrschaftszeiten Napoleons III. keine Partei. Er stützte sich nicht auf eine Partei, die seinen Willen dann im Land durchsetzte. Da war er immer noch auf die alten Eliten angewiesen, was ein Grund mit war für sein Scheitern. Er hatte keine Partei, die das, was er wollte, durchsetzte. Aber das macht ihn wieder ähnlich mit Putin, der ja in dem Sinne auch keine Partei hat, sondern das ist ein Sammelbecken, das ihn unterstützt. Im Grunde genommen geht es nur um ihn, um seine Person und seinen Durchsetzungswillen. Und das gelingt ihm. Putin ist, wenn Sie so wollen - Mutatis mutandi - eine Figur wie Napoleon III., ja.
Weyh: Napoleon IV.
Willms: Napoleon IV.
Weyh: Vielleicht noch eine kleine Bildungsfrage am Rande: Wie würden Sie diesen seltsamen Umstand, den man Bonapartismus nennt, definieren? Was ist das? Es ist keine Ideologie. Es ist eine Handlungsweise.
Willms: Es ist von allem etwas. Es hat auch eine Ideologie. Die Franzosen haben ja in der Revolution einen König geköpft. Das haben sie dann ganz schnell bereut. Seither sind sie immer wieder auf der Suche nach einem Ersatzkönig. Und der Bonapartismus bot ihnen das an: Ihr habt einen König, aber gleichzeitig eine Republik. Das ist der Bonapartismus. Ihr habt eine starke Figur, die sich für Euch sorgt, die paternalistisch ist und Eure Interessen wahrnimmt, aber gleichzeitig über allen Sonderinteressen steht.
Mak: Das ist immer noch interessant. Das sieht man, wenn ein großer Staatsbesuch des französischen Präsidenten in den Niederlanden ist. Wir sind ein Königreich. Wir haben eine Königin. Aber unsere Königin ist eine Königin in einer Republik. Man sieht, der französische Präsident ist ja der Präsident eines Königreichs. Das sieht man auch, wenn beide zusammen sind, dass der französische Präsident mit allen Fanfaren eines Königs… Unsere nette Königin ist sehr professionell, aber es ist mehr, wie sagt man das?
Weyh: Sie hat eine Aura.
Mak: Sie hat eine persönliche Aura, aber sie ist zugleich das Haupt eines modernen Staats und nicht die Sonnenkönigin. Für uns Niederländer ist es erstaunlich, wie der französische Präsident königlich ist und wie präsidentiell unsere Königin ist.
Weyh: Ja, aber das hat sich mit Sarkozy ja noch mal um eine Ebene verschoben.
Willms: Das hat sich noch mal gedreht. Der verkörpert, wenn Sie so wollen, wenn man bösartig wäre, nicht nur den König, sondern auch noch den Hofnarren.
Weyh: Dann haben wir ja in Europa tatsächlich eine sehr vielschichtige Form von Staaten, Regierungsformen und Mentalitäten. Das macht es ja nicht einfach. Geert Mak, wie soll ein Europa funktionieren, in dem es eine Republik gibt, die eigentlich einen Wahlkönig hat, auf der anderen Seite echte konstitutionelle Monarchien und dann noch die an die Tür pochende Türkei, die einem anderen Kulturkreis angehört.
Mak: Nicht nur, auch Italien denkt ganz anders über den Staat als zum Beispiel die Deutschland oder die Niederlande, Polen, die eine religiöse Haltung gegenüber dem Staat hat. Und jeder projektiert das auf die Europäische Union. Da ist wirklich eine Mischung von Einflüssen. Das wird Zeit brauchen. Wir können nicht sagen, oh, Europa ist deutsch. Jeder Staat entwickelt sich, indem man gute und schlechte Sachen durchlebt. Das ist eine Staatengemeinschaft, aber auch eine Arbeitsgemeinschaft, die sich selbst entwickelt, sodass man zusammen durch die Zeit geht. Jetzt fangen wir Europäer an, wirklich bewusst als europäische Bürger durch die Zeit zu gehen und nicht mehr nur Kriege miteinander zu führen. Das muss sich entwickeln. Ich kann jetzt nicht sagen: Was ist die europäische Identität? Die europäische Identität ist, dass wir sehr unterschiedliche Länder sind. Das ergibt viele Probleme, aber das hat der Geschichte auch immer viel Dynamik, viel Kraft gegeben. Jetzt werden wir uns mehr und mehr entwickeln. Zum Beispiel Frankreich im 19. Jahrhundert war auch nicht ein Land.
Weyh: Das klingt immer etwas pessimistisch, Herr Mak. Ich glaube, wir müssen doch eins feststellen: Wir haben in Europa doch schon einen ganz, ganz entscheidenden Schritt gemacht. Kein Land in Europa, kein Staatsmann, kein Politiker in Europa denkt heute mehr daran, einen Konflikt zu wagen, um etwas zu lösen. Das ist doch der entscheidende Schritt für mich, ich glaube, in Europa ist das jetzt allgemeine Meinung, dass Kriege zur Durchsetzung von Interessen kein Mittel sind. Das war die Erschütterung des Jugoslawienkonflikts, dem wir alle hilflos gegenüberstanden in Europa, weil wir natürlich meinten, so weit, wie wir sind, müssen sie überall sein. Irrtum, der Balkan ist doch etwas anderes als das restliche Europa. Aber ich glaube, wenn wir davon mal absehen, das ist doch der ganz große, entscheidende Schritt, dass Kriege auf absehbare Zeit in Europa, europäischer Staaten untereinander, völlig ausgeschlossen sind.
Mak: Ja, und das auch nicht nur, weil man pazifistisch oder realistisch ist. Das ist die Realität. Das ist jetzt die heutige Realität. Der andere Schritt ist, dass wir gelernt haben zu akzeptieren, dass man nicht nur staatliche Abkommen macht, sondern dass über die Staaten ein System und Institute entstehen, die die Sachen organisieren. Wir haben gelernt, dass die Nationalstaaten sehr gut waren, um Sachen zu organisieren, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, sogar im Anfang des 20. Jahrhunderts. Für das 21. Jahrhundert brauchen wir andere Methoden, brauchen wir wirklich supranationale Methoden. Europa ist ein unglaublich wichtiges Experiment.
Weyh: Da muss ich Ihnen eigene Worte entgegenhalten, Herr Mak. Sie haben in einem Interview einen sehr schönen Begriff geprägt. Sie sagten da: "Wir sind in Europa eine paradoxe Föderation. Denn das, was eine Föderation eigentlich ausmacht, gemeinsame Außenpolitik, Sicherheitspolitik, das haben wir nicht. Aber wir haben eine Binnenpolitik, die Gurken- und Bananenkrümmungen und -größen den Einzelstaaten auferlegt, was beispielsweise in Amerika niemals der Fall wäre."
Mak: Das habe ich auch gesehen als das größte Problem Europas, die europäischen Institutionen im Augenblick. Das muss sich auch ändern. Aber die Methode, um zum Beispiel die Klimaprobleme supranational zu regeln, ich glaube, wir sind daran mehr und mehr gewöhnt. Aber jetzt müssen wir auch den Schritt machen, um unsere Außenpolitik und auch speziell unsere Verteidigungspolitik mehr und mehr gemeinsam zu organisieren. Denn wir können nicht immer abhängig bleiben von den Vereinigten Staaten.
Willms: Das war auch schon ein zaghafter Fortschritt. Bis 1918 hießen die einschlägigen Ministerien "Kriegsministerium". Seither heißen sie nur noch "Verteidigungsministerium". Die Sprachregelung hat zwar nichts an der Sache geändert, wie wir wissen, aber seither ist es eben so.
Mak: Das ist ein gutes Vorbild.
Weyh: Aber wenn wir es mal zugespitzt betrachten, zehn Jahre, zwanzig Jahre ins Land gehen lassen, wird es nicht dann doch irgendwann wieder auf die Frage zulaufen: Von welcher Nationalität ist der Oberste in Europa, der dann das Amt hat? Und wie wird das Amt aussehen? Ist es ein präsidiales Amt, wie in Frankreich? Ist es ein eher föderales System?
Willms: Ich glaube, da machen wir uns Sorgen, das wird sich alles schon erledigen. Die Nationalstaaten pfeifen noch nicht auf dem letzten Loch, um es mal ganz populär auszudrücken. Wir sehen das ja gerade in Frankreich. Das ist der Versuch, das französische Nationalbewusstsein neu zu stärken unter der Präsidentschaft von Sarkozy, nicht unbedingt in Europa förderlich zu wirken, sondern Frankreich first. Aber ich glaube, das wird sich verlieren. Denn wie schon Geert Mak sagte, es gibt so viele Probleme, die können nicht mehr im nationalen Rahmen gelöst werden, sondern die müssen übernational gelöst werden, ob das jetzt Klimapolitik ist, ich würde auch sagen, Industriepolitik, Energiepolitik. Es ist ja so: Nicht nur wir hängen vom russischen Erdgas ab, sondern auch Europa hängt vom russischen Erdgas ab. Es ist ja nicht damit getan einerseits, dass wir überall Windkraftwerke hinstellen, die die Landschaft verschandeln, oder dass wir wieder Kernkraftwerke bauen. Das eine wie das andere scheint mir als Lösung für die Probleme, die wir haben, nicht sehr geeignet.
Aber noch absurder wird es, wenn ein Land auf Windkraft setzt und ein anderes Land auf Nuklearenergie. Denn die Franzosen konnten zwar, als das Unglück in Tschernobyl war, ihren Leuten klar machen, die Giftwolke hat genau am Rhein innegehalten und Frankreich wurde nicht verstrahlt. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Wenn da etwas passiert, sind alle anderen mit betroffen.
Mak: Ich glaube noch immer, der Nationalstaat ist noch ein guter Platz, um viele Sachen zu organisieren, vielleicht mehr als jetzt. Jetzt sind zu viele Sachen europäisch organisiert. Und andere Sachen sind zu wenig europäische organisiert. Das ist außer Balance. Zuweilen sagen Leute, Sie sind zu idealistisch und das ist alles Utopie. Ich sage, nein, unsere Realität ist international. Was Sie auch sagen, das ist die Realität. Es ist nur sehr realistisch, diese Sachen supranational zu organisieren. Es wird schwer sein und kompliziert, aber ich glaube nicht, dass wir oder unsere Enkelkinder auf andere Weise das 21. Jahrhundert gut überleben können. Wir müssen sehr gut zusammenarbeiten und mehr als das.
Weyh: Was sagt, Herr Mak, Ihr Realismus in Bezug auf den EU-Beitritt der Türkei? Sie gelten als jemand, der sagt, ja, das wird kommen und das muss kommen. Sehr interessant fand ich den Aspekt, dass Sie in einem Interview vor ein paar Monaten gesagt haben: Eigentlich hat die Integration des Orients ja mit Griechenland angefangen und nicht erst mit der Türkei.
Mak: Mit Griechenland, natürlich. Griechenland war ein Teil des Balkans. Natürlich ist ein großer Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland. Aber auf der anderen Seite ist ein Teil die Orthodoxie. Man kann sagen, das kleine Europa hat den gleichen Hintergrund, wenn man nur von Westeuropa redet, das nordische, protestantistische und das katholische. Italien und Spanien geht noch. Aber wir haben die großen kulturellen Grenzen Europas überschritten. Das ist nicht das Problem mit der Türkei und auch nicht, dass es ein islamistisches Land ist. Das Problem mit der Türkei ist, dass es wirklich ein sehr großes Land ist, wo ökonomisch noch viel geschehen muss, und dass auch in der Türkei die nationalistischen Gedanken sehr stark sind. Es wird mindestens noch eine neue Generation Politiker kommen müssen, die wirklich in der europäischen Gemeinschaft gut mitreden können. Das braucht Zeit. Aber es ist auch gut möglich, dass es plötzlich alles schneller geht, weil man innerhalb der arabischen Welt und auch innerhalb der Türkei die Leute sich entwickeln sieht - plötzlich, sehr schnell. Viele junge Leute sind jetzt sehr gut gebildet. All diese, diese ganze neue Generation muss noch auf den politischen Markt kommen. Das kann große Schnelligkeit und Veränderungen ergeben. Die werden nicht mehr auf die alten Fundamentalisten und alten Imams hören. Das wird ganz anders gehen. Darüber bin ich sicher.
Weyh: Eine optimistische Aussicht von Geert Mak zum Beitritt der Türkei zur EU. Wenn man es mal ganz zugespitzt sagen würde, Johannes Willms, ist es nicht so, dass auch Frankreich ein sehr, sehr starkes Nationalbewusstsein hat in der Bevölkerung, das weit über das hinausgeht, was andere Staaten in Europa haben?
Willms: Ja, natürlich, weil Frankreich sich immer noch eine Sache eingestehen muss: Frankreich lebt immer noch im Bewusstsein, eine Großmacht zu sein. Frankreich lebt immer noch in dem Bewusstsein, Siegermacht des Zweiten Weltkriegs zu sein. Das ist ganz entscheidend. Das ist natürlich eine Legende, ein Mythos, den De Gaulle damals in die Welt gesetzt hat und den es auch brauchte, um das Land zusammenzuhalten. Aber das ist natürlich heute ein Fluch, wenn Sie so wollen, überspitzt gesprochen, an dem Frankreich leidet.
Aber ich will noch etwas zum Beitritt der Türkei sagen. Ich möchte eine Voraussage wagen. Es wird noch mal der Zeitpunkt kommen, wo hier auf einmal alle Leute wollen, dass auch Abu Dhabi und Dubai und wie die Staaten alle heißen, die Öl haben und reich sind, in der EU drin sind. Das würde noch manchem irgendwann schmecken - ich sag’s Ihnen. Wir bauen jetzt schon den Louvre da hin. Dann wollen wir sie demnächst auch in der EU haben, weil die alle so viel schönes Geld haben.
Weyh: Das ist ein wunderbares Beinahe-Schusswort zu dieser Lesart Spezial aus Leipzig von der Leipziger Buchmesse. Ich überfalle Sie jetzt beide noch damit, dass sie einen Buchtitel jeweils mir und unseren Hörern sagen, welches Buch Sie besonders beeindruckt hat, was Sie zu lesen empfehlen. Sie dürfen nur eine Minute überlegen. Ich erwähnte noch mal für die Hörer, welche Titel wir hier besprochen haben. Das war zum einen der Titel "Die Brücke von Istanbul", erschienen bei Pantheon, von Geert Mak, und zum anderen die Biografie "Napoleon III.", erschienen bei C.H. Beck. So, Herr Willms, was empfehlen Sie unseren Hörern?
Willms: Ich würde sofort empfehlen, weil es eines meiner Lieblinge ist seit je: Stendhal "Die Kartause von Parma", und zwar natürlich in der neuen Übersetzung von Elisabeth Edl, im Hanser Verlag erschienen.
Mak: Ich kenne den deutschen Buchmarkt nicht so gut, aber ich empfehle eine Frau aus meinem eigenen Land, Margriet de Moor, und ich hoffe, dass es schon in Deutsch übersetzt ist: "Die Ertrunkene". Das ist ein wunderbares Buch über die Niederlande, über das Wasser. Und man liest es als einen Thriller. Es ist auch ein literarisches Buch, aber auch ein Thriller. Das kann ich sehr empfehlen.
Weyh: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie gehen ins Internet und werden bei Google das suchen und Sie werden es finden, was Geert Mak uns hier empfohlen hat.
Mak: Alles über die Niederlande.
Weyh: Das war Lesart Spezial, heute von der Leipziger Buchmesse. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
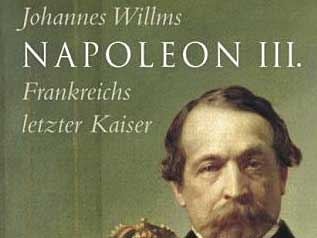
Johannes Willms: Napoleon III.© Beck Verlag
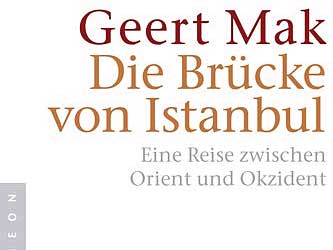
Geert Mak neues Buch: "Die Brücke von Istanbul".© Pantheon Verlag
