Leichte Lyrik von schwergewichtigen Diktatoren
Muammar al-Gaddafi, Josef Stalin und Saddam Hussein waren als machtbesessene Diktatoren bekannt. Neben ihrem blutigen Geschäft gingen sie jedoch einem Hobby nach: sie schrieben Gedichte. Worum es ihnen dabei ging, erklären die Autoren des Buches "Despoten dichten".
"Durch dieses Land streifte er
Wie ein Geist von Tür zur Tür;
Seine Hände umklammerten eine Laute
Und ließen süß sie klingen..."
Diese empfindsamen, im Jahr 1895 veröffentlichten Zeilen wurden von einem jungen Mann verfasst, der sich wenig später den Kampfnamen Stalin, "der Stählerne", geben sollte. Sie finden sich in einem Band von Aufsätzen, in denen sich verschiedene Wissenschaftler den poetischen Arbeiten verschiedener Diktatoren von Mussolini bis Saddam Hussein, von Stalin bis Gaddafi widmen.
Sein griffiger Titel "Despoten dichten" weist dabei auf eine entscheidende Fragestellung hin. Er assoziiert zwiegespaltene Seelen, in denen das Despotentum die schwarzen Seiten bezeichnet, die Dichtung aber die lichten, denen sich die Herrscher als Entspannung von ihrem blutigen Geschäft von Zeit zu Zeit hingeben. Gewiss gab es auch das, wie im Falle des in mancherlei Hinsicht die Regel sprengenden Mao Ze Dong, doch es war die Ausnahme.
Gewöhnlich ist der Drang zum poetischen Ausdruck an das jugendliche Aufbegehren innerhalb einer militanten Bohemegesellschaft gebunden und macht später einer, wie es im Vorwort heißt, "den Machtanspruch fundierenden Weltanschauungsprosa" Platz. Die zentrale Frage also hat nicht auf die scheinbare Unvereinbarkeit von Dichter- und Despotentum zu zielen, sondern darauf, welcher Art die Dichtung der zukünftigen Diktatoren war, dass sie sie ohne Probleme zugunsten von Parteitagsreden und dem Unterzeichnen von Erschießungsbefehlen aufgegeben werden konnte.
Was sich grundsätzlich sagen lässt, ist dies: Es war überhaupt keine Dichtung, sondern banale Verseschmiederei, die jegliche Bewusstheit des eigenen Tuns und damit jede Spur von Selbstironie vermissen lässt. Sie ist Mittel zum Zwecke der eigenen Selbsterhöhung, wie sie später die Machtausübung viel nachhaltiger leisten kann und sie damit überflüssig macht.
Die Autoren folgen den wirren Phantastereien ihrer Protagonisten und deren Umschlagen in blutige Realität durch die letzten 100 Jahre bis in das neue Jahrtausend, in dem der Wahnsinn keineswegs endet, sondern einen besonders grotesken Höhepunkt in dem Kultus findet, den der Führer aller Turkmenen Nyýazow um sein zur Erlösung der gesamten Menschheit geschriebenes Hauptwerk "Ruhnama" entfacht hat.
Das Buch steht als aufklappbares, überdimensionales Monument im hauptstädtischen Park, der allabendlich von feierlichen Rezitationen widerhallt; seine Weisheit gilt offiziell als alleinige Lebenslinie sämtlicher Turkmenen, der September ist in "Ruhnama" umbenannt worden, jeder Samstag soll als "Tag des Geistes" dem Studium des Buches gewidmet sein, und ein Exemplar von ihm kreist seit Jahren in einem Satelliten um die Erde.
Nicht weniger epochal hat es Muammar al-Gaddafi mit seinem "Grünen Buch" gemeint. Der Aufsatz über ihn ist nicht nur aus aktuellen Gründen besonders aufschlussreich. Gaddafi ist der einzige, der Einblicke in das Innenleben eines amtierenden Despoten gewährt. Seine Erzählung mit dem bezeichnenden Titel "Die Flucht in die Hölle" beginnt mit den Worten:
"Wie hartherzig sind doch die Menschen, wenn sie gemeinsam das Maß überschreiten! Welch ein gewaltiger Strom, der mit keinem Mitleid hat, der sich ihm in den Weg stellt! Der sein Schreien nicht hört und ihm die Hand nicht entgegenstreckt, wenn er ihn anfleht und um Hilfe bittet. Ja, ohne Aufhebens stoßen sie ihn vor sich her. Die Tyrannei eines Einzelnen ist die schädlichste aller Tyranneien, doch der Despot ist ein Einzelner, den die Gemeinschaft beseitigen kann, ja, sogar ein unbedeutendes Individuum kann ihn, womit auch immer, beseitigen. Die Tyrannei der Massen dagegen ist die brutalste Art von Tyrannei, denn wer kann sich allein gegen den reißenden Strom, gegen die blinde umfassende Macht stellen?"
Zumindest was sein Ende anbetrifft, kann man hier einem der Diktatoren die Macht zur Prophetie nicht absprechen: ein gealterter Beduine, halb Tyrann, halb orientalischer Weiser flüchtet vor den von ihm entfesselten städtischen Massen in die Hölle, wo er endlich Ruhe findet. Leider wird in diesem Fall der Genuss an der Interpretation dadurch beeinträchtigt, dass sich der Kritiker, wie einige seiner Kollegen, einer Sprache bedient, die mit ihrem forciert wissenschaftlichen Vokabular, ihren Tautologien und Worthülsen ähnlich schwer verdaulich ist wie die der dichtenden Despoten.
Dass es anders geht und Geschichte noch erzählt und nicht nur über sie referiert werden kann, zeigt Burkhard Müller in seinem Text über Saddam Hussein. Die Arbeit an der Übersetzung eines in Verse gebrachten Hilferufes, den der Diktator aus seinem Kellerversteck geschmuggelt hat, bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Als Müller angesichts einer besonders vertrackten Formulierung eine irakische, im britischen Exil lebende Schriftstellerin um Hilfe bittet, möchte der Leser in deren Schrei der Empörung einstimmen:
"'Dieser Bastard! Dieser Hundesohn!', ruft sie übers Telefon. 'Das versteht kein Mensch, und ich soll es verstehen?'"
Auch Saddam Hussein also, der seine Karriere als Auftragskiller seines Stammes begonnen hat, der gemäß seiner Einsicht "Nur aus dem Blut fließt die gültige Schrift" sich später in insgesamt 50 Sitzungen 26 Liter Blut abzapfen ließ, um damit ein Exemplar des Korans abschreiben zu lassen, auch der rohe und ungebildete Saddam also hat das Bedürfnis empfunden, sich durch die Schrift zu verewigen. Neben seinen politischen Büchern hat er Gedichte und vier Romane veröffentlicht, die er in vorgetäuschter Anonymität als jeweils "Ein Buch von seinem Verfasser" unter die Menschen brachte.
Womit wir wieder bei Joseph Wissarionowitsch Stalin gelandet wären. Auch er hat unter seine prosaischen Hauptwerke, die Trilogie von Lenin-Biografie, eigener Biografie und "Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion", nicht seinen Namen gesetzt, sondern Wissenschaftler des Marx-Engels-Lenin-Instituts als Verfasser firmieren lassen. Ihr "oratorischer" Bürokratenstil aber, die Mischung aus Kleinkindersprache und Funktionärsjargon, die fiktiven Dialoge, die an die Katechismen seiner Zeit als Priesterseminarist erinnern, bezeugen, wer hinter diesen Kollektiven stand: der erfolgreichste Diktator und Buchautor nicht nur des letzten Jahrhunderts.
Wie sein Stil die Literatur einer ganzen Epoche, den "sozialistischen Realismus", geprägt und er damit das Despotentum in der Dichtung fest verankert hat, wäre eine eigene Untersuchung wert. Auf dem Gebiet der "vergleichenden Diktatorologie" ist, um mit einem der Autoren zu sprechen, noch eine Menge zu tun.
Albrecht Koschorke, Konstantin Kaminskij (Hg.): Despoten dichten - Sprachkunst und Gewalt
Konstanz University Press, Konstanz 2011
364 Seiten, 24,90 Euro
Wie ein Geist von Tür zur Tür;
Seine Hände umklammerten eine Laute
Und ließen süß sie klingen..."
Diese empfindsamen, im Jahr 1895 veröffentlichten Zeilen wurden von einem jungen Mann verfasst, der sich wenig später den Kampfnamen Stalin, "der Stählerne", geben sollte. Sie finden sich in einem Band von Aufsätzen, in denen sich verschiedene Wissenschaftler den poetischen Arbeiten verschiedener Diktatoren von Mussolini bis Saddam Hussein, von Stalin bis Gaddafi widmen.
Sein griffiger Titel "Despoten dichten" weist dabei auf eine entscheidende Fragestellung hin. Er assoziiert zwiegespaltene Seelen, in denen das Despotentum die schwarzen Seiten bezeichnet, die Dichtung aber die lichten, denen sich die Herrscher als Entspannung von ihrem blutigen Geschäft von Zeit zu Zeit hingeben. Gewiss gab es auch das, wie im Falle des in mancherlei Hinsicht die Regel sprengenden Mao Ze Dong, doch es war die Ausnahme.
Gewöhnlich ist der Drang zum poetischen Ausdruck an das jugendliche Aufbegehren innerhalb einer militanten Bohemegesellschaft gebunden und macht später einer, wie es im Vorwort heißt, "den Machtanspruch fundierenden Weltanschauungsprosa" Platz. Die zentrale Frage also hat nicht auf die scheinbare Unvereinbarkeit von Dichter- und Despotentum zu zielen, sondern darauf, welcher Art die Dichtung der zukünftigen Diktatoren war, dass sie sie ohne Probleme zugunsten von Parteitagsreden und dem Unterzeichnen von Erschießungsbefehlen aufgegeben werden konnte.
Was sich grundsätzlich sagen lässt, ist dies: Es war überhaupt keine Dichtung, sondern banale Verseschmiederei, die jegliche Bewusstheit des eigenen Tuns und damit jede Spur von Selbstironie vermissen lässt. Sie ist Mittel zum Zwecke der eigenen Selbsterhöhung, wie sie später die Machtausübung viel nachhaltiger leisten kann und sie damit überflüssig macht.
Die Autoren folgen den wirren Phantastereien ihrer Protagonisten und deren Umschlagen in blutige Realität durch die letzten 100 Jahre bis in das neue Jahrtausend, in dem der Wahnsinn keineswegs endet, sondern einen besonders grotesken Höhepunkt in dem Kultus findet, den der Führer aller Turkmenen Nyýazow um sein zur Erlösung der gesamten Menschheit geschriebenes Hauptwerk "Ruhnama" entfacht hat.
Das Buch steht als aufklappbares, überdimensionales Monument im hauptstädtischen Park, der allabendlich von feierlichen Rezitationen widerhallt; seine Weisheit gilt offiziell als alleinige Lebenslinie sämtlicher Turkmenen, der September ist in "Ruhnama" umbenannt worden, jeder Samstag soll als "Tag des Geistes" dem Studium des Buches gewidmet sein, und ein Exemplar von ihm kreist seit Jahren in einem Satelliten um die Erde.
Nicht weniger epochal hat es Muammar al-Gaddafi mit seinem "Grünen Buch" gemeint. Der Aufsatz über ihn ist nicht nur aus aktuellen Gründen besonders aufschlussreich. Gaddafi ist der einzige, der Einblicke in das Innenleben eines amtierenden Despoten gewährt. Seine Erzählung mit dem bezeichnenden Titel "Die Flucht in die Hölle" beginnt mit den Worten:
"Wie hartherzig sind doch die Menschen, wenn sie gemeinsam das Maß überschreiten! Welch ein gewaltiger Strom, der mit keinem Mitleid hat, der sich ihm in den Weg stellt! Der sein Schreien nicht hört und ihm die Hand nicht entgegenstreckt, wenn er ihn anfleht und um Hilfe bittet. Ja, ohne Aufhebens stoßen sie ihn vor sich her. Die Tyrannei eines Einzelnen ist die schädlichste aller Tyranneien, doch der Despot ist ein Einzelner, den die Gemeinschaft beseitigen kann, ja, sogar ein unbedeutendes Individuum kann ihn, womit auch immer, beseitigen. Die Tyrannei der Massen dagegen ist die brutalste Art von Tyrannei, denn wer kann sich allein gegen den reißenden Strom, gegen die blinde umfassende Macht stellen?"
Zumindest was sein Ende anbetrifft, kann man hier einem der Diktatoren die Macht zur Prophetie nicht absprechen: ein gealterter Beduine, halb Tyrann, halb orientalischer Weiser flüchtet vor den von ihm entfesselten städtischen Massen in die Hölle, wo er endlich Ruhe findet. Leider wird in diesem Fall der Genuss an der Interpretation dadurch beeinträchtigt, dass sich der Kritiker, wie einige seiner Kollegen, einer Sprache bedient, die mit ihrem forciert wissenschaftlichen Vokabular, ihren Tautologien und Worthülsen ähnlich schwer verdaulich ist wie die der dichtenden Despoten.
Dass es anders geht und Geschichte noch erzählt und nicht nur über sie referiert werden kann, zeigt Burkhard Müller in seinem Text über Saddam Hussein. Die Arbeit an der Übersetzung eines in Verse gebrachten Hilferufes, den der Diktator aus seinem Kellerversteck geschmuggelt hat, bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Als Müller angesichts einer besonders vertrackten Formulierung eine irakische, im britischen Exil lebende Schriftstellerin um Hilfe bittet, möchte der Leser in deren Schrei der Empörung einstimmen:
"'Dieser Bastard! Dieser Hundesohn!', ruft sie übers Telefon. 'Das versteht kein Mensch, und ich soll es verstehen?'"
Auch Saddam Hussein also, der seine Karriere als Auftragskiller seines Stammes begonnen hat, der gemäß seiner Einsicht "Nur aus dem Blut fließt die gültige Schrift" sich später in insgesamt 50 Sitzungen 26 Liter Blut abzapfen ließ, um damit ein Exemplar des Korans abschreiben zu lassen, auch der rohe und ungebildete Saddam also hat das Bedürfnis empfunden, sich durch die Schrift zu verewigen. Neben seinen politischen Büchern hat er Gedichte und vier Romane veröffentlicht, die er in vorgetäuschter Anonymität als jeweils "Ein Buch von seinem Verfasser" unter die Menschen brachte.
Womit wir wieder bei Joseph Wissarionowitsch Stalin gelandet wären. Auch er hat unter seine prosaischen Hauptwerke, die Trilogie von Lenin-Biografie, eigener Biografie und "Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion", nicht seinen Namen gesetzt, sondern Wissenschaftler des Marx-Engels-Lenin-Instituts als Verfasser firmieren lassen. Ihr "oratorischer" Bürokratenstil aber, die Mischung aus Kleinkindersprache und Funktionärsjargon, die fiktiven Dialoge, die an die Katechismen seiner Zeit als Priesterseminarist erinnern, bezeugen, wer hinter diesen Kollektiven stand: der erfolgreichste Diktator und Buchautor nicht nur des letzten Jahrhunderts.
Wie sein Stil die Literatur einer ganzen Epoche, den "sozialistischen Realismus", geprägt und er damit das Despotentum in der Dichtung fest verankert hat, wäre eine eigene Untersuchung wert. Auf dem Gebiet der "vergleichenden Diktatorologie" ist, um mit einem der Autoren zu sprechen, noch eine Menge zu tun.
Albrecht Koschorke, Konstantin Kaminskij (Hg.): Despoten dichten - Sprachkunst und Gewalt
Konstanz University Press, Konstanz 2011
364 Seiten, 24,90 Euro
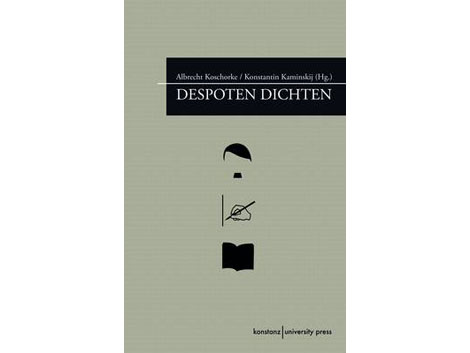
Cover: "Despoten dichten - Sprachkunst und Gewalt" von Albrecht Koschorke u.a.© Konstanz University Press
