Leben in einer Republik ohne Fundament
Der politische Philosoph Carl Schmitt ist einer der umstrittendsten Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts. Der Soziologe Stefan Breuer hat nun untersucht, in welchen intellektuellen Kreisen der Weimarer Republik der spätere "Kronjurist des Dritten Reichs" Anregung und Zuspruch suchte.
Es sind nicht die Menschen, die Ereignisse vorbereiten. Vielmehr sind es die Ereignisse, die mit herausfordernder Macht wirken und eine Antwort verlangen. Der Jurist und politische Denker Carl Schmitt, ein Theoretiker des Souveräns, der das Gespräch in der Kommunikationsgesellschaft unterbrechen darf, bestätigt diese Erfahrung.
In verwirrend vielen Aufsätzen zwischen 1912 und 1970 reagierte er unmittelbar auf die turbulent sich überstürzenden Ereignisse zur Verwirrung seiner Leser, die so plötzlicher, in ihren Argumenten wechselnder Geistesgegenwart nicht immer gewachsen waren. So wurde er zu einem Fabeltier, das weltweit weiterhin beachtet wird wegen seines ...
"... ausgeprägten Sensoriums für die Dekomposition des klassischen, juristischen Rationalismus, für die Brüchigkeit der Normalität und die ewige Wiederkehr der Ausnahme, für die 'Enthegung' und Irregularisierung des Krieges, für die Widersprüche moderner Massendemokratien, die die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft zum Verschwimmen bringen, für die aggressiven Dimensionen, die auf Frieden, Verständigung und 'Emanzipation' gerichtete Ideen entfalten können."
Stefan Breuer beobachtet Carl Schmitt im Zusammenhang mit seinen Kollegen, mit Journalisten, Politikern, Offizieren, Wirtschaftsführern, Schriftstellern oder Künstlern vor allem während der Zeit der Weimarer Republik. Sie alle suchten damals den wechselseitigen Austausch, ohne Furcht vor verwegenen Urteilen.
In verwirrend vielen Aufsätzen zwischen 1912 und 1970 reagierte er unmittelbar auf die turbulent sich überstürzenden Ereignisse zur Verwirrung seiner Leser, die so plötzlicher, in ihren Argumenten wechselnder Geistesgegenwart nicht immer gewachsen waren. So wurde er zu einem Fabeltier, das weltweit weiterhin beachtet wird wegen seines ...
"... ausgeprägten Sensoriums für die Dekomposition des klassischen, juristischen Rationalismus, für die Brüchigkeit der Normalität und die ewige Wiederkehr der Ausnahme, für die 'Enthegung' und Irregularisierung des Krieges, für die Widersprüche moderner Massendemokratien, die die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft zum Verschwimmen bringen, für die aggressiven Dimensionen, die auf Frieden, Verständigung und 'Emanzipation' gerichtete Ideen entfalten können."
Stefan Breuer beobachtet Carl Schmitt im Zusammenhang mit seinen Kollegen, mit Journalisten, Politikern, Offizieren, Wirtschaftsführern, Schriftstellern oder Künstlern vor allem während der Zeit der Weimarer Republik. Sie alle suchten damals den wechselseitigen Austausch, ohne Furcht vor verwegenen Urteilen.
Ein Gefühl der Leere gegenüber der neuen Verfassung
Schon vor dem Krieg befand sich die bürgerlich-liberale Welt in heilloser Auflösung. Nach der Niederlage sollte ausgerechnet eine bürgerlich-liberale Verfassung des 19. Jahrhunderts zum Aufbruch in eine schönere, republikanische Zukunft im 20. Jahrhundert verhelfen. Das konnte nicht gut gehen.
"Heute geht es darum, das Proletariat, eine nicht besitzende und nicht gebildete Masse, in eine politische Einheit zu integrieren. Für diese Aufgabe, die noch kaum ins Auge gefasst worden ist, sind heute immer noch nur die Apparate und Maschinen zur Verfügung, die jener alten Aufgabe der Integration des gebildeten Bürgertums dienten. Die Verfassung ist ein solcher Apparat. Daher kommt uns alles so künstlich gemacht vor, daher dies Gefühl der Leere, das man so leicht der Weimarer Verfassung gegenüber hat … "
... wie Carl Schmitt 1928 schrieb. Dies Gefühl der Leere teilte er mit vielen von rechts bis links. Diese Republik konnte keine Republikaner finden. Ihre Verfassung war eine ideale Konstruktion von 1848, was höchstens bürgerlichen Ästheten wie Thomas Mann interessant vorkam. Zur freischwebenden liberal-bildungsbürgerlichen Republik ohne Fundament in der Gesellschaft gab es damals allerdings noch Alternativen: die Sowjetunion, das faschistische Italien, den christlichen Ständestaat oder Militärdiktaturen verschiedenster Art.
Solche so "formierten Gesellschaften" wurden nicht für undemokratisch gehalten, weil Massenbewegungen mit ihnen verbunden waren. Eine wie auch immer organisierte "autoritäre Demokratie" oder "Führerdemokratie", die vorerst gar nichts mit der NSDAP zu tun hatte, konnte ratlosen Bürgern im Verwesungsprozess der Bourgeoisie einige Hoffnung machen.
"Heute geht es darum, das Proletariat, eine nicht besitzende und nicht gebildete Masse, in eine politische Einheit zu integrieren. Für diese Aufgabe, die noch kaum ins Auge gefasst worden ist, sind heute immer noch nur die Apparate und Maschinen zur Verfügung, die jener alten Aufgabe der Integration des gebildeten Bürgertums dienten. Die Verfassung ist ein solcher Apparat. Daher kommt uns alles so künstlich gemacht vor, daher dies Gefühl der Leere, das man so leicht der Weimarer Verfassung gegenüber hat … "
... wie Carl Schmitt 1928 schrieb. Dies Gefühl der Leere teilte er mit vielen von rechts bis links. Diese Republik konnte keine Republikaner finden. Ihre Verfassung war eine ideale Konstruktion von 1848, was höchstens bürgerlichen Ästheten wie Thomas Mann interessant vorkam. Zur freischwebenden liberal-bildungsbürgerlichen Republik ohne Fundament in der Gesellschaft gab es damals allerdings noch Alternativen: die Sowjetunion, das faschistische Italien, den christlichen Ständestaat oder Militärdiktaturen verschiedenster Art.
Solche so "formierten Gesellschaften" wurden nicht für undemokratisch gehalten, weil Massenbewegungen mit ihnen verbunden waren. Eine wie auch immer organisierte "autoritäre Demokratie" oder "Führerdemokratie", die vorerst gar nichts mit der NSDAP zu tun hatte, konnte ratlosen Bürgern im Verwesungsprozess der Bourgeoisie einige Hoffnung machen.
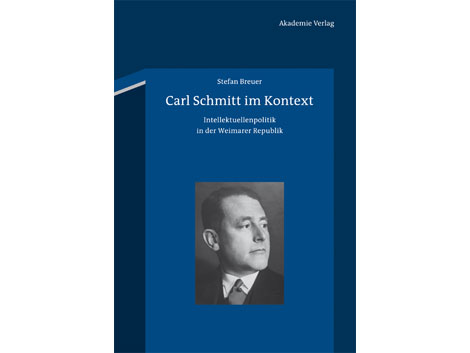
Cover: "Carl Schmitt im Kontext" von Stefan Breuer© Akademie Verlag
Schmitt hatte im Krieg die Bedeutung des Staats erkannt
Carl Schmitt war kein Bürger. Er fürchtete den Bourgeois, der nur Geschäfte machen will und glaubt, nur in Einkaufsparadiesen ein wahrer Mensch zu sein. Er hatte im Kriege die Bedeutung des Staates erkannt. Der Ausnahmezustand in den Wirren seit 1914 vermittelte ihm eine Idee von der Normalität, die mit Weimar für ihn und viele andere nicht erreicht worden war.
Carl Schmitt kam aus dem liberalen Kaiserreich. Der totale, alles politisierende Staat war ihm deshalb fragwürdig. Im autoritären Staat, in der Herrschaft des vom Volk gewählten Präsidenten, in Hindenburg, erkannte er das letzte Heilmittel gegen den heraufziehenden parteilichen Totalitarismus. Er riet 1932, nur Teile der Verfassung aufzuheben, aber nie die Verfassung insgesamt, um den Staat zu retten.
Damit gehört er zu vielen anderen, wie Stefan Breuer beschreibt, die mit unkonventionellen Mitteln die Substanz einer bürgerlichen Verfassung in nachbürgerlicher Zeit bewahren wollten, aus Sorge um den Staat. Eine vergebliche Mühe, weil der Bürger dem Staat, aber nie den Parteien misstraut hatte.
Stefan Breuer: Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik
Akademie Verlag, Berlin 2012
304 Seiten, 49,80 Euro
Carl Schmitt kam aus dem liberalen Kaiserreich. Der totale, alles politisierende Staat war ihm deshalb fragwürdig. Im autoritären Staat, in der Herrschaft des vom Volk gewählten Präsidenten, in Hindenburg, erkannte er das letzte Heilmittel gegen den heraufziehenden parteilichen Totalitarismus. Er riet 1932, nur Teile der Verfassung aufzuheben, aber nie die Verfassung insgesamt, um den Staat zu retten.
Damit gehört er zu vielen anderen, wie Stefan Breuer beschreibt, die mit unkonventionellen Mitteln die Substanz einer bürgerlichen Verfassung in nachbürgerlicher Zeit bewahren wollten, aus Sorge um den Staat. Eine vergebliche Mühe, weil der Bürger dem Staat, aber nie den Parteien misstraut hatte.
Stefan Breuer: Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik
Akademie Verlag, Berlin 2012
304 Seiten, 49,80 Euro
