Kurz und kritisch
„Shanghai – fern von wo“ ist ein beeindruckendes Buch von Ursula Krechel über den Fluchtort vor dem Naziterror. „Kein Kommentar“ von Klaus Werle dreht sich um die Sprache von Politikern. Daniel Goeudeverts „Seerosen-Prinzip“ gilt als ein Empörungsbuch.
Ursula Krechel: Shanghai – fern von wo, Jung und Jung Verlag 2008
Die chinesische Frühlingsrolle ist ein Apfelstrudel mit Gemüsefüllung, erfunden von einer jüdischen Anwaltsgattin aus Wien. Davon wird am Ende des vorliegenden Buches jeder Leser überzeugt sein, auch wenn es nicht stimmt. Es ist das wahrscheinlich einzige erfundene Detail in Ursula Krechels großartigem Dokumentarroman „Shanghai fern von wo“. Shanghai, einer der wenigen Fluchtorte vor dem Naziterror ohne heruntergelassene Visumschranke, rettete europäischen Intellektuellen das Leben. Mehr aber nicht. Schon vor der behördlichen Ankunftsfrage mussten sie kapitulieren: „Was können Sie?“ Wenig genug, um in der subtropischen Metropole das tägliche Brot zu verdienen.
Aus Zeitzeugenberichten und Interviews hat Ursula Krechel ein vielstimmiges Konzert komponiert, das den vergessenen Schauplatz plastisch auferstehen lässt. Sie setzt Überlebenden wie Toten ein Denkmal und mahnt die Nachgeborenen, ihre Biographien nie für abgeschlossen zu halten: „Ein wohlhabendes Elternhaus, eine gesicherte Zukunft, das hätte ausgereicht, einen Menschen wie mich lebenslänglich untüchtig zu machen“, sagt Ludwig Lazarus, ein Berliner Buchhändler. Am Ende führt er noch einen langen Kampf gegen bundesdeutsche Behörden über Entschädigungsleistungen. Beeindruckend.
Klaus Werle: Kein Kommentar! Notizen zur Sprache der Mächtigen“, Herder Verlag, 2008
Nein, es war nicht Klaus Wowereit, der erstmals das historische Wort prägte, es sei noch zu früh, „ein Glas Sekt aufzumachen“, sondern Beinahe-Kanz¬ler Edmund Stoiber 2002. Die kleine Ungenauigkeit im Kompendium schiefer Metaphern und sprachlicher Missetaten unserer Politiker sei Autor Klaus Werle verziehen. Von Franz Münteferings physikalischer Erkenntnis: „Reibung erzeugt Hitze, aber auch Fortschritt“ bis zu Joschka Fischer verschlagener Jesuitenweisheit „Der Ausschuss zwingt mich zur Wahrhaftigkeit, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein“, reicht das parteiübergreifende Dummdeutsch-Material, das der Redakteur des „Manager Magazin“ genüsslich ausbreitet und seziert. Den Spitzenplatz nimmt jedoch die Ministerialbürokratie ein: „Der Charakter des Waldes und sein Erscheinungsbild werden in erster Linie durch die Bäume bestimmt“, meldete das saarländische Umweltministerium 2006. Erkenntnistheorietest: bestanden!
Daniel Goeudevert: Das Seerosen-Prinzip: Wie uns die Gier ruiniert, Dumont Verlag 2008
Prächtig sind sie anzusehen, die weißen Seerosenblüten auf tellergroßen grünen Blättern. Doch Achtung: Die Schönheit der Blüte, mahnt Daniel Goeudevert, betrügt das Auge; unter dem Blattwerk stirbt alles Leben ab. Die Seerose verzehrt zu viele Nährstoffe und erstickt andere Pflanzen durch ihr maßloses Wachstum. Das ist eine originelle Kapitalismusmetapher. Leider bleibt sie das einzig Originelle an dem 250-Seiten umfassenden Empörungsbuch, das noch einmal alles aufzählt, was wir ohnehin schon wissen. Management- und Politikskandale, Volkswirtschaft als Krieg der Wenigen gegen die Vielen. Dazu wird ordentlich die Tagespresse geplündert und manch fremder Antiglobalisierungstraktakt zitiert. Schriebe hier nicht ein prominenter Ex-Manager, würde man sich wundern, warum der auch noch darf. Aber das ist das Schöne an der Marktwirtschaft: Sie feiert die Freiheit des Überflüssigen.
Buchtipp von Gregor Schöllgen, Historiker:
Bogdan Musial: Kampfplatz Deutschland. – Stalins Kriegspläne gegen den Westen
Propyläen Verlag, Berlin 2008
Die chinesische Frühlingsrolle ist ein Apfelstrudel mit Gemüsefüllung, erfunden von einer jüdischen Anwaltsgattin aus Wien. Davon wird am Ende des vorliegenden Buches jeder Leser überzeugt sein, auch wenn es nicht stimmt. Es ist das wahrscheinlich einzige erfundene Detail in Ursula Krechels großartigem Dokumentarroman „Shanghai fern von wo“. Shanghai, einer der wenigen Fluchtorte vor dem Naziterror ohne heruntergelassene Visumschranke, rettete europäischen Intellektuellen das Leben. Mehr aber nicht. Schon vor der behördlichen Ankunftsfrage mussten sie kapitulieren: „Was können Sie?“ Wenig genug, um in der subtropischen Metropole das tägliche Brot zu verdienen.
Aus Zeitzeugenberichten und Interviews hat Ursula Krechel ein vielstimmiges Konzert komponiert, das den vergessenen Schauplatz plastisch auferstehen lässt. Sie setzt Überlebenden wie Toten ein Denkmal und mahnt die Nachgeborenen, ihre Biographien nie für abgeschlossen zu halten: „Ein wohlhabendes Elternhaus, eine gesicherte Zukunft, das hätte ausgereicht, einen Menschen wie mich lebenslänglich untüchtig zu machen“, sagt Ludwig Lazarus, ein Berliner Buchhändler. Am Ende führt er noch einen langen Kampf gegen bundesdeutsche Behörden über Entschädigungsleistungen. Beeindruckend.
Klaus Werle: Kein Kommentar! Notizen zur Sprache der Mächtigen“, Herder Verlag, 2008
Nein, es war nicht Klaus Wowereit, der erstmals das historische Wort prägte, es sei noch zu früh, „ein Glas Sekt aufzumachen“, sondern Beinahe-Kanz¬ler Edmund Stoiber 2002. Die kleine Ungenauigkeit im Kompendium schiefer Metaphern und sprachlicher Missetaten unserer Politiker sei Autor Klaus Werle verziehen. Von Franz Münteferings physikalischer Erkenntnis: „Reibung erzeugt Hitze, aber auch Fortschritt“ bis zu Joschka Fischer verschlagener Jesuitenweisheit „Der Ausschuss zwingt mich zur Wahrhaftigkeit, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein“, reicht das parteiübergreifende Dummdeutsch-Material, das der Redakteur des „Manager Magazin“ genüsslich ausbreitet und seziert. Den Spitzenplatz nimmt jedoch die Ministerialbürokratie ein: „Der Charakter des Waldes und sein Erscheinungsbild werden in erster Linie durch die Bäume bestimmt“, meldete das saarländische Umweltministerium 2006. Erkenntnistheorietest: bestanden!
Daniel Goeudevert: Das Seerosen-Prinzip: Wie uns die Gier ruiniert, Dumont Verlag 2008
Prächtig sind sie anzusehen, die weißen Seerosenblüten auf tellergroßen grünen Blättern. Doch Achtung: Die Schönheit der Blüte, mahnt Daniel Goeudevert, betrügt das Auge; unter dem Blattwerk stirbt alles Leben ab. Die Seerose verzehrt zu viele Nährstoffe und erstickt andere Pflanzen durch ihr maßloses Wachstum. Das ist eine originelle Kapitalismusmetapher. Leider bleibt sie das einzig Originelle an dem 250-Seiten umfassenden Empörungsbuch, das noch einmal alles aufzählt, was wir ohnehin schon wissen. Management- und Politikskandale, Volkswirtschaft als Krieg der Wenigen gegen die Vielen. Dazu wird ordentlich die Tagespresse geplündert und manch fremder Antiglobalisierungstraktakt zitiert. Schriebe hier nicht ein prominenter Ex-Manager, würde man sich wundern, warum der auch noch darf. Aber das ist das Schöne an der Marktwirtschaft: Sie feiert die Freiheit des Überflüssigen.
Buchtipp von Gregor Schöllgen, Historiker:
Bogdan Musial: Kampfplatz Deutschland. – Stalins Kriegspläne gegen den Westen
Propyläen Verlag, Berlin 2008
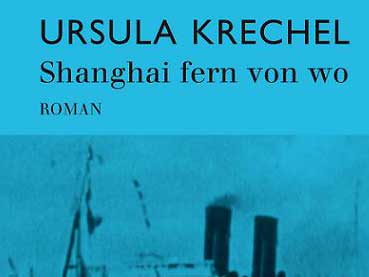
Cover: „Ursula Krechel: Shanghai – fern von wo“© Jung und Jung Verlag
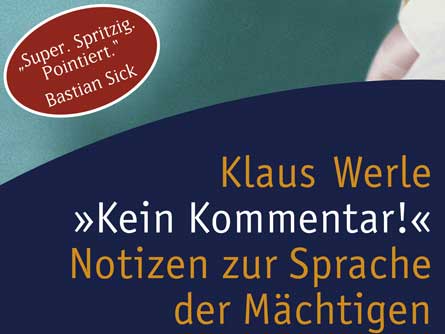
Cover: „Klaus Werle: Kein Kommentar! Notizen zur Sprache der Mächtigen“© Herder Verlag
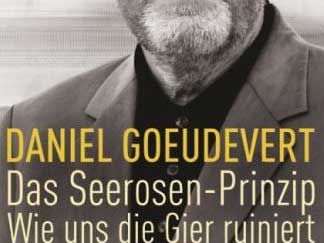
Cover: „Daniel Goeudevert: Das Seerosen-Prinzip“© Dumont Verlag
