Kurz und kritisch
In „Was ist Sprache?“ setzt sich Jürgen Trabant dafür ein, die europäische Sprachenvielfalt zu fördern. Günter Lachmann schildert in seinem Band „Von Not nach Elend“ seine Reise durch die „ausblutenden“ Regionen Deutschlands. Und Frank Ochmann erklärt in „Die gefühlte Moral“ die Entstehung von Werten im Spannungsverhältnis von Natur und Kultur.
Jürgen Trabant: Was ist Sprache?
Beck’sche Reihe, München
„Wo alles zum Englischen drängt, da besteht die Gefahr, dass wir auf den Müll werfen, was wir vom 16. bis zum 20. Jahrhundert entwickelt und gepflegt haben: Die Nationalsprachen“ – meinte einmal Jürgen Trabant. Der Berliner Linguist und Romanist hat sich schon oft dafür eingesetzt, die europäische Sprachenvielfalt zu fördern. Und das Paradies, wie es vor dem Turmbau zu Babel war – einsprachig nämlich – findet er langweilig. Jetzt hat er der Reihe seiner Bücher ein weiteres hinzugefügt, dem er ein Zitat Wilhelm von Humboldts voranstellt: ‚Die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung der Völker’. Trabants Text kreist um die Ursprünge der menschlichen Sprache, um ihre Geschichte, ihre Rolle in unserem Denken, um Dichtung und um Schönheit des Sprechens. Und er stellt auch ganz praktische Fragen: Welche Sprache soll in Europa gesprochen werden? Haben einzelne Sprachen, auch das Deutsche, eine Zukunft? Eine lohnende Lektüre – nicht nur für Linguisten.
Günter Lachmann: Von Not nach Elend – Eine Reise durch deutsche Landschaften und Geisterstädte von morgen
Piper Verlag, München
Stirbt Deutschland einen „leisen Tod“, werden ganze Landstriche „ausbluten“ und nur noch „Orte ohne Erinnerung“ sein? Diese Befürchtung hat der Journalist Günther Lachmann bestätigt gesehen bei seinen Reisen abseits der Metropolen. Grund sei der Bevölkerungsschwund, der das Bild der kleinen Gemeinden verändere. Lachmann beschreibt en detail die Probleme, die durch Überalterung und Landflucht entstehen und liefert ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt der Heimat. Und doch bewirkt er unter anderem, dass der Leser nun erst recht nicht mehr aufs Land ziehen mag, denn überzeugende Lösungsperspektiven sind im Buch dünn gesät. Es mangelt gerade an positiven Beispielen, die es überall in Deutschland ja gibt. Eine gute Handreichung ist das Zahlenmaterial, das die Entwicklung der Regionen verdeutlicht. Ob aber die Schlussfolgerungen so pessimistisch sein müssen, wie sie der Autor zieht, bleibe dahingestellt.
Frank Ochmann: Die gefühlte Moral – Warum wir Gut und Böse unterscheiden können
Ullstein Verlag, Berlin
„Um Gut’s zu tun, braucht’s keiner Überlegung“ – ein Goethe-Wort, das wissenschaftlich durchaus haltbar zu sein scheint. Die moderne Hirnforschung beteiligt sich an der Suche nach Antworten auf wichtige philosophische und religiöse Fragen: Was ist die Grundlage unserer Werte? Ist moralisches Handeln ein Produkt des Verstandes oder der Evolution? Oder von beidem? Hirnforscher sagen: Die Kultur steht in ständiger Wechselwirkung mit unserer biologischen Natur, und so unterscheiden wir gefühlsmäßig Gut und Böse. Eine brisante These – und doch durch Ergebnisse neuer Studien nachvollziehbar. Der Theologe und Journalist Frank Ochmann hat sie zusammengetragen und erfrischend unpolemisch interpretiert. Herausgekommen ist ein höchst interessanter, gut verständlicher Blick auf den Stand der Forschung. Hier lernt man was.
Buchtipp von Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen): Feridun Zaimogulu: Liebesbrand, Kiepenheuer & Witsch
Beck’sche Reihe, München
„Wo alles zum Englischen drängt, da besteht die Gefahr, dass wir auf den Müll werfen, was wir vom 16. bis zum 20. Jahrhundert entwickelt und gepflegt haben: Die Nationalsprachen“ – meinte einmal Jürgen Trabant. Der Berliner Linguist und Romanist hat sich schon oft dafür eingesetzt, die europäische Sprachenvielfalt zu fördern. Und das Paradies, wie es vor dem Turmbau zu Babel war – einsprachig nämlich – findet er langweilig. Jetzt hat er der Reihe seiner Bücher ein weiteres hinzugefügt, dem er ein Zitat Wilhelm von Humboldts voranstellt: ‚Die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung der Völker’. Trabants Text kreist um die Ursprünge der menschlichen Sprache, um ihre Geschichte, ihre Rolle in unserem Denken, um Dichtung und um Schönheit des Sprechens. Und er stellt auch ganz praktische Fragen: Welche Sprache soll in Europa gesprochen werden? Haben einzelne Sprachen, auch das Deutsche, eine Zukunft? Eine lohnende Lektüre – nicht nur für Linguisten.
Günter Lachmann: Von Not nach Elend – Eine Reise durch deutsche Landschaften und Geisterstädte von morgen
Piper Verlag, München
Stirbt Deutschland einen „leisen Tod“, werden ganze Landstriche „ausbluten“ und nur noch „Orte ohne Erinnerung“ sein? Diese Befürchtung hat der Journalist Günther Lachmann bestätigt gesehen bei seinen Reisen abseits der Metropolen. Grund sei der Bevölkerungsschwund, der das Bild der kleinen Gemeinden verändere. Lachmann beschreibt en detail die Probleme, die durch Überalterung und Landflucht entstehen und liefert ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt der Heimat. Und doch bewirkt er unter anderem, dass der Leser nun erst recht nicht mehr aufs Land ziehen mag, denn überzeugende Lösungsperspektiven sind im Buch dünn gesät. Es mangelt gerade an positiven Beispielen, die es überall in Deutschland ja gibt. Eine gute Handreichung ist das Zahlenmaterial, das die Entwicklung der Regionen verdeutlicht. Ob aber die Schlussfolgerungen so pessimistisch sein müssen, wie sie der Autor zieht, bleibe dahingestellt.
Frank Ochmann: Die gefühlte Moral – Warum wir Gut und Böse unterscheiden können
Ullstein Verlag, Berlin
„Um Gut’s zu tun, braucht’s keiner Überlegung“ – ein Goethe-Wort, das wissenschaftlich durchaus haltbar zu sein scheint. Die moderne Hirnforschung beteiligt sich an der Suche nach Antworten auf wichtige philosophische und religiöse Fragen: Was ist die Grundlage unserer Werte? Ist moralisches Handeln ein Produkt des Verstandes oder der Evolution? Oder von beidem? Hirnforscher sagen: Die Kultur steht in ständiger Wechselwirkung mit unserer biologischen Natur, und so unterscheiden wir gefühlsmäßig Gut und Böse. Eine brisante These – und doch durch Ergebnisse neuer Studien nachvollziehbar. Der Theologe und Journalist Frank Ochmann hat sie zusammengetragen und erfrischend unpolemisch interpretiert. Herausgekommen ist ein höchst interessanter, gut verständlicher Blick auf den Stand der Forschung. Hier lernt man was.
Buchtipp von Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen): Feridun Zaimogulu: Liebesbrand, Kiepenheuer & Witsch

Jürgen Trabant: Was ist Sprache?© beck'sche Reihe
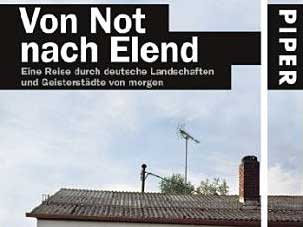
Günther Lachmann: Von Not nach Elend© Piper Verlag
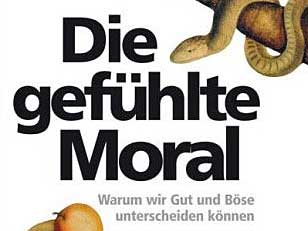
Frank Ochmann: Die gefühlte Moral© Ullstein Verlag
