Kurz und kritisch
Barbara Stollberg-Rilinger untersucht in "Des Kaisers alte Kleider" die Bedeutung von Symbolen und Ritualen für das politische Gemeinwesen im 1000-jährigen Reich. Jean Daive erinnert sich in "Unter der Kuppel" an den Schriftsteller Paul Celan. Und Albrecht von Lucke vergleicht in "Die gefährdete Republik" die Bonner und Berliner Republik.
Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider - Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches
Verlag C.H. Beck
Was das Dritte Reich war, wissen die meisten. Aber das erste Reich? Es hat immerhin über 1000 Jahre existiert, seit der Krönung Karls des Großen zum Kaiser des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" in Rom im Jahre 800. Die Römische Kirche und dieses "Alte Reich" haben gemeinsam und im häufigen Konflikt miteinander die europäische Geschichte bestimmt. Dieser Wirkungsgeschichte spürt das Buch der Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger nach. Es beschreibt die bewusstseinsbildende Bedeutung, die Symbole und Rituale für ein politisches Gemeinwesen haben. Die Aufklärung hatte das alles zu Plunder und Aberglauben erklärt, bis die totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts mit Aufmärschen und Monumentalbauten, mit Lichtdomen und Gesängen eine mächtige politische Ästhetik neu etablierten. Die Professorin aus Münster zeigt, dass Sinn und Form, Seele und Verstand eine für die Politik unabdingbare Einheit bilden. Dass Politik verlottert, wenn sie nur aus Paragraphen und Verträgen besteht, sehen wir ja am Zustand der Europäischen Union. Das Buch verfügt über eine großzügige Literaturliste und ein ausführliches Personenregister. Es zu lesen, ist eine Lust.
Jean Daive: Unter der Kuppel - Erinnerungen an Paul Celan
Edition Urs Engeler
Lyriker gelten als eine besondere Spezies. Hölderlin und Trakl, Rilke, Bachmann und Benn umgibt eine Aura. Keinen deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts allerdings so sehr wie Paul Celan. Wer sich einen Namen machen will, der schreibt gern etwas über einen Autor mit Aura. Da hatte der französische Schriftsteller Jean Daive großes Glück, als er Celan in Paris kennen lernte, sein Freund und Übersetzer wurde. Das vorliegende Büchlein, aus dem Französischen übersetzt, befasst sich mit Celan, mit seiner Frau, seiner Wohnung, seinem Alltag, seinem Verschwinden. Die Beerdigung wird en passant erwähnt. Daives Stil könnte man als Hystero-Eklektizismus beschreiben: hier eine Episode, dort ein Stichwort, irgendein Straßenname, ein Einfall, ein vom Himmel gefallenes "Mmmm", Montage ohne Sinn. Eine anstrengende, kokette Lektüre. Es handelt sich um die Zweitverwertung der Aura eines toten Dichters. Hat Celan es verdient, als Folie für die Selbstdarstellung eines geistigen Flaneurs zu fungieren?
Albrecht von Lucke: Die gefährdete Republik – Von Bonn nach Berlin. 1949 – 1989 – 2009
Wagenbach Verlag
Ist sie wirklich gefährdet, unsere Republik? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke befürchtet das. Im Untertitel seines Buches "Von Bonn nach Berlin" verweist er auf die Unterschiede, die er im Sinn hat, wenn er die Zeit vor und nach der Wiedervereinigung vergleicht. Luckes Urteil, Bonn sei nicht zuletzt wegen der sozialen Marktwirtschaft demokratisch stabiler gewesen als Berlin – stimmt das? Er fragt auch: Gibt es die Bundesrepublik noch oder gibt es nur noch Deutschland? Und meint: Der eigentliche Grund für das Verschwinden der Metapher von der Berliner Republik sei die emphatische Rückkehr Deutschlands. Ein Nationaldiskurs sei inzwischen scheinbar normal geworden. Was, darf man wohl sagen, wohl nichts grundsätzlich Falsches ist. Man legt das kleine Buch etwas ratlos aus der Hand. Auch wenn man durchaus bereit ist, eine Krise der Demokratie zu konstatieren, leuchten die Deutungen des Autors nicht immer ein. Und dass die Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern nicht gut funktioniert, wissen wir schon länger. Wo aber die Analyse nicht schlüssig ist, bleiben Denkanstöße für die Zukunft aus.
Verlag C.H. Beck
Was das Dritte Reich war, wissen die meisten. Aber das erste Reich? Es hat immerhin über 1000 Jahre existiert, seit der Krönung Karls des Großen zum Kaiser des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" in Rom im Jahre 800. Die Römische Kirche und dieses "Alte Reich" haben gemeinsam und im häufigen Konflikt miteinander die europäische Geschichte bestimmt. Dieser Wirkungsgeschichte spürt das Buch der Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger nach. Es beschreibt die bewusstseinsbildende Bedeutung, die Symbole und Rituale für ein politisches Gemeinwesen haben. Die Aufklärung hatte das alles zu Plunder und Aberglauben erklärt, bis die totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts mit Aufmärschen und Monumentalbauten, mit Lichtdomen und Gesängen eine mächtige politische Ästhetik neu etablierten. Die Professorin aus Münster zeigt, dass Sinn und Form, Seele und Verstand eine für die Politik unabdingbare Einheit bilden. Dass Politik verlottert, wenn sie nur aus Paragraphen und Verträgen besteht, sehen wir ja am Zustand der Europäischen Union. Das Buch verfügt über eine großzügige Literaturliste und ein ausführliches Personenregister. Es zu lesen, ist eine Lust.
Jean Daive: Unter der Kuppel - Erinnerungen an Paul Celan
Edition Urs Engeler
Lyriker gelten als eine besondere Spezies. Hölderlin und Trakl, Rilke, Bachmann und Benn umgibt eine Aura. Keinen deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts allerdings so sehr wie Paul Celan. Wer sich einen Namen machen will, der schreibt gern etwas über einen Autor mit Aura. Da hatte der französische Schriftsteller Jean Daive großes Glück, als er Celan in Paris kennen lernte, sein Freund und Übersetzer wurde. Das vorliegende Büchlein, aus dem Französischen übersetzt, befasst sich mit Celan, mit seiner Frau, seiner Wohnung, seinem Alltag, seinem Verschwinden. Die Beerdigung wird en passant erwähnt. Daives Stil könnte man als Hystero-Eklektizismus beschreiben: hier eine Episode, dort ein Stichwort, irgendein Straßenname, ein Einfall, ein vom Himmel gefallenes "Mmmm", Montage ohne Sinn. Eine anstrengende, kokette Lektüre. Es handelt sich um die Zweitverwertung der Aura eines toten Dichters. Hat Celan es verdient, als Folie für die Selbstdarstellung eines geistigen Flaneurs zu fungieren?
Albrecht von Lucke: Die gefährdete Republik – Von Bonn nach Berlin. 1949 – 1989 – 2009
Wagenbach Verlag
Ist sie wirklich gefährdet, unsere Republik? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke befürchtet das. Im Untertitel seines Buches "Von Bonn nach Berlin" verweist er auf die Unterschiede, die er im Sinn hat, wenn er die Zeit vor und nach der Wiedervereinigung vergleicht. Luckes Urteil, Bonn sei nicht zuletzt wegen der sozialen Marktwirtschaft demokratisch stabiler gewesen als Berlin – stimmt das? Er fragt auch: Gibt es die Bundesrepublik noch oder gibt es nur noch Deutschland? Und meint: Der eigentliche Grund für das Verschwinden der Metapher von der Berliner Republik sei die emphatische Rückkehr Deutschlands. Ein Nationaldiskurs sei inzwischen scheinbar normal geworden. Was, darf man wohl sagen, wohl nichts grundsätzlich Falsches ist. Man legt das kleine Buch etwas ratlos aus der Hand. Auch wenn man durchaus bereit ist, eine Krise der Demokratie zu konstatieren, leuchten die Deutungen des Autors nicht immer ein. Und dass die Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern nicht gut funktioniert, wissen wir schon länger. Wo aber die Analyse nicht schlüssig ist, bleiben Denkanstöße für die Zukunft aus.
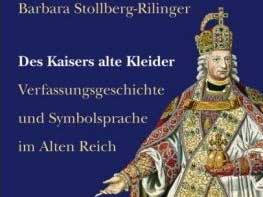
Cover von Barbara Stollberg-Rilingers "Des Kaisers alte Kleider"© Verlag C.H. Beck
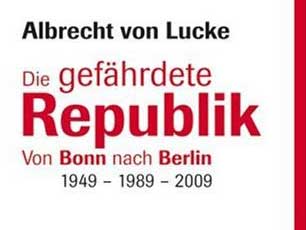
Cover von Albrecht von Luckes "Die gefährdete Republik"© Wagenbach Verlag
