Kurz und Kritisch
Grausamkeit, Sicherheitswahn, völkische Archäologie - drei Bücher: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts von Henning Ritter, "Gesellschaft in Angst" diagnostiziert Politikwissenschaftler Johano Strasser und ein Bildband zum Thema Archäologie unterm Hakenkreuz.
"Man tötet sich en gros, man tötet sich en détail" - so resümiert der Augenzeuge Henri Dunant die Schlacht von Solferino. Vierzigtausend Soldaten fallen alleine an diesem Junitag 1859, ebenso viele Verwundete sterben innerhalb der darauf folgenden Woche. Daraufhin wird die Genfer Konvention verabschiedet.
Die Schreie der Verwundeten hatten Mitleid mobilisiert. Wie nie zuvor reagierten Menschen auf Grausamkeit, Leid und Elend mit Solidarität und Mitleid. Dieses enge Verhältnis untersucht der vor wenigen Wochen verstorbene Journalist und Autor Henning Ritter in seinem letzten Buch. In sechs brillant gedachten, auch für sich selbst stehenden Kapiteln durchleuchtet er die Phänomene Mitleid und Grausamkeit nicht aus psychologischer, sondern moralphilosophischer Sicht. Der Revolutionär Robespierre erscheint ihm dabei als erster Repräsentant einer neuen Grausamkeit: als "Schreibtischtäter", der Pflicht statt Leidenschaft empfindet, der morden lässt, ohne gar Vergnügen an Grausamkeit zu finden.
Durch elegant formulierte Reflexionen zu Standpunkten des Historikers Michelet, des Staatsrechtlers Alexis de Tocqueville, Schopenhauers und Darwins entwickelt Henning Ritter seine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sie führt die Paarbildung von Ethik und Barbarei vor. Und weist unaufdringlich, doch deutlich bis in die Gegenwart.
Die Schreie der Verwundeten hatten Mitleid mobilisiert. Wie nie zuvor reagierten Menschen auf Grausamkeit, Leid und Elend mit Solidarität und Mitleid. Dieses enge Verhältnis untersucht der vor wenigen Wochen verstorbene Journalist und Autor Henning Ritter in seinem letzten Buch. In sechs brillant gedachten, auch für sich selbst stehenden Kapiteln durchleuchtet er die Phänomene Mitleid und Grausamkeit nicht aus psychologischer, sondern moralphilosophischer Sicht. Der Revolutionär Robespierre erscheint ihm dabei als erster Repräsentant einer neuen Grausamkeit: als "Schreibtischtäter", der Pflicht statt Leidenschaft empfindet, der morden lässt, ohne gar Vergnügen an Grausamkeit zu finden.
Durch elegant formulierte Reflexionen zu Standpunkten des Historikers Michelet, des Staatsrechtlers Alexis de Tocqueville, Schopenhauers und Darwins entwickelt Henning Ritter seine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sie führt die Paarbildung von Ethik und Barbarei vor. Und weist unaufdringlich, doch deutlich bis in die Gegenwart.
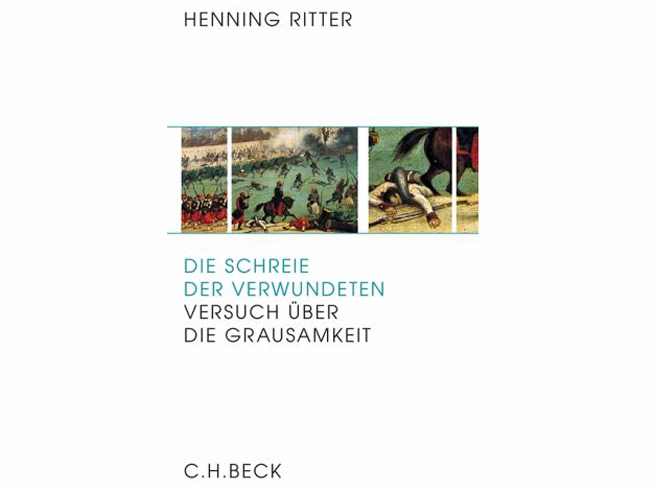
Cover: Henning Ritter - Die Schreie der Verwundeten (C.H. Beck)© C.H. Beck
"Die Schreie der Verwundeten. Versuch über die Grausamkeit", von Henning Ritter. Verlag C.H. Beck. 189 Seiten, 19,95 Euro, als Ebook 15,99 Euro.
Vor was und wem haben wir nicht alles Angst: vor dem allzu bärtigen Mann in der U-Bahn, vor dem Zigarettenrauch am Nebentisch, vor dem Salz im Essen, vor der Unsicherheit am Arbeitsplatz. Und was tun wir? Statt uns auf Gemeinsinn und gesellschaftliche Solidarität zu besinnen, erfinden wir Kontrollmechanismen und technische Lösungsversuche, die unsere Angst nur weiter steigern: Videokameras, Rauchverbote und Body Mass Index.
Eine "Gesellschaft in Angst" diagnostiziert der Schriftsteller, Philosoph und Politikwissenschaftler Johano Strasser. Und er fragt: Macht Freiheit Angst? Und antwortet selbst: Die Unsicherheit gehöre notwendig und unabänderlich zum Leben eines freien Menschen. Aus dem Traum von absoluter Sicherheit sollten wir baldigst erwachen, mahnt Strasser, wenn wir unsere Humanität ernst nehmen.
Nicht alle Gedanken in diesem Plädoyer für eine "Entängstlichung" der Gesellschaft sind neu, wie etwa der Abgesang auf eine beinahe religiöse Neoliberalität. Doch verbindet Strasser all seine Versatzstücke überaus einleuchtend, zieht kluge Schlüsse, und am Ende dieses Bandes ist es sehr plausibel, warum ein wenig Leichtsinn oft besser wäre.
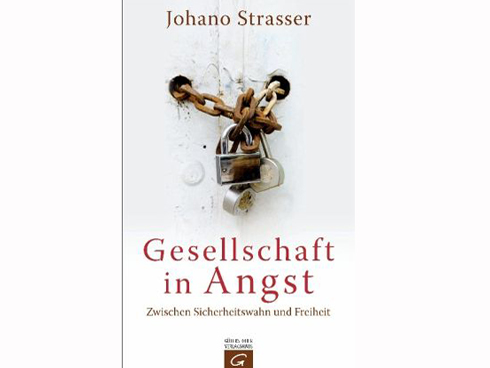
Cover: Johano Strasser "Gesellschaft in Angst" (Gütersloher Verlagshaus)© Gütersloher Verlagshaus
"Gesellschaft in Angst. Zwischen Sicherheitswahn und Freiheit", von Johano Strasser. Gütersloher Verlagshaus. 220 Seiten, 19,99 Euro. Als Ebook 15,99 Euro.
Über die Germanen wurde und wird viel geschrieben und viel geredet. Doch nur wenig davon können Archäologen wissenschaftlich bestätigen. Auch der römische Historiker Tacitus, der oft als Quelle herhalten muss, wusste nichts einmal, ob die Germanen jenseits von Rhein und Donau ein oder mehrere Völker bildeten.
Doch die Deutschen stellten sich die Germanen schon seit dem 15 Jahrhundert als Jahrtausende altes, reinrassiges Kulturvolk Mitteleuropas vor, vom dem sie selbst in direkter Linie abstammen würden.
Diese völkische Sicht wurde im 19. Jahrhundert zunehmend ideologisch und antisemitisch aufgeladen, später von den Nationalsozialisten zur Propaganda genutzt. Sie ermöglichten der Archäologie, zu einer wissenschaftlichen Disziplin aufzusteigen. Und die Forscher ließen sich korrumpieren. Sie huldigten mit falschen Erkenntnissen einem Germanenmythos, der bis in die heutigen Tage sein Unwesen mit Nichtwissen treibt.
Eine Bremer Sonderausstellung zeichnet diesen Weg durchaus auch in eigener kritischer Sache nach und dokumentiert ihn in einem empfehlenswerten Bildband.
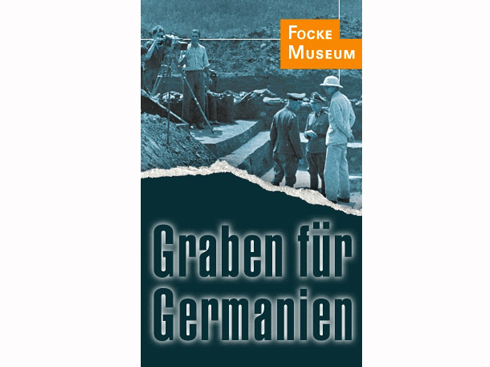
Cover: Focke-Museum (Hrsg.): Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz (Konrad Theiss Verlag Stuttgart)© Konrad Theiss Verlag Stuttgart
"Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz" - ein Ausstellungskatalog des Bremer Focke-Museums. Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 192 Seiten, 29,95 Euro.
