Kurz und kritisch
Stefan Zimmer zeigt ein vielschichtiges Bild der Kelten auf. Bernhard Maier nimmt die Leser auf eine archäologische Reise durch die frühe europäische Geschichte mit. Franco Cardini stellt die Vielfalt der mittelalterlichen Welt dar.
Stefan Zimmer: Die Kelten
Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 240 Seiten, 14,95 Euro
Die französische Comic-Serie Asterix scheint ebenso typisch zu sein, wie es die Kommentare des römischen Feldherrn Julius Cäsar oder die Berichte griechischer Autoren der Antike sind. Sie haben die Kelten in der Nachwelt bekannt und populär gemacht, aber selten wurde über sie unvoreingenommen oder gar historisch korrekt geschrieben - auch, weil von der mitteleuropäischen Völkerfamilie keinerlei Schrifttum aus eigener Feder überliefert ist.
Keltologen wie Stefan Zimmer müssen sich an Ausgrabungen halten, Sprache und Traditionen aus der Bretagne, Wales, Schottland und Irland zurückverfolgen, um sich ein Bild von der Lebensweise der frühen keltischen Familien zu machen, um festzustellen, dass diese zum indogermanischen Kulturkreis gehörten, ein verwandtes, ausgeprägtes Rechtssystem besaßen.
Es ist detektivische Forscherarbeit, die der Bonner Professor und seine Wissenschaftlerkollegen den Legenden entgegensetzen. Die Deutschen, beobachten sie, interessiere mehr die Folklore, während von Iren, Briten, Franzosen und Schweizern das keltische Erbe als Nationalgeschichte angesehen werde.
Bernhard Maier: Geschichte und Kultur der Kelten
C. H. Beck Verlag München, 384 Seiten, 68 Euro
Wieder und wieder muss auch Bernhard Maier nüchtern feststellen, dass Quellen nicht ausreichend hergeben, was Forscher gern über die Kelten wissen möchten. Und verweist auf ein methodisches Problem interdisziplinären Arbeitens, das entstehe, weil Archäologen, Ethnographen und Sprachwissenschaftler Funde auf verschiedene Weise erschließen und auswerten würden. Er selbst ist Religionswissenschaftler an der Universität Tübingen.
Ein zweites Problem ist es, der überlieferten Sekundärliteratur plausible Hinweise zu entnehmen und sie von römischen oder griechischen Vorurteile zu trennen, die jene fremden Kelten als unzivilisierte, kriegerische Menschen fürchteten oder verachteten.
Über die vielen regionalen Kulturen wisse die Forschung noch am meisten, so Bernhard Maier, weniger über Wohnen und Güteraustausch, noch weniger über Gesellschaftsordnung und Religion. Und doch nimmt er die Leser auf eine archäologische Reise durch die frühe europäische Geschichte mit.
Franco Cardini: Das Mittelalter
Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 288 Seiten, 29,95 Euro
Das Mittelalter hat mit der Kultur der Kelten gemein, dass beide von der Nachwelt gern vereinnahmt, schlimmer noch, eigenwillig interpretiert werden. So geißelten selbst mittelalterliche Zeitgenossen Verfall, Barbarei und Dekadenz - eine Polemik, die zu Allgemeingut geworden zu sein scheint. Man dürfe aber nicht, wendet Franco Cardini ein, undifferenziert über zehn Jahrhunderte vom Ende des weströmischen Reiches bis zur Entdeckung Amerikas urteilen.
Die europäisch-mediterane Region erlebte beispielsweise zweimal Mal, dass sich das Klima einschneidend veränderte, mal den Wohlstand förderte, mal ihn schmälerte. Auch nahm Europa in dieser Epoche seine heutige Gestalt an – mit einer muslimisch-byzantinischen, germanisch-christlichen und einer skandinavischen Welt.
Gleichbleibend aktuell war vielleicht der Streit um Religion und Kirchenreform. Anhand solcher Stichworte erzählt der Florentiner Professor von der Vielfalt der Geschichte im Adel wie im Stadtleben oder im Handel, in der Kunst und in der Wissenschaft.
Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 240 Seiten, 14,95 Euro
Die französische Comic-Serie Asterix scheint ebenso typisch zu sein, wie es die Kommentare des römischen Feldherrn Julius Cäsar oder die Berichte griechischer Autoren der Antike sind. Sie haben die Kelten in der Nachwelt bekannt und populär gemacht, aber selten wurde über sie unvoreingenommen oder gar historisch korrekt geschrieben - auch, weil von der mitteleuropäischen Völkerfamilie keinerlei Schrifttum aus eigener Feder überliefert ist.
Keltologen wie Stefan Zimmer müssen sich an Ausgrabungen halten, Sprache und Traditionen aus der Bretagne, Wales, Schottland und Irland zurückverfolgen, um sich ein Bild von der Lebensweise der frühen keltischen Familien zu machen, um festzustellen, dass diese zum indogermanischen Kulturkreis gehörten, ein verwandtes, ausgeprägtes Rechtssystem besaßen.
Es ist detektivische Forscherarbeit, die der Bonner Professor und seine Wissenschaftlerkollegen den Legenden entgegensetzen. Die Deutschen, beobachten sie, interessiere mehr die Folklore, während von Iren, Briten, Franzosen und Schweizern das keltische Erbe als Nationalgeschichte angesehen werde.
Bernhard Maier: Geschichte und Kultur der Kelten
C. H. Beck Verlag München, 384 Seiten, 68 Euro
Wieder und wieder muss auch Bernhard Maier nüchtern feststellen, dass Quellen nicht ausreichend hergeben, was Forscher gern über die Kelten wissen möchten. Und verweist auf ein methodisches Problem interdisziplinären Arbeitens, das entstehe, weil Archäologen, Ethnographen und Sprachwissenschaftler Funde auf verschiedene Weise erschließen und auswerten würden. Er selbst ist Religionswissenschaftler an der Universität Tübingen.
Ein zweites Problem ist es, der überlieferten Sekundärliteratur plausible Hinweise zu entnehmen und sie von römischen oder griechischen Vorurteile zu trennen, die jene fremden Kelten als unzivilisierte, kriegerische Menschen fürchteten oder verachteten.
Über die vielen regionalen Kulturen wisse die Forschung noch am meisten, so Bernhard Maier, weniger über Wohnen und Güteraustausch, noch weniger über Gesellschaftsordnung und Religion. Und doch nimmt er die Leser auf eine archäologische Reise durch die frühe europäische Geschichte mit.
Franco Cardini: Das Mittelalter
Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 288 Seiten, 29,95 Euro
Das Mittelalter hat mit der Kultur der Kelten gemein, dass beide von der Nachwelt gern vereinnahmt, schlimmer noch, eigenwillig interpretiert werden. So geißelten selbst mittelalterliche Zeitgenossen Verfall, Barbarei und Dekadenz - eine Polemik, die zu Allgemeingut geworden zu sein scheint. Man dürfe aber nicht, wendet Franco Cardini ein, undifferenziert über zehn Jahrhunderte vom Ende des weströmischen Reiches bis zur Entdeckung Amerikas urteilen.
Die europäisch-mediterane Region erlebte beispielsweise zweimal Mal, dass sich das Klima einschneidend veränderte, mal den Wohlstand förderte, mal ihn schmälerte. Auch nahm Europa in dieser Epoche seine heutige Gestalt an – mit einer muslimisch-byzantinischen, germanisch-christlichen und einer skandinavischen Welt.
Gleichbleibend aktuell war vielleicht der Streit um Religion und Kirchenreform. Anhand solcher Stichworte erzählt der Florentiner Professor von der Vielfalt der Geschichte im Adel wie im Stadtleben oder im Handel, in der Kunst und in der Wissenschaft.
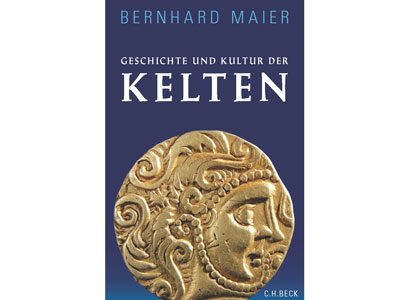
Cover: "Bernhard Maier: Geschichte und Kultur der Kelten"© C. H. Beck Verlag
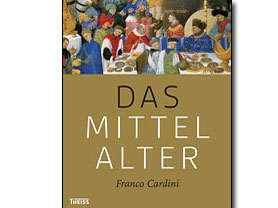
Cover: "Franco Cardini: Das Mittelalter"© Konrad Theiss Verlag
