Kooperation statt Krieg
Nach Ansicht des amerikanischen Journalisten Fareed Zakaria ist Amerika zwar noch die einzige militärische Supermacht, aber in den Bereichen Wirtschaft, Finanzmärkte, Bildungswesen, Soziales, Kultur hätten sich die Machtverhältnisse verschoben. Amerika müsse eine neue Rolle in der Welt einnehmen, in der es vermehrt um Konsultationen, Kooperation und Kompromisse geht.
In der Krise haben Bücher und Prognosen über die Zukunft Konjunktur. Das Thema liegt gleichsam in der Luft, verlockt aber auch zu mehr oder weniger spekulativen Höhenflügen. Fareed Zakaria, der Buchautor und Chefredakteur der politischen Zeitschrift "Newsweek International" stammt aus Indien und lebt seit seinem 18. Lebensjahr in den Vereinigten Staaten. Seine Herkunft, seine politische und intellektuelle Prägung sind eine gute Voraussetzung, um ein Buch zu schreiben über den "Aufstieg der Anderen" bzw. "Das postamerikanische Zeitalter", wie es im Untertitel heißt.
Zakarias Blick auf Amerika ist skeptisch, aber nicht alarmistisch geprägt. Er erweckt nicht den Eindruck, in erst kommende Abgründe zu blicken, sondern argumentiert sachlich, realistisch und auf der Basis belastbarer ökonomischer Fakten, wenn er zum Beispiel feststellt:
"Seit den frühen 80er Jahren verbrauchten die Amerikaner mehr, als sie produzierten - und sie schlossen die Lücke, indem sie Kredite aufnahmen."
Das unterlegt er mit dem Hinweis, dass die Verschuldung der amerikanischen Haushalte von 680 Milliarden Dollar im Jahr 1974 auf unvorstellbare 14 Billionen im Jahr 2008 gestiegen sind. Der durchschnittliche amerikanische Haushalt verfügt über 13 Kreditkarten und 120.000 Dollar Schulden. Und die amerikanische Regierung handelt nicht anders: Sie finanziert die rund 10 Billionen Schulden - das ist eine 1 mit zehn Nullen -, in dem sie Schatzwechsel ausstellt, die vorwiegend Staatsbanken aus China und aus den arabischen Ölstaaten aufkaufen.
Der Autor warnt aber davor, jetzt das Lied vom amerikanischen Niedergang anzustimmen, der sektoral unbestreitbar, aber kein unaufhaltsamer Trend ist. Zakaria interessiert viel mehr der Aufstieg der anderen Staaten. Der verdankt sich nicht einer aggressiven Politik gegen die USA, sondern vielmehr der Anpassung bei der Öffnung von Märkten und bei der Deregulierung ihrer Wirtschaften.
Die größte Herausforderung für die amerikanische Hegemonie stellt China dar. Seit dem Modernisierungskurs, den die chinesische Führung 1978 unter Deng Xiaoping einführte, wächst die chinesische Volkswirtschaft um durchschnittlich neun Prozent pro Jahr. Das Durchschnittseinkommen wurde versiebenfacht und die Zahl der Armen sank um 400 Millionen. Heute liegt das chinesische Exportvolumen eines einzigen Tages höher als vor 30 Jahren das eines ganzen Jahres. Zwei Drittel der weltweit verkauften Fotokopierer, Mikrowellenherde, DVD-Spieler und Schuhe werden in China hergestellt.
Die chinesische Herausforderung hat freilich nicht militärisch-politischen, sondern wirtschaftlichen Charakter. Zakaria betont,
" ... dass China sorgsam darauf bedacht ist, sich nicht aufzuplustern, während es mit voller Kraft vorwärts stürmt. Der Weg zur Macht führt über Märkte, nicht über Imperien."
Und an anderer Stelle heißt es:
"Auf politisch-militärischer Ebene befinden wir uns weiterhin in einer Welt mit einer einzigen Supermacht. Aber in allen anderen Bereichen - Wirtschaft, Finanzmärkte, Bildungswesen, Soziales, Kultur - verschieben sich die Machtverhältnisse, und zwar weg von der amerikanischen Vorherrschaft."
Mit dieser Machtverschiebung auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet werden die Vereinigten Staaten - so die These des Autors - aus eigner Kraft und mit der Konzentration auf die eigenen Stärken zurechtkommen. Die amerikanische Volkswirtschaft ist nach wie vor wettbewerbsfähig und innovativ und erbringt seit 125 Jahren mit fünf Prozent der Weltbevölkerung durchschnittlich 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung.
Geändert hat sich jedoch, dass nach dem Fall der Mauer, dem Untergang der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Öffnung Chinas weltweit kapitalistisch gehandelt wird und alle Marktteilnehmer gewinnen wollen. Dramatisch ist das nicht, denn die gegenseitigen Abhängigkeiten sind sozusagen ein Garant für die friedliche Entwicklung:
"China braucht den amerikanischen Markt, um seine Waren abzusetzen, die Vereinigten Staaten brauchen China, um ihre Schulden zu finanzieren - dies ist im Zeitalter der Globalisierung gewissermaßen das Pendant zur sicheren gegenseitigen Vernichtung des Atomzeitalters."
Politisch und militärisch dagegen werden die USA ihren Einfluss nur erhalten können, wenn sie dazu bereit sind, am Aufbau einer neuen globalen Ordnung mitzuarbeiten und sich selbst an deren Regeln zu halten. Denn die neue Rolle
" ... unterscheidet sich grundlegend von der traditionellen Supermachtsrolle. Sie ist mit Konsultationen, Kooperation und sogar Kompromissen verbunden. Macht wächst hier aus der Fähigkeit, die Tagesordnung festzulegen, Themen zu definieren und Koalitionen zu mobilisieren. Es geht nicht um eine Hierarchie von oben nach unten."
Im Unterschied zur Regierung haben große amerikanische Konzerne diese Lektion gelernt. Sie übernehmen nicht blind Betriebe in der ganzen Welt, sondern suchen Wege der Kooperationen und Beteiligungen sowie der Arbeitsteilung - etwa auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren.
Demgegenüber glich schon "das selbstherrliche Auftreten" der Bush-Regierung einem Landemanöver im Feindesland: Der Präsident brachte bei seinen Besuchen meistens rund 2000 Mann Begleitung mit, die ganze Stadtteile und Städte förmlich besetzten.
Zakaria unterlegt seine Thesen nicht nur mit ökonomischen Daten, sondern auch mit historischen Vergleichen etwa zwischen dem Niedergang des britischen Empire und den Problemen der amerikanischen Weltmacht oder des rasanten Aufstiegs des Deutschen Reiches zur europäischen Großmacht zwischen 1870 und 1914 und dem selbst verursachten Absturz wegen der überheblichen Provokation des Ersten Weltkriegs. Auch beim Vergleich der lange währenden Stagnation Chinas und Indiens und der fast explosiven Entwicklung in den letzten Jahren stützt sich Zakaria auf profunde Kenntnisse beider Länder.
Trotz der über weite Strecken überzeugenden Argumentation bleiben einige Vorbehalte gegenüber dem gut lesbaren Buch. Erstens sieht Zakaria vieles etwas zu rosig. Dass Indien rundum "demokratisch" und Afrika - so wörtlich - "zu zwei Dritteln demokratisch" sei, darf man ebenso bezweifeln wie die absolut minimale Rolle, die Zakaria Afrika im Prozess der Globalisierung zuweist.
Die These, die Vereinigten Staaten seien "die erste universelle Nation", weil sie Menschen aus allen Ländern zu Amerikanern mache und sozial integriere, ja assimiliere, während alle europäischen Staaten schon an der sozialen Integration scheitern würden, verniedlicht die erheblichen Integrations-Defizite in den USA und dramatisiert jene in den EU-Staaten.
Irritierend schließlich ist bei einem Autor, der auf die Differenzierung und Vielschichtigkeit von Problemen bedacht ist, ein ziemlich häufiger und fataler Hang zu Klischees von der Stange:
"D i e Amerikaner mögen Größe". "D i e Europäer bevorzugen Komplexität." "D i e Inder beurteilen Amerika äußerst positiv."
Schade, denn solche Sätze liegen unter dem Niveau des Autors.
Fareed Zakaria: Der Aufstieg der Anderen
Das postamerikanische Zeitalter
Aus dem Amerikanischen von Thorsten Schmidt
Siedler Verlag, München 2009
Zakarias Blick auf Amerika ist skeptisch, aber nicht alarmistisch geprägt. Er erweckt nicht den Eindruck, in erst kommende Abgründe zu blicken, sondern argumentiert sachlich, realistisch und auf der Basis belastbarer ökonomischer Fakten, wenn er zum Beispiel feststellt:
"Seit den frühen 80er Jahren verbrauchten die Amerikaner mehr, als sie produzierten - und sie schlossen die Lücke, indem sie Kredite aufnahmen."
Das unterlegt er mit dem Hinweis, dass die Verschuldung der amerikanischen Haushalte von 680 Milliarden Dollar im Jahr 1974 auf unvorstellbare 14 Billionen im Jahr 2008 gestiegen sind. Der durchschnittliche amerikanische Haushalt verfügt über 13 Kreditkarten und 120.000 Dollar Schulden. Und die amerikanische Regierung handelt nicht anders: Sie finanziert die rund 10 Billionen Schulden - das ist eine 1 mit zehn Nullen -, in dem sie Schatzwechsel ausstellt, die vorwiegend Staatsbanken aus China und aus den arabischen Ölstaaten aufkaufen.
Der Autor warnt aber davor, jetzt das Lied vom amerikanischen Niedergang anzustimmen, der sektoral unbestreitbar, aber kein unaufhaltsamer Trend ist. Zakaria interessiert viel mehr der Aufstieg der anderen Staaten. Der verdankt sich nicht einer aggressiven Politik gegen die USA, sondern vielmehr der Anpassung bei der Öffnung von Märkten und bei der Deregulierung ihrer Wirtschaften.
Die größte Herausforderung für die amerikanische Hegemonie stellt China dar. Seit dem Modernisierungskurs, den die chinesische Führung 1978 unter Deng Xiaoping einführte, wächst die chinesische Volkswirtschaft um durchschnittlich neun Prozent pro Jahr. Das Durchschnittseinkommen wurde versiebenfacht und die Zahl der Armen sank um 400 Millionen. Heute liegt das chinesische Exportvolumen eines einzigen Tages höher als vor 30 Jahren das eines ganzen Jahres. Zwei Drittel der weltweit verkauften Fotokopierer, Mikrowellenherde, DVD-Spieler und Schuhe werden in China hergestellt.
Die chinesische Herausforderung hat freilich nicht militärisch-politischen, sondern wirtschaftlichen Charakter. Zakaria betont,
" ... dass China sorgsam darauf bedacht ist, sich nicht aufzuplustern, während es mit voller Kraft vorwärts stürmt. Der Weg zur Macht führt über Märkte, nicht über Imperien."
Und an anderer Stelle heißt es:
"Auf politisch-militärischer Ebene befinden wir uns weiterhin in einer Welt mit einer einzigen Supermacht. Aber in allen anderen Bereichen - Wirtschaft, Finanzmärkte, Bildungswesen, Soziales, Kultur - verschieben sich die Machtverhältnisse, und zwar weg von der amerikanischen Vorherrschaft."
Mit dieser Machtverschiebung auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet werden die Vereinigten Staaten - so die These des Autors - aus eigner Kraft und mit der Konzentration auf die eigenen Stärken zurechtkommen. Die amerikanische Volkswirtschaft ist nach wie vor wettbewerbsfähig und innovativ und erbringt seit 125 Jahren mit fünf Prozent der Weltbevölkerung durchschnittlich 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung.
Geändert hat sich jedoch, dass nach dem Fall der Mauer, dem Untergang der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Öffnung Chinas weltweit kapitalistisch gehandelt wird und alle Marktteilnehmer gewinnen wollen. Dramatisch ist das nicht, denn die gegenseitigen Abhängigkeiten sind sozusagen ein Garant für die friedliche Entwicklung:
"China braucht den amerikanischen Markt, um seine Waren abzusetzen, die Vereinigten Staaten brauchen China, um ihre Schulden zu finanzieren - dies ist im Zeitalter der Globalisierung gewissermaßen das Pendant zur sicheren gegenseitigen Vernichtung des Atomzeitalters."
Politisch und militärisch dagegen werden die USA ihren Einfluss nur erhalten können, wenn sie dazu bereit sind, am Aufbau einer neuen globalen Ordnung mitzuarbeiten und sich selbst an deren Regeln zu halten. Denn die neue Rolle
" ... unterscheidet sich grundlegend von der traditionellen Supermachtsrolle. Sie ist mit Konsultationen, Kooperation und sogar Kompromissen verbunden. Macht wächst hier aus der Fähigkeit, die Tagesordnung festzulegen, Themen zu definieren und Koalitionen zu mobilisieren. Es geht nicht um eine Hierarchie von oben nach unten."
Im Unterschied zur Regierung haben große amerikanische Konzerne diese Lektion gelernt. Sie übernehmen nicht blind Betriebe in der ganzen Welt, sondern suchen Wege der Kooperationen und Beteiligungen sowie der Arbeitsteilung - etwa auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren.
Demgegenüber glich schon "das selbstherrliche Auftreten" der Bush-Regierung einem Landemanöver im Feindesland: Der Präsident brachte bei seinen Besuchen meistens rund 2000 Mann Begleitung mit, die ganze Stadtteile und Städte förmlich besetzten.
Zakaria unterlegt seine Thesen nicht nur mit ökonomischen Daten, sondern auch mit historischen Vergleichen etwa zwischen dem Niedergang des britischen Empire und den Problemen der amerikanischen Weltmacht oder des rasanten Aufstiegs des Deutschen Reiches zur europäischen Großmacht zwischen 1870 und 1914 und dem selbst verursachten Absturz wegen der überheblichen Provokation des Ersten Weltkriegs. Auch beim Vergleich der lange währenden Stagnation Chinas und Indiens und der fast explosiven Entwicklung in den letzten Jahren stützt sich Zakaria auf profunde Kenntnisse beider Länder.
Trotz der über weite Strecken überzeugenden Argumentation bleiben einige Vorbehalte gegenüber dem gut lesbaren Buch. Erstens sieht Zakaria vieles etwas zu rosig. Dass Indien rundum "demokratisch" und Afrika - so wörtlich - "zu zwei Dritteln demokratisch" sei, darf man ebenso bezweifeln wie die absolut minimale Rolle, die Zakaria Afrika im Prozess der Globalisierung zuweist.
Die These, die Vereinigten Staaten seien "die erste universelle Nation", weil sie Menschen aus allen Ländern zu Amerikanern mache und sozial integriere, ja assimiliere, während alle europäischen Staaten schon an der sozialen Integration scheitern würden, verniedlicht die erheblichen Integrations-Defizite in den USA und dramatisiert jene in den EU-Staaten.
Irritierend schließlich ist bei einem Autor, der auf die Differenzierung und Vielschichtigkeit von Problemen bedacht ist, ein ziemlich häufiger und fataler Hang zu Klischees von der Stange:
"D i e Amerikaner mögen Größe". "D i e Europäer bevorzugen Komplexität." "D i e Inder beurteilen Amerika äußerst positiv."
Schade, denn solche Sätze liegen unter dem Niveau des Autors.
Fareed Zakaria: Der Aufstieg der Anderen
Das postamerikanische Zeitalter
Aus dem Amerikanischen von Thorsten Schmidt
Siedler Verlag, München 2009
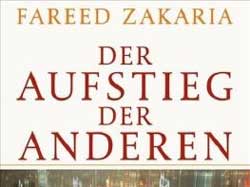
Fareed Zakaria: "Der Aufstieg der anderen" (Coverausschnitt)© Siedler Verlag
