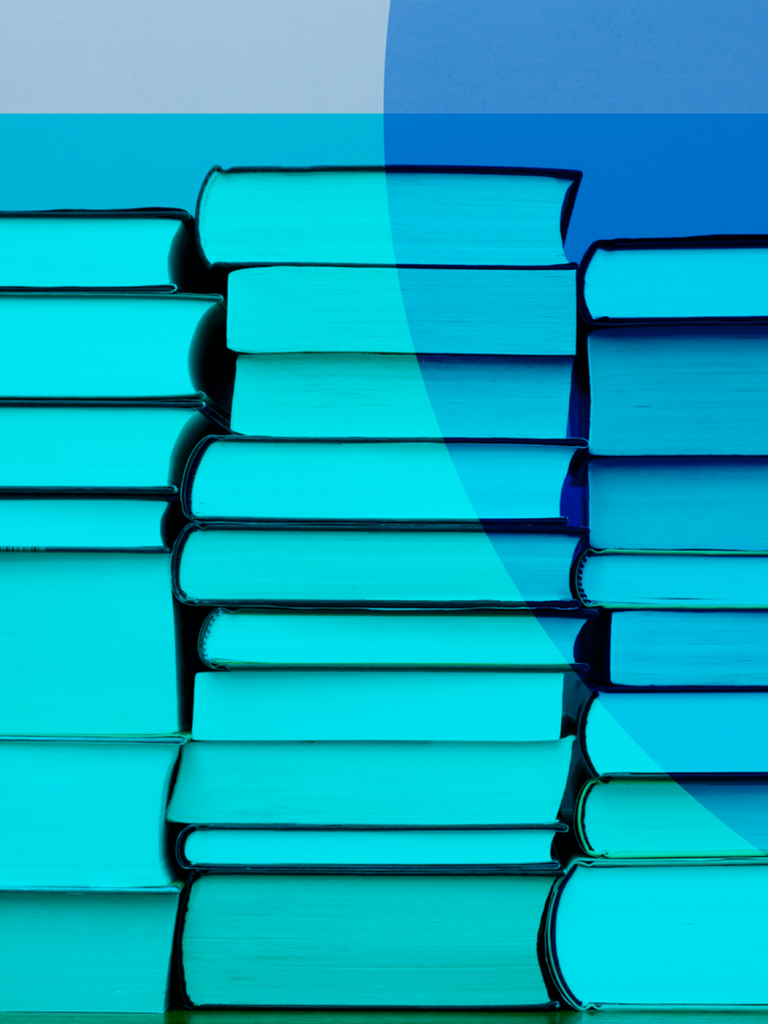Mehr Spiel- statt Parkplätze

Der ideale Spielplatz ahmt die Natur nach und ist ein Erlebnisort, an dem Kinder sich frei entfalten und ihre Grenzen testen können, sagt der Spielplatzbauer Bernhard Hanel. © picture alliance / Zoonar / Conny Pokorny
Kinder brauchen Platz zum Spielen – auch in Großstädten

Die Städte wachsen und Kindern bleibt immer weniger Raum zum gefahrlosen Spielen. Doch das Recht zum Spielen ist für ihr Wachstum bedeutsam und ein menschliches Grundbedürfnis. Kinderrechtler fordern deshalb mehr Rücksicht in der Stadtplanung.
Wer an seine Kindheit zurückdenkt, kann sich sicherlich an jenes Bild vom Spielplatz nebenan in der Nachbarschaft erinnern: Ein Kasten mit bräunlich verfärbtem Sand, eine Wippe aus morschem Holz, eine kurze Edelstahlrutsche. Auf einem Platz, der umgeben von einer Hecke ist und nicht selten verlassen erscheint.
Viele Spielplätze in Deutschland sind entweder sanierungsbedürftig, laden kaum zum Spielen ein oder sind gar nicht erst vorhanden. In der Stadtplanung wird öffentlicher Raum zum Spielen für Kinder nicht ausreichend eingeplant, kritisieren Kinderrechtsorganisationen.
Dabei ist das Recht auf Spielen in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 verankert, damit ist es leitgebend und sogar einklagbar. Doch von Bauträgern und Kommunen wird dies oft vernachlässigt.
Spielen ist menschlich
Der Dichter Friedrich Schiller schrieb über die Bedeutung der Fähigkeit zum Spielen für das menschliche Dasein überhaupt:
„Unter allen Zuständen des Menschen ist es gerade das Spiel und nur das Spiel, was ihn vollständig macht“, schrieb Schiller. Doch Platz zum Spielen gibt es in urbanen Räumen immer weniger.
Der Rückgang von frei zugänglichen Flächen für Kinder begann bereits im 19. Jahrhundert, als die Städte bedingt durch die Industrialisierung enorm wuchsen und der Autoverkehr zunahm. Damals entstanden die ersten Spielplätze, um wenigstens ein wenig Freifläche für Kinder zu erhalten. Meist wurden dafür auf freien Plätzen Sandhaufen in Kästen geschüttet und später durch Holzkonstruktionen ergänzt.
Bauträger umgehen Vorschriften, Kommunen sparen
Heute ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Bauträger beim Bau von mehr als drei Wohneinheiten eine Spielfläche schaffen müssen. Das gilt allerdings nicht für Kommunen, auch wenn die meisten Kommunen für gewöhnlich Spielräume in ihrer Stadtplanung einplanen. Da sie jedoch keine Pflicht dazu haben, kommt es vor, dass das Mitdenken von Spielplätzen und deren Instandhaltung auf der Strecke bleiben kann – gerade, wenn auf kommunaler Ebene die finanziellen Mittel fehlen.
Hinzu kommt, dass die Vorschrift oftmals umgangen wird: Viele Bauherren beantragen Ausnahmegenehmigungen und diese werden zu häufig gewährt, kritisiert Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk. In den meisten Fällen zahlen die Bauherren auch keine Entschädigung dafür, so dass dann Kommunen darauf sitzenbleiben, einen wohnortnahen Spielplatz zu schaffen.
Aber selbst wenn in den Bauunterlagen ein Spielplatz vorgesehen ist: Nach dem Abschluss eines Bauprojektes gibt es kein Verfahren, das kontrolliert, ob die Spielfläche tatsächlich dorthin gebaut wurde, wo sie eingeplant war.
„Wir haben ein großes Problem bei der Kontrolltätigkeit. Da ist noch ganz viel Luft nach oben“, sagt Claudia Neumann. Denn auch wenn ein Spielplatz fertig gebaut wurde, werde nicht überprüft, ob dieser gepflegt und Instand gehalten werde.
Diese Probleme könnte sich mit dem geplanten Bauturbo durch die Bundesregierung noch weiter verschärfen: Durch Änderungen im Bundesbaugesetz soll es ab Herbst einfacher werden, neuen Wohnraum zu schaffen. Der Antragsprozess soll verschlankt und Vorschriften möglicherweise gestrichen werden. Das Bündnis „Recht auf Spiel“ befürchtet, dass dabei das Recht von Kindern auf Spiel vernachlässigt wird.
Oasen im Großstadtdschungel
Letztendlich sind Spielplätze immer eine Art Oase inmitten des Großstadtdschungels. Dort, wo Kinder nicht in die Obstbäume des Gartens klettern oder in Wäldern Hütten bauen können, muss Ersatz her. Der trostlose Sandkasten mit einer Federwippe und einer verrosteten Rutsche bietet dagegen wenig Platz für die Fantasiewelten der Kinder.
Der Spielplatzbauer Bernhard Hanel versucht deswegen, die Natur im städtischen Umfeld nachzuahmen, mit Kletterlandschaften aus Seilen, Türmen mit Dachluken aus Glas, umgeben von großen Bäumen und grünen Büschen. Sie laden Kinder zum Hüpfen, Toben, und Balancieren ein. Bei anderen Bauvorhaben werden Kinder in die Planung mit einbezogen, denn letztendlich können sie am besten beurteilen, ob ein Spielplatz wirklich zum Spielen einlädt.
Der Schutz vor potenziellen Verletzungen ist in der Spielplatznorm DIN festgeschrieben. Hanel plädiert dafür, dass Spielplätze dennoch herausfordernd gebaut sein dürfen: Denn als Erlebnisorte sollen sie Kindern auch die Möglichkeit geben, selber zu lernen, mit Gefahren umzugehen und ihre Grenzen zu erkennen.
Weniger Autoverkehr, mehr Spielflächen
Lange Zeit wurden Städte so gebaut, dass sie vor allen Dingen den Autoverkehr begünstigten. Für Fußgänger gab und gibt es immer weniger Platz – und für spielende Kinder erst recht. Auf der Straße Federball oder Hüpfekästchen spielen ist in vielen Stadtvierteln undenkbar.
Ein grundlegender Ansatz, um mehr Spielflächen für Kinder zu schaffen, lautet deshalb: den Autoverkehr im öffentlichen Raum reduzieren.
Beispielsweise durch verkehrsberuhigte Bereiche, in denen Autos Schritttempo fahren müssen, oder sogenannte Spielstraßen. Hier ist der Verkehr komplett ausgeschlossen. Manche Städte haben außerdem damit begonnen, temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen einzuführen. Dann werden die entsprechenden Zonen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten gesperrt, Kinder und Anwohner können sich darin frei und geschützt bewegen.
Auch leicht und unkompliziert aufzustellende Spielcontainer können temporär für mehr Raum zum Spielen sorgen: Diese Container aus Holz mit Anbauten wie Rutsche, Kriechtunnel oder Balancierparcour wurden ursprünglich als Spiel- und Schutzräume für Kinder in Krisengebieten wie dem Gaza-Streifen oder der Ukraine geschaffen. Mittlerweile stehen sie auch in einigen deutschen Städten, als preiswerte Alternativen zu Spielplätzen.
Eine weitere Idee sind sogenannte Pop-Up-Spielplätze. Der Ansatz dahinter: Leerstehende Gebäude sollen vorübergehend als Spielplätze für Kinder umfunktioniert und genutzt werden.
tan