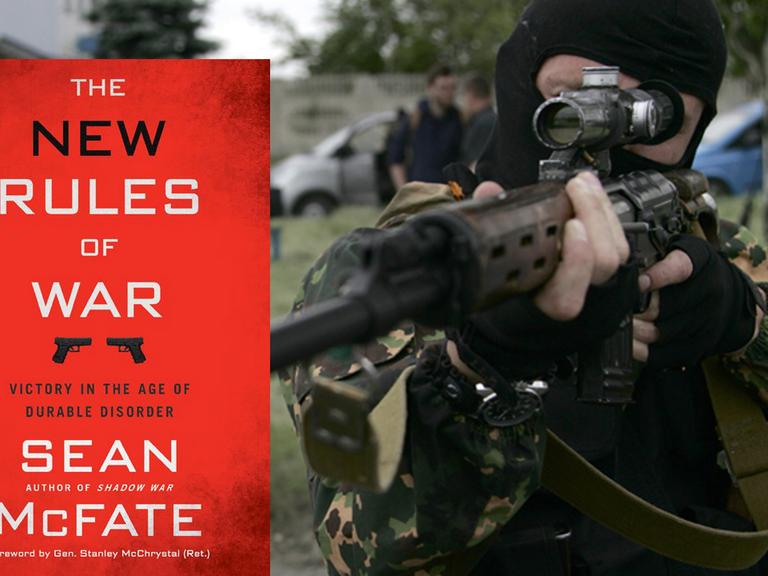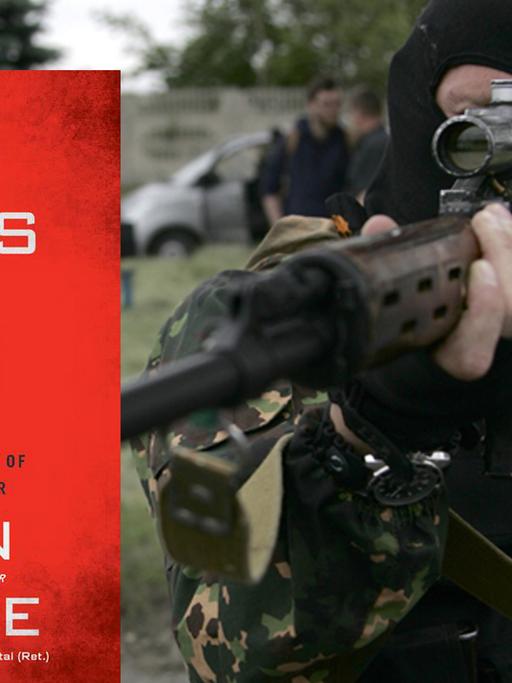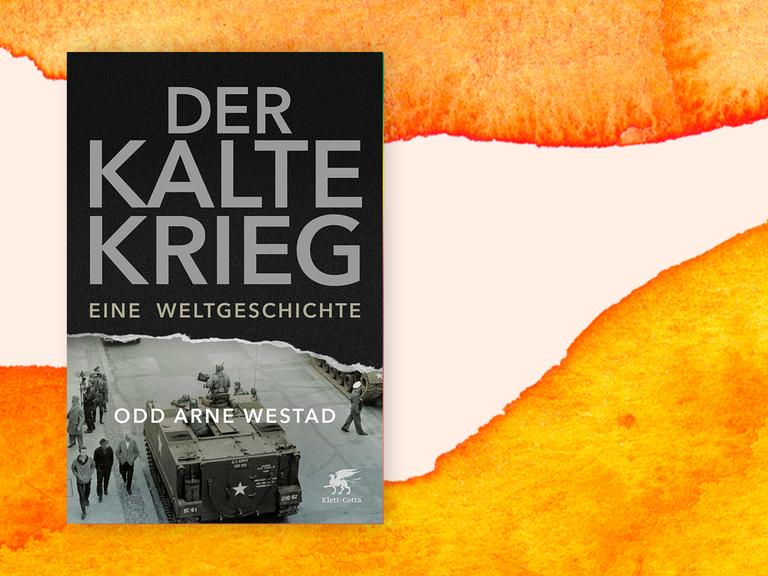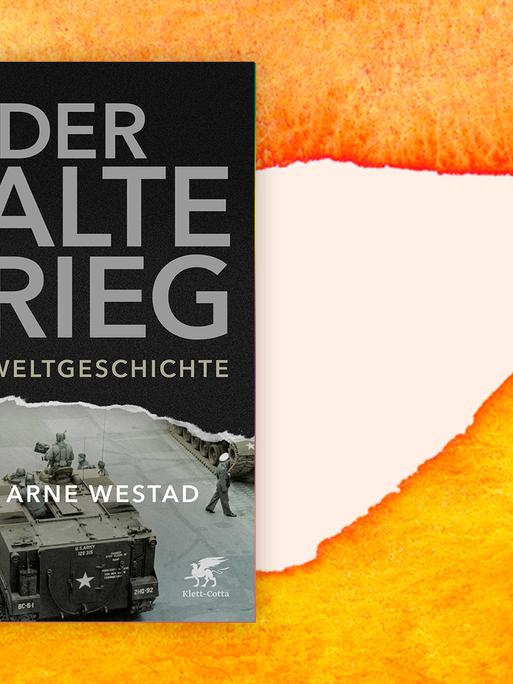John Keegan: "Die Kultur des Krieges"
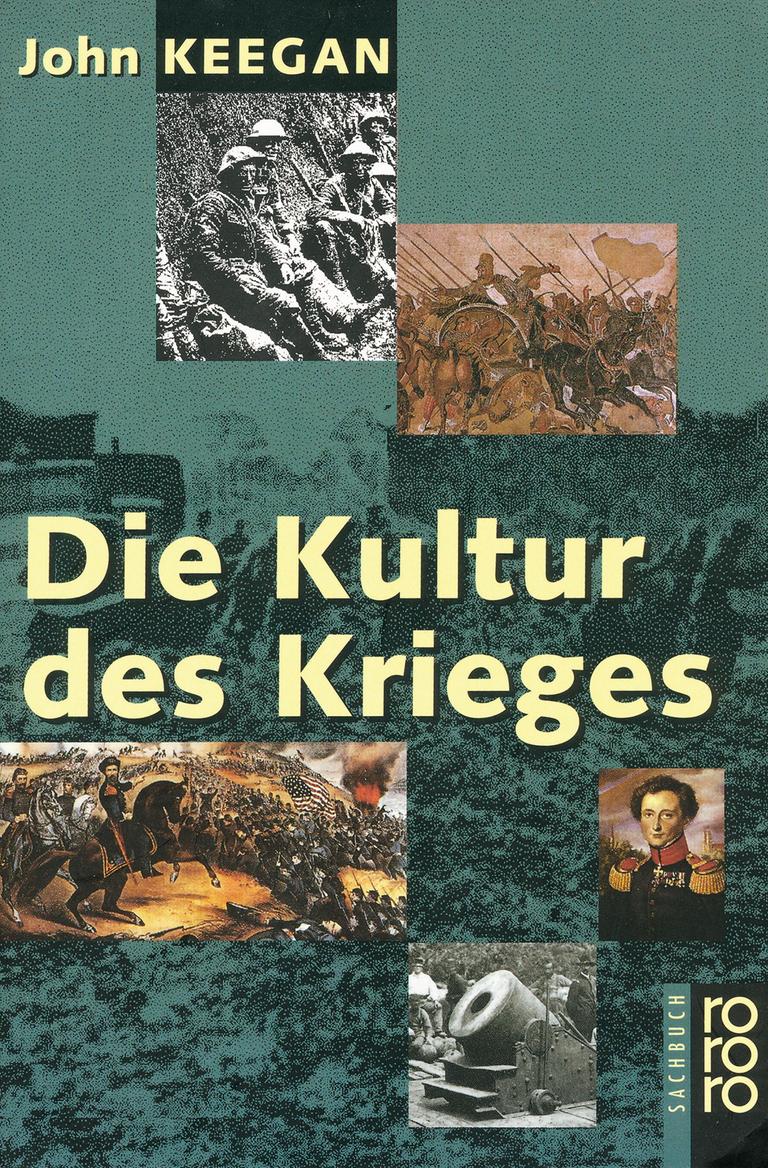
© Rowohlt
Ein Klassiker, der Clausewitz widerspricht
08:12 Minuten
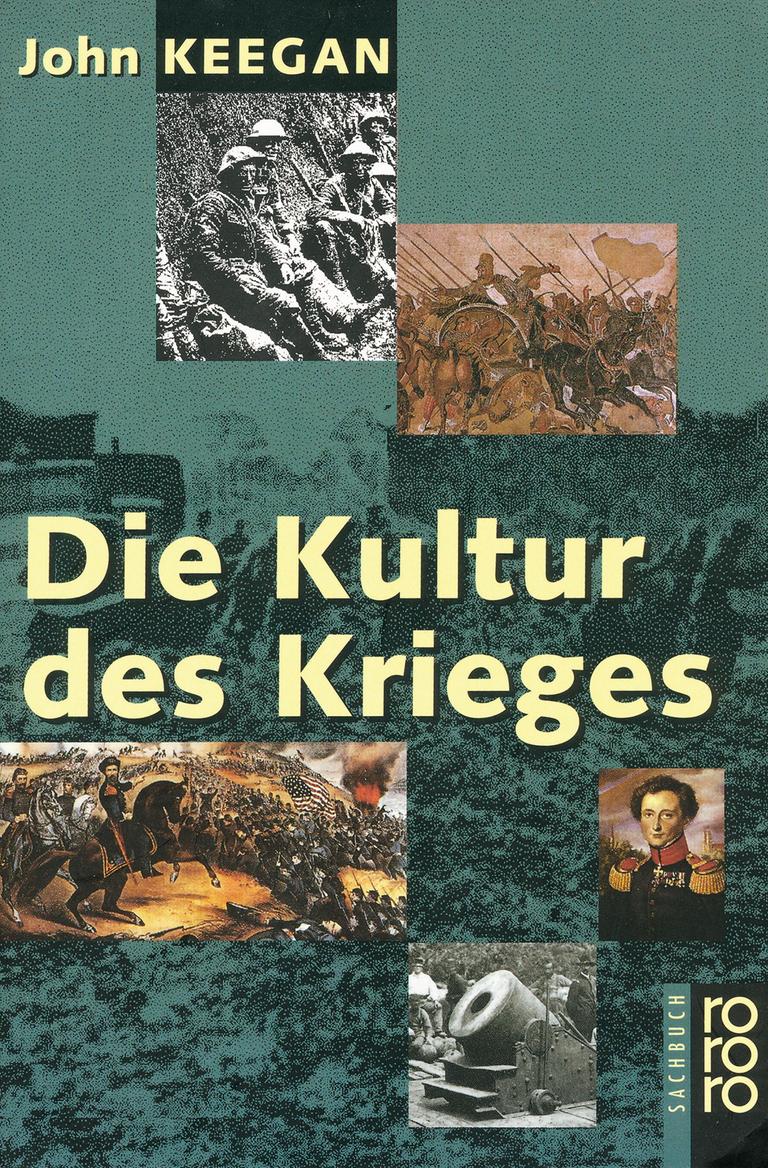
John Keegan
Aus dem Englischen von Karl A. Klewer
Die Kultur des KriegesRowohlt, Reinbek 1997592 Seiten
17,99 Euro
Fast 30 Jahre alt ist der Klassiker über das Wesen des Kriegs, den John Keegan nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschrieben hat. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine lohnt ein Blick hinein: Die Thesen des Briten scheinen unverändert aktuell.
Krieg erweise sich zu allen Zeiten als „unübersichtlich und schmutzig“. Solche eher persönliche Anmerkungen bleiben haften, eingestreut in weit über 500 Seiten über Szenen von Schlachtfeldern aus 5.000 Jahren. John Keegan erzählt von ihnen mit englischer Akkuratesse, als stünden Leser und Leserinnen mit ihm auf einem Feldherrnhügel oder in einem Briefing Room. Und doch lässt er Momente innerer Distanz aufscheinen: Er ist ein Zivilist unter Uniformträgern.
Ein Militärhistoriker ohne Uniform
Bei seiner Musterung 1952 war Keegan einer Krankheit wegen bescheinigt worden, für den Dienst in allen Waffengattungen untauglich zu sein.
Ein Militärhistoriker ohne Uniform
Bei seiner Musterung 1952 war Keegan einer Krankheit wegen bescheinigt worden, für den Dienst in allen Waffengattungen untauglich zu sein.
Seither beobachtete er den Mensch „Soldat“ unter Freunden und Kommilitonen, Lehrern und Kollegen – und wählte „tollkühn“ sein historisches Fachgebiet aus. 25 Jahre lang lehrte er an der Royal Military Academy Sandhurst Militärgeschichte.
„Kultur des Krieges“ klingt befremdlich, gar widersprüchlich. Es schwingt Positives wie Negatives mit. Genauso wollte Keegan das Begriffspaar im Titel verstanden wissen, es jedoch keinesfalls überhöhen, erforschte er doch „rituelles“ und „emotionales“ Verhalten von Menschen, die in Gruppen ihren Feinden Gewalt antun, und erkundete er doch geographische, technologische, politisch-gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Militärische Logik versus kulturelles Ethos
Der Brite widersprach dem preußischen Generalmajor und Militärstrategen Carl von Clausewitz. Krieg sei eben keine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Nicht nur, weil er älter als die Diplomatie sei, sondern weil er deren Bankrott beweise.
Er bringe ausgerechnet demjenigen Erfolg, der sich von politischer Rücksichtnahme gelöst habe, und werde am Ende nur noch um seiner selbst willen geführt. Politik, die zum Kriege führe, sei ein Übel – durch die zerstörerische Kraft „billiger Waffen“ wie hochtechnologischer Systeme, den Exportschlagern der Industrie.
Er bringe ausgerechnet demjenigen Erfolg, der sich von politischer Rücksichtnahme gelöst habe, und werde am Ende nur noch um seiner selbst willen geführt. Politik, die zum Kriege führe, sei ein Übel – durch die zerstörerische Kraft „billiger Waffen“ wie hochtechnologischer Systeme, den Exportschlagern der Industrie.
Dennoch wäre eine Welt ohne disziplinierte, gehorsame, gesetzestreue Armeen unbewohnbar, meint Keegan. Wie sie organisiert seien, sage etwas über die Gesellschaften aus, die sie geschaffen hätten. So gehöre es zur Kultur des Westens, den legitimen Waffenträger ebenso zu achten wie den Pazifisten. Erfahrungsgemäß aber werde das Beste, „Liberalismus und Hoffnung“, in Kriegszeiten zersetzt. Denn militärische Logik und kulturelles Ethos würden entgegengesetzte Wege gehen.
Zivilisierte Kriegführung hielt er gleichermaßen für trügerisch wie für zwingend. Um den Nutzen von Mäßigung, Selbstbeschränkung und Verhandeln zu erkennen, lohne es sich, die nicht nur brutalen Schlachten jener Völker zu studieren, die der Norden der Welt als „primitiv“ ansieht.
Langes Warten auf Frieden
Vor der „Kultur des Krieges“ schrieb John Keegan (1934-2012) über den „Zweiten Weltkrieg“ (1989) und danach über die „Maske des Feldherrn“ (1997), den „Ersten Weltkrieg“ (2000) sowie den „Amerikanischen Bürgerkrieg“ (2009).
Zivilisierte Kriegführung hielt er gleichermaßen für trügerisch wie für zwingend. Um den Nutzen von Mäßigung, Selbstbeschränkung und Verhandeln zu erkennen, lohne es sich, die nicht nur brutalen Schlachten jener Völker zu studieren, die der Norden der Welt als „primitiv“ ansieht.
Langes Warten auf Frieden
Vor der „Kultur des Krieges“ schrieb John Keegan (1934-2012) über den „Zweiten Weltkrieg“ (1989) und danach über die „Maske des Feldherrn“ (1997), den „Ersten Weltkrieg“ (2000) sowie den „Amerikanischen Bürgerkrieg“ (2009).
Er starb zwei Jahre, bevor Russland die Halbinsel Krim, die Regionen Donbass und Luhansk in der Ostukraine annektierte, zehn Jahre, bevor es das ganze Nachbarland angriff. Schon 1993 aber, als der Kalte Krieg gerade pausierte, sagte er voraus, dass noch lange warten müsse, wer darauf hoffe, die Vereinten Nationen würden ihre friedenserhaltenden Aufgaben erfolgreich erfüllen. Denn der Mensch sei ein potenziell gewalttätiges Wesen.