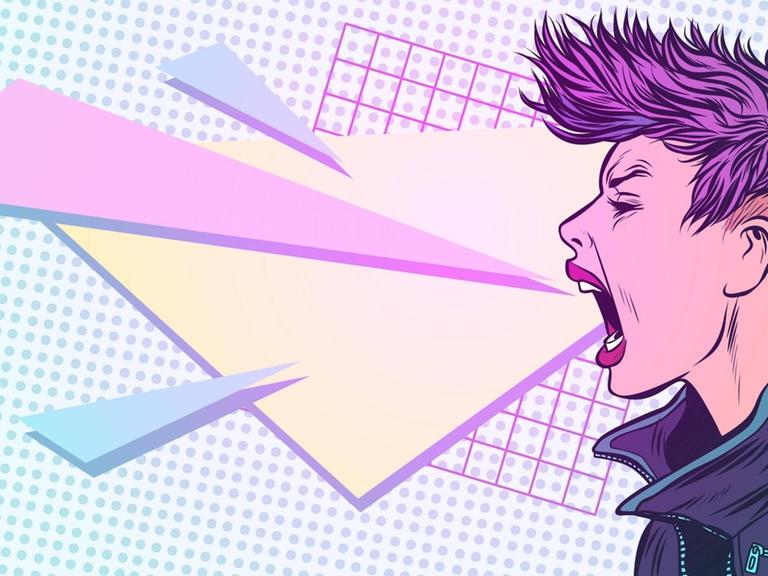Identität als Währung in der Kreativbranche
07:43 Minuten

Mit dem Modewort Diversity lassen sich längst Fördergelder akquirieren. Identität werde zur Währung, von der die eigentlich Betroffenen zu wenig profitierten, meint Ari Robey-Lawrence. Die Forderung: Weiße Europäer müssten endlich ihre Macht teilen.
Andreas Müller: Das Panel, das Sie für das DICE-Festival in Berlin erarbeitet haben, heißt "Race, Gender, and Identity Politics as a Currency: Whose is it to spend". Auf Deutsch also in etwa: Ethnie, Gender und Identitätspolitik als Währung: Wer darf sie für sich beanspruchen, damit sozusagen hausieren gehen. Ari Robey-Lawrence, inwiefern ist das, was in der Ankündigung als Race, Gender und Identity Politics beschrieben wird, zu einer Währung geworden?
Ari Robey-Lawrence: Ich denke, zunächst sollten wir festhalten, dass Race, Gender und Identität nicht nur irgendwelche Begrifflichkeiten sind. Sie definieren die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, sie definieren ihre Existenzen und Realitäten.
Ari Robey-Lawrence: Ich denke, zunächst sollten wir festhalten, dass Race, Gender und Identität nicht nur irgendwelche Begrifflichkeiten sind. Sie definieren die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, sie definieren ihre Existenzen und Realitäten.
Daraus lässt sich ableiten, dass sie zu Währungen geworden sind, insbesondere in der Kreativwirtschaft und auf der Tanzfläche. Viele nicht-weiße Menschen müssen einen Weg finden, wie sie in diesen Branchen überhaupt überleben können. Sie müssen ihr Verhalten an die Gegebenheiten dieser Branchen anpassen, im Gegensatz zu den Gatekeepern, die über ihnen wachen und die Regeln festlegen.
Das Maß, wie Race, Gender und Identitätspolitik zu einer Währung wachsen, insbesondere in der Sphäre des Tanzes, verhält sich relativ zur Anzahl von Menschen, denen man ermöglicht, sich zeigen zu können und für Sichtbarkeit zu sorgen. Denn betrachtet man Race und Gender als Form sozialen Kapitals, gibt es manche Menschen, denen es leichter gemacht wird, aufzutreten und sichtbar zu sein, als anderen. Es ist wichtig, das Thema aus dieser Perspektive zu betrachten.
Diversität als Kapital für mehr Reichweite
Müller: Sie selbst machen Musik, legen Platten auf als The Neighbourhood Character. Als queere BIPoC (Black/Indigenous/People of color, Anm. d. Red.): Haben Sie das Gefühl, Sie werden heute öfter gebucht – vielleicht auch, weil es als schick gilt, etwas mehr Diversität auf die Bühne zu bringen?
Robey-Lawrence: Jede Person, die sich selbst als nicht-weiß oder als PoC, als schwarz oder queer bezeichnet, hat ihre ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. Auf jeden Fall gibt es Organisationen und Initiativen, die Diversität als Kapital benutzen, mit dem Ziel, ihren eigenen Anliegen mehr Reichweite zu verschaffen.
Robey-Lawrence: Jede Person, die sich selbst als nicht-weiß oder als PoC, als schwarz oder queer bezeichnet, hat ihre ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. Auf jeden Fall gibt es Organisationen und Initiativen, die Diversität als Kapital benutzen, mit dem Ziel, ihren eigenen Anliegen mehr Reichweite zu verschaffen.
Meine Erfahrung ist es, dass solche Initiativen häufig von weißen Europäern oder überhaupt weißen Menschen geführt werden. Einerseits ist Diversität zu einem Schlagwort geworden. Andererseits trägt diese Tatsache nicht zwangsläufig dazu bei, dass marginalisierte Menschen Unterstützung finden. Das müssen wir berücksichtigen.
Rassismus in Form von Mikroaggressionen
Müller: Im Ankündigungstext zum Panel heißt es: "Personen aus dem Underground, aus der experimentellen Musik, würden nun ins Rampenlicht gestellt." Vielleicht geht dabei auch etwas der ehemaligen Subkultur verloren? Codes, ein Zugehörigkeitsgefühl, solche Dinge.
Robey-Lawrence: Meine persönliche Erfahrung - und ich glaube, dass es anderen, die ausgegrenzt werden, genauso ergangen ist - meine persönliche Erfahrung ist: Es gibt gar keinen Safe Space. Ganz egal, ob eine Veranstaltung von sich behauptet, inklusiv zu sein oder einen Safe Space bieten zu wollen, es gibt immer Rassismus in Form von Mikroaggressionen, Vorurteile, die auf Genderrollen oder anderen Identitätskategorien beruhen. Das sollten wir uns zunächst einmal klarmachen.
Außerdem habe ich bei KünstlerInnen, die plötzlich viel Aufmerksamkeit erfahren, beobachtet, dass das etwas verändert. Etwa, dass sich ein Künstler, der eigentlich sehr politisch ist, nicht mehr politisch äußern möchte, weil das in seiner neuen Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Es kann also sein, dass man für den Erfolg mit Schweigsamkeit bezahlt.
Und dann gibt es noch etwas: Heutzutage wird ja nahezu alles politisiert. Das führt dazu, dass das tatsächliche politische Handeln an Bedeutung verliert. Im Moment gibt es ja geradezu einen Zwang, zu allem eine politische Meinung zu haben. Aber wir müssen uns auch klarmachen, dass nichts alles immerzu politisch sein muss, nur weil man einen besonderen Hintergrund hat.
Robey-Lawrence: Meine persönliche Erfahrung - und ich glaube, dass es anderen, die ausgegrenzt werden, genauso ergangen ist - meine persönliche Erfahrung ist: Es gibt gar keinen Safe Space. Ganz egal, ob eine Veranstaltung von sich behauptet, inklusiv zu sein oder einen Safe Space bieten zu wollen, es gibt immer Rassismus in Form von Mikroaggressionen, Vorurteile, die auf Genderrollen oder anderen Identitätskategorien beruhen. Das sollten wir uns zunächst einmal klarmachen.
Außerdem habe ich bei KünstlerInnen, die plötzlich viel Aufmerksamkeit erfahren, beobachtet, dass das etwas verändert. Etwa, dass sich ein Künstler, der eigentlich sehr politisch ist, nicht mehr politisch äußern möchte, weil das in seiner neuen Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Es kann also sein, dass man für den Erfolg mit Schweigsamkeit bezahlt.
Und dann gibt es noch etwas: Heutzutage wird ja nahezu alles politisiert. Das führt dazu, dass das tatsächliche politische Handeln an Bedeutung verliert. Im Moment gibt es ja geradezu einen Zwang, zu allem eine politische Meinung zu haben. Aber wir müssen uns auch klarmachen, dass nichts alles immerzu politisch sein muss, nur weil man einen besonderen Hintergrund hat.
In der Tanzmusik-Szene haben Politik und Identitätsdiskurse einen großen Stellenwert eingenommen. In diesem Bereich lässt sich zurzeit beobachten, dass viele Organisationen, Künstlerinnen und Künstler die Nähe zu politischen Initiativen oder vermeintlich politischen Initiativen suchen. Aus dem einfachen Grund, weil das gerade ein Trend ist.
Müller: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was schlagen Sie vor: Wie kann Pop dauerhaft diverser werden?
Robey-Lawrence: Noch einmal, das Entscheidende ist: Weiße Menschen, Menschen aus Europa, Menschen in Machtpositionen müssen einen Teil ihrer Macht abgeben. Sie müssen damit aufhören, ständig das Narrativ kontrollieren zu wollen, ständig zu bestimmen, was die Medien zeigen. Sie müssen mit ihrer bisherigen Gatekeeper-Praxis in der Kreativbranche aufhören. Denn das gilt für den Mainstream genauso wie in der Alternativkultur: Die meisten Gatekeeper in der Branche sind weiße Männer. Popmusik kann erst dann besser werden, wenn manche dieser Männer bereit sind, einen Teil ihrer Macht abzugeben, weiterzureichen an Menschen, die braun, schwarz, queer sind. Das würde uns ermöglichen, unsere Geschichten zu erzählen. Dann würde unsere Rolle nicht darauf begrenzt sein, irgendwelche Stereotype der Gegenwart zu erfüllen.
Müller: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was schlagen Sie vor: Wie kann Pop dauerhaft diverser werden?
Robey-Lawrence: Noch einmal, das Entscheidende ist: Weiße Menschen, Menschen aus Europa, Menschen in Machtpositionen müssen einen Teil ihrer Macht abgeben. Sie müssen damit aufhören, ständig das Narrativ kontrollieren zu wollen, ständig zu bestimmen, was die Medien zeigen. Sie müssen mit ihrer bisherigen Gatekeeper-Praxis in der Kreativbranche aufhören. Denn das gilt für den Mainstream genauso wie in der Alternativkultur: Die meisten Gatekeeper in der Branche sind weiße Männer. Popmusik kann erst dann besser werden, wenn manche dieser Männer bereit sind, einen Teil ihrer Macht abzugeben, weiterzureichen an Menschen, die braun, schwarz, queer sind. Das würde uns ermöglichen, unsere Geschichten zu erzählen. Dann würde unsere Rolle nicht darauf begrenzt sein, irgendwelche Stereotype der Gegenwart zu erfüllen.