In der Verbannung
Um die letzte Lebensphase von Carl Schmitt geht es in Christian Linders Buch "Der Bahnhof von Finnentrop". Ins Sauerland hatte sich der als geistiger Wegbereiter der Nationalsozialisten geltende Staatsrechtler im Mai 1947 mit seiner Familie niedergelassen und den Wohnort zum "Exil" stilisiert.
"Wohin denn soll man in Deutschland fahren? Carl Schmitt ist doch der einzige, mit dem sich zu reden lohnt","
bemerkte der große Interpret Hegels, Alexandre Kojève, als er im Sommer 1967 nach Plettenberg fuhr. Dort lebte wie ein Verbannter in seiner Heimat der berühmte Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt. Sein Haus nannte er nach dem Exil Niccolò Machiavellis: San Casciano. Dieser erste "Wirklichkeitswissenschaftler" hatte sich während der raschen Systemwechsel in Florenz für die zuletzt siegreichen Medici politisch verdächtig gemacht.
Carl Schmitt war im April 1933 der NSDAP beigetreten und versuchte anschließend, dem Nationalsozialismus einen "Sinn" zu geben und ihn an Normen zu binden, ohne die keine konkrete Ordnung auskommt.
Er scheiterte damit vollkommen. Im Herbst 1936 wurde er in der Zeitschrift der SS - "Das Schwarze Korps" - als peinlicher Opportunist angegriffen, der während der Republik energisch gegen die Partei und deren Prinzipien gekämpft und die verschiedensten "Systempolitiker" beraten habe:
""Sollte es Carl Schmitt wirklich gelungen sein, einen echten Zugang zur nationalsozialistischen Wissenschaft gefunden zu haben? Wir meinen, dass Professor Carl Schmitt allen Grund hätte zu dem Ausruf: Der Herr bewahre mich vor meinen Konsequenzen."
Der charakterlose Möchte-Gern-Nationalsozialist musste seine verschiedenen Parteiämter aufgeben, behielt aber seinen Lehrstuhl. Nach dem Kriege wurde er seines Lehrstuhls enthoben. Er galt nun als peinlicher und charakterloser Wegbereiter des Nationalsozialismus und Totengräber der Weimarer Republik.
Ausgebombt in Berlin, vorübergehend in Nürnberg inhaftiert und verhört, ließ er sich ab Mai 1947 mit seiner Familie dauerhaft in Plettenberg im Sauerland nieder. Seinen von ihm zum Exil stilisierten Wohnort hat er bis zu seinem Tode 1985 höchstens für seltene Reisen verlassen.
Christian Linder, ein Journalist, der aus dem Sauerland stammt, lädt zu einer "Reise ins Carl Schmitt Land" ein mit seinem Buch: "Der Bahnhof von Finnentrop". Dort hielten die Fernzüge, die Plettenberg nicht mit der Nachbarschaft, sondern mit der Welt verbanden.
Carl Schmitt, in Plettenberg 1888 geboren, hatte häufig seinen Wohnort gewechselt, aber nie die Beziehung zu seiner Heimat verloren. Seine Familie war von der Mosel ins Sauerland gezogen und hielt immer eine enge Verbindung zu den Verwandten in Lothringen aufrecht.
Dennoch sah Carl Schmitt, der viel über das Land, über die Landnahme, die Aufteilung des Bodens und seine Nutzbarmachung und Kultivierung als ursprünglicher Grundlage jeder rechtlichen Ordnung nachgedacht hatte, im Sauerland den für ihn bestimmenden Teil der allgerechten Erde, der iustissima tellus. So nannte Vergil das Land im Gegensatz zum Meer, auf dem alles Welle ist, das Element für Piraterie, Willkür und Rechtlosigkeit.
Carl Schmitt erkannte im Sauerland aber auch ein Bild seines Charakters:
"Immer bleibt die Landschaft verhalten und in sich gekehrt. Die Berge schlafen oder warten und lassen sich durch die Sonne nicht so leicht aus ihrer Verschlossenheit herauslocken."
Er gehört zu den großen Lobrednern, ja Mythologen dieses gebirgigen Raumes, den
"aber der Atlantische Ozean mit Wolken und Nebel, Regen und Schnee überflutet und (dadurch) seine Erdstrahlung irritiert, so dass die Luft mit dauernden Spannungen des Gegensatzes von Land und Meer geladen ist"."
Dieser große, das Völkerrecht seit dem Zeitalter der Entdeckungen bestimmende Gegensatz beschäftigte ihn Zeit seines Lebens. Er hoffte immer auf eine neue globale Ordnung, die den Universalismus der One-World-Ideologie amerikanischer Provenienz durch ein Pluriversum verschiedener Großräume ersetzt. Stets zuversichtlich,
""dass die Erde immer größer bleiben wird als die Vereinigten Staaten von Amerika, und dass sie auch heute noch groß genug ist für mehrere Großräume, in denen freiheitsliebende Menschen ihre geschichtliche, wirtschaftliche und geistige Substanz und Eigenart zu wahren und zu verteidigen wissen"."
In den Bergen an der Lenne gewann er seinen ihm eigenen Raum:
""Die Zeit fällt von mir ab, der Raum kommt auf mich zu und hält mich umfangen. Er hegt mich."
Mitten im Lärm der aufgeregten Zeit. Mit ihr war er durch die zahllosen Besuche und Briefe derer verknüpft, die das Gespräch mit ihm suchten, seinen Rat und seine Kritik. Mit seinen Gästen wanderte er durch die Wälder und über die Berge, da und dort einkehrend und zuhause mit ihnen bis tief in die Nacht platonische Symposien in heiterem Ernst feiernd. Plettenberg wurde darüber zu einem Begriff freier Geselligkeit und turbulenter Diskussionen.
Gerade weil die Öffentlichkeit sorgsam vor ihm geschützt werden sollte, konnte Carl Schmitt umso nachhaltiger wirken über Schüler, Freunde und geistige Abenteurer, die seine Gedanken in jeder Beziehung vervielfältigten und zu einem europäischen Ereignis machten. Mittlerweile gehört er zu den berühmtesten Deutschen des 20. Jahrhunderts, eine Autorität wie vor ihm nur Carl von Clausewitz.
Christian Linder will von Carl Schmitt in seinem begrenzten Raum und Lebensraum erzählen, lässt sich aber bald von dessen Ideen und Systemen dazu verleiten, ins Raum- und Grenzenlose auszuschweifen. Sein Buch ist ein Florilegium, eine Blütenlese frappanter Sprüche des Meisters, wie sie mittelalterliche Mönche in stiller Andacht zusammenstellten, oder modern gesagt ein Reader’s Digest. Wer keine Ahnung von Carl Schmitt hat, erhält hier ausreichend Material, um sich in der Kunst üben zu können, geschickt über Bücher zu reden, die man nicht gelesen hat. Insofern ist der Band unbedingt nützlich. Nicht zuletzt, weil Christian Linder Goethes Rat befolgt, zu berichten, was und wie der andere dachte, statt zu erwägen, wie er hätte denken sollen.
Wer also in ewigem Geistesstillstand das unfruchtbare Einerlei seiner Schulbegriffe hütet, wird sich ängstigen und fürchten. Wer aber bereit ist, auch im irrenden Geist immer noch den Geist anzuerkennen, wird nicht vergeblich in diesem Lesebuch blättern.
Christian Linder: Der Bahnhof von Finnentrop.
Eine Reise ins Carl Schmitt Land
Matthes & Seitz, Berlin 2008
bemerkte der große Interpret Hegels, Alexandre Kojève, als er im Sommer 1967 nach Plettenberg fuhr. Dort lebte wie ein Verbannter in seiner Heimat der berühmte Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt. Sein Haus nannte er nach dem Exil Niccolò Machiavellis: San Casciano. Dieser erste "Wirklichkeitswissenschaftler" hatte sich während der raschen Systemwechsel in Florenz für die zuletzt siegreichen Medici politisch verdächtig gemacht.
Carl Schmitt war im April 1933 der NSDAP beigetreten und versuchte anschließend, dem Nationalsozialismus einen "Sinn" zu geben und ihn an Normen zu binden, ohne die keine konkrete Ordnung auskommt.
Er scheiterte damit vollkommen. Im Herbst 1936 wurde er in der Zeitschrift der SS - "Das Schwarze Korps" - als peinlicher Opportunist angegriffen, der während der Republik energisch gegen die Partei und deren Prinzipien gekämpft und die verschiedensten "Systempolitiker" beraten habe:
""Sollte es Carl Schmitt wirklich gelungen sein, einen echten Zugang zur nationalsozialistischen Wissenschaft gefunden zu haben? Wir meinen, dass Professor Carl Schmitt allen Grund hätte zu dem Ausruf: Der Herr bewahre mich vor meinen Konsequenzen."
Der charakterlose Möchte-Gern-Nationalsozialist musste seine verschiedenen Parteiämter aufgeben, behielt aber seinen Lehrstuhl. Nach dem Kriege wurde er seines Lehrstuhls enthoben. Er galt nun als peinlicher und charakterloser Wegbereiter des Nationalsozialismus und Totengräber der Weimarer Republik.
Ausgebombt in Berlin, vorübergehend in Nürnberg inhaftiert und verhört, ließ er sich ab Mai 1947 mit seiner Familie dauerhaft in Plettenberg im Sauerland nieder. Seinen von ihm zum Exil stilisierten Wohnort hat er bis zu seinem Tode 1985 höchstens für seltene Reisen verlassen.
Christian Linder, ein Journalist, der aus dem Sauerland stammt, lädt zu einer "Reise ins Carl Schmitt Land" ein mit seinem Buch: "Der Bahnhof von Finnentrop". Dort hielten die Fernzüge, die Plettenberg nicht mit der Nachbarschaft, sondern mit der Welt verbanden.
Carl Schmitt, in Plettenberg 1888 geboren, hatte häufig seinen Wohnort gewechselt, aber nie die Beziehung zu seiner Heimat verloren. Seine Familie war von der Mosel ins Sauerland gezogen und hielt immer eine enge Verbindung zu den Verwandten in Lothringen aufrecht.
Dennoch sah Carl Schmitt, der viel über das Land, über die Landnahme, die Aufteilung des Bodens und seine Nutzbarmachung und Kultivierung als ursprünglicher Grundlage jeder rechtlichen Ordnung nachgedacht hatte, im Sauerland den für ihn bestimmenden Teil der allgerechten Erde, der iustissima tellus. So nannte Vergil das Land im Gegensatz zum Meer, auf dem alles Welle ist, das Element für Piraterie, Willkür und Rechtlosigkeit.
Carl Schmitt erkannte im Sauerland aber auch ein Bild seines Charakters:
"Immer bleibt die Landschaft verhalten und in sich gekehrt. Die Berge schlafen oder warten und lassen sich durch die Sonne nicht so leicht aus ihrer Verschlossenheit herauslocken."
Er gehört zu den großen Lobrednern, ja Mythologen dieses gebirgigen Raumes, den
"aber der Atlantische Ozean mit Wolken und Nebel, Regen und Schnee überflutet und (dadurch) seine Erdstrahlung irritiert, so dass die Luft mit dauernden Spannungen des Gegensatzes von Land und Meer geladen ist"."
Dieser große, das Völkerrecht seit dem Zeitalter der Entdeckungen bestimmende Gegensatz beschäftigte ihn Zeit seines Lebens. Er hoffte immer auf eine neue globale Ordnung, die den Universalismus der One-World-Ideologie amerikanischer Provenienz durch ein Pluriversum verschiedener Großräume ersetzt. Stets zuversichtlich,
""dass die Erde immer größer bleiben wird als die Vereinigten Staaten von Amerika, und dass sie auch heute noch groß genug ist für mehrere Großräume, in denen freiheitsliebende Menschen ihre geschichtliche, wirtschaftliche und geistige Substanz und Eigenart zu wahren und zu verteidigen wissen"."
In den Bergen an der Lenne gewann er seinen ihm eigenen Raum:
""Die Zeit fällt von mir ab, der Raum kommt auf mich zu und hält mich umfangen. Er hegt mich."
Mitten im Lärm der aufgeregten Zeit. Mit ihr war er durch die zahllosen Besuche und Briefe derer verknüpft, die das Gespräch mit ihm suchten, seinen Rat und seine Kritik. Mit seinen Gästen wanderte er durch die Wälder und über die Berge, da und dort einkehrend und zuhause mit ihnen bis tief in die Nacht platonische Symposien in heiterem Ernst feiernd. Plettenberg wurde darüber zu einem Begriff freier Geselligkeit und turbulenter Diskussionen.
Gerade weil die Öffentlichkeit sorgsam vor ihm geschützt werden sollte, konnte Carl Schmitt umso nachhaltiger wirken über Schüler, Freunde und geistige Abenteurer, die seine Gedanken in jeder Beziehung vervielfältigten und zu einem europäischen Ereignis machten. Mittlerweile gehört er zu den berühmtesten Deutschen des 20. Jahrhunderts, eine Autorität wie vor ihm nur Carl von Clausewitz.
Christian Linder will von Carl Schmitt in seinem begrenzten Raum und Lebensraum erzählen, lässt sich aber bald von dessen Ideen und Systemen dazu verleiten, ins Raum- und Grenzenlose auszuschweifen. Sein Buch ist ein Florilegium, eine Blütenlese frappanter Sprüche des Meisters, wie sie mittelalterliche Mönche in stiller Andacht zusammenstellten, oder modern gesagt ein Reader’s Digest. Wer keine Ahnung von Carl Schmitt hat, erhält hier ausreichend Material, um sich in der Kunst üben zu können, geschickt über Bücher zu reden, die man nicht gelesen hat. Insofern ist der Band unbedingt nützlich. Nicht zuletzt, weil Christian Linder Goethes Rat befolgt, zu berichten, was und wie der andere dachte, statt zu erwägen, wie er hätte denken sollen.
Wer also in ewigem Geistesstillstand das unfruchtbare Einerlei seiner Schulbegriffe hütet, wird sich ängstigen und fürchten. Wer aber bereit ist, auch im irrenden Geist immer noch den Geist anzuerkennen, wird nicht vergeblich in diesem Lesebuch blättern.
Christian Linder: Der Bahnhof von Finnentrop.
Eine Reise ins Carl Schmitt Land
Matthes & Seitz, Berlin 2008
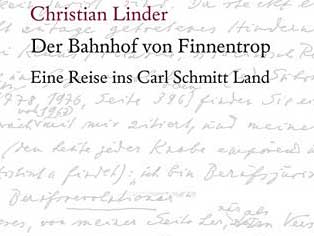
Christian Lindner: Der Bahnhof von Finnentrop© Matthes & Seitz Verlag
