Im Reich des Irrtums
Das Werk des Oxforder Kirchenhistorikers Diamond MacCulloch "Die Reformation 1490 - 1700" ist nicht nur eine Abhandlung über Abspaltungen und Gegenbewegung zum Katholizismus, sondern erzählt die Geschichte vom schwierigen Weg der Glaubensmächte hin zu mehr Toleranz und Pluralismus.
Eine Einheit Europas hatte es nie gegeben. Das weströmische Reich, das Karl der Große erneuerte, stellte sich dem oströmischen entgegen und die römische Kirche wie die byzantinische spalteten sich endgültig 1054 in zwei Kirchen, die den Umgang miteinander abbrachen.
Im lateinischen Teil Europas und in der lateinischen Kirche gab es - im Unterschied zu Byzanz - unentwegt religiöse Unruhen, um die verweltlichte Kirche wieder zur wahren zu machen. Reformbewegungen und Reformationen konnten seit dem 11. Jahrhundert immer wieder Massen mobilisieren. Die fortschreitende Christianisierung Europas entwickelte sich aus der immer nur vorübergehend beruhigten Sorge um das reine, unverfälschte Christentum und die aufrichtige, Gott gefällige Nachfolge Christi in diesem Reich des Irrtums und der Ungewissheit.
Die Kirche, die auf ihre Freiheit vom Kaiser bedacht war, entfesselte die Freiheit der Kronen, der Staaten und endlich die Freiheit eines Christenmenschen. Europa war immer ein aufgeregtes Pluriversum. Auch die eine, allgemeine Kirche bemühte sich als complexio oppositorum, widerstreitende Meinung in ihrer Gemeinschaft unentschieden der Diskussion zu überlassen, sofern sie nicht eindeutig dem Glaubensbekenntnis widersprachen.
Erst vor den Reformationen, die Luther, Zwingli und Kalvin im 16. Jahrhundert einleiteten und dynamisierten, erwies sich die Römische Kirche als hilflos, sodass "die Reformation" im Westen eine dauernde Spaltung bewirkte, ähnlich der früheren mit Ostrom. "Die Reformation 1490 - 1700" schildert der Oxforder Kirchenhistoriker Diarmaid MacCulloch als ein gesamteuropäisches, und über Amerika welthistorisches Ereignis.
"Das Gedankengut von Reformation und Gegenreformation ist in den Kulturen Amerikas und bei den Christen Afrikas und Asiens nach wie vor lebendig (wenn auch oft in Besorgnis erregender Weise), während es in Europa, dem Kontinent ihres Ursprunges, überwiegend der Geschichte angehört."
Diarmaid MucCulloch schreibt also für ein Publikum, das höchstens unbestimmte Vorstellungen mit ehedem heftig umstrittenen Glaubensinhalten verbindet. Diese interessieren ihn hier nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als Voraussetzung, um einen historischen Prozess zu verstehen, der aus "dem Christentum" wahrscheinlich endgültig eine Vielfalt christlicher Möglichkeiten entband, die einander als eine andere complexio oppositorum ergänzen können, ohne der kirchlichen Zusammenfassung noch zu bedürfen.
Es waren nicht so sehr innerkirchliche Skandale und Missbräuche, die eine geschwächte Kirche darin hinderten, die richtige Antwort auf gar nicht so ungewöhnliche Herausforderungen zu finden.
"Die alte Kirche war ungemein stark. Nur die Sprengkraft einer Idee konnte eine derartige Macht erschüttern, und im Fall der Reformation war diese Idee eine Neuformulierung der augustinischen Gnadenlehre."
Ein gnädiger Gott schenkt über den Glauben, den er im Sünder entzündet, diesem die Kraft zum Vertrauen in das befreiende Wort Gottes und erwählt den von ihm verwandelten zum ewigen Heil in seiner Nähe. Ist es allein der unverdiente Glaube, der rettet, dann bedarf es keiner weiteren Gnadenvermittler, wie Priester oder Bischöfe, dann wirkt das Wort, in dem sich Gott zu erkennen gibt, mit der Kraft des Heiligen Geistes als Weg zu wahren Leben.
Die Bibel wurde zur mächtigen Waffe, der Kirche und ihrem durch die Tradition bewährten Lehramt die Rechtfertigung zu entziehen.
"Die Reformation war - im Kern betrachtet - der endgültige Sieg der augustinischen Gnadenlehre über die augustinische Kirchenlehre."
Die Kirche verstand sich nie als Buchreligion und hielt die Laien, soweit sie lesen konnten, gar nicht dazu an, die Heiligen Schriften zu lesen. Im Gegenteil, sie warnte davor, weil die Bibel in der Hand unkundiger Leser stets aller Unruhen, sämtlicher Häresien Ursache gewesen sei.
Aber seit dem 14. Jahrhundert suchten die Gläubigen die Nähe des armen, gleich ihnen machtlosen Jesus, den Schmerzensmann, den nackten Christus am nackten Holz, wie er ihnen in der Bibel begegnet. Um den Willen Gottes zu ahnen, musste man darin geübt sein, die Sprache Gottes, die Christus spricht, zu verstehen, um in der Sprache Gottes antworten zu können auf Fragen, die er im inneren Gespräch an jeden Einzelnen richtet.
Die Erfindung des Buchdrucks und dessen stürmische Verbreitung seit 1456 ermöglichte den für damalige Verhältnisse massenhaften Absatz von Bibeln in der Volkssprache. Vor der lutherischen Übersetzung gab es in Deutschland schon über zwanzig deutsche Versionen. Die Kirche misstraute dieser Bewegung und konnte sie doch nicht aufhalten. Die Bibel steht am Anfang der Reformation, welche daher nicht mit Luthers Thesen am 31. Oktober 1517 beginnt.
Die Reformation musste nicht zu Tumulten führen. In Spanien ist sie um 1520 abgeschlossen. Vor allem die Conversos, die neuen Christen, die von Juden abstammten, griffen die gesamteuropäischen Bemühungen auf, sich dem dramatischen Ereignis des liebenden Gottes hinzugeben. Das meinte, sich genau zu prüfen, auf Christi Rede zu achten und wieder und wieder die Bibel zu lesen. Die zu neuem Leben erwachte Kirche in Spanien sollte später die katholische Reform vorantreiben, die ihren Abschluss 1563 auf dem Tridentiner Konzil fand.
Wegen der geglückten Reformation blieb Spanien vor Bürgerkriegen verschont, die alle übrigen europäischen mehr oder weniger lange und heftig erschütterten, weil die Reformation die gesamte Verfassung von Staat und Gesellschaft betraf. Die Reformation vermochte sich in Teilen Europas zu behaupten. Das gelang ihr nicht nur wegen ihrer geistigen Dynamik, die rasch auch wieder in neuer Routine und Konvention erstarren konnte.
Es war der große Gegensatz des gesamten Hauses Österreich, angeführt von Spanien mit Frankreich und dessen wechselnden Verbündeten, in den die Geschichte der katholischen und evangelischen Reformationen verquickt ist. Denn die katholischen Könige gingen Bündnisse mit Protestanten ein, selbst die Päpste, die meist fürchteten unter kaiserliche und spanische Servitut zu geraten, konnten Lutheraner als nützliche und umgängliche Häretiker achten.
Die politische Vernunft mischte sich immer entschiedener ein, um zu neuen Formen des Zusammenlebens zu gelangen. Die Geschichte der Mächte und der Glaubensmächte wird nach und nach über vielfach gescheiterte Versuche zu einer Geschichte der Toleranz, der Einübung in einen Pluralismus der Meinungen, das Christentum wie ein dauerndes, vielzüngiges und bunt schillerndes Pfingstwunder zu begreifen.
Diese Geschichte ist noch nicht abgeschlossen, wie Diarmaid MacCulloch vermutet, weil wir uns immer noch nicht daran gewöhnt haben, dass Toleranz eben nicht nur ein zweckdienliches oder notwendiges Mittel ist, sondern das eigentliche Ziel sein müsse, religiöse Freiheit für alle zu schaffen - ‚Indifferenz gegenüber bestimmten Differenzen.
Das ist aber, wie eh und je, keine Frage allein der Religionsgemeinschaften. Staatlich Bedürfnisse, Ideologien und politisierte Theologie mischen sich und ein, weil ihnen Indifferenz gegenüber Differenzen unheimlich ist.
Diarmaid MacCulloch: Die Reformation 1490 - 1700
Aus dem Englischen von Helke Voß-Becher und Klaus Binder
Deutsche Verlagsanstalt, München 2008
Im lateinischen Teil Europas und in der lateinischen Kirche gab es - im Unterschied zu Byzanz - unentwegt religiöse Unruhen, um die verweltlichte Kirche wieder zur wahren zu machen. Reformbewegungen und Reformationen konnten seit dem 11. Jahrhundert immer wieder Massen mobilisieren. Die fortschreitende Christianisierung Europas entwickelte sich aus der immer nur vorübergehend beruhigten Sorge um das reine, unverfälschte Christentum und die aufrichtige, Gott gefällige Nachfolge Christi in diesem Reich des Irrtums und der Ungewissheit.
Die Kirche, die auf ihre Freiheit vom Kaiser bedacht war, entfesselte die Freiheit der Kronen, der Staaten und endlich die Freiheit eines Christenmenschen. Europa war immer ein aufgeregtes Pluriversum. Auch die eine, allgemeine Kirche bemühte sich als complexio oppositorum, widerstreitende Meinung in ihrer Gemeinschaft unentschieden der Diskussion zu überlassen, sofern sie nicht eindeutig dem Glaubensbekenntnis widersprachen.
Erst vor den Reformationen, die Luther, Zwingli und Kalvin im 16. Jahrhundert einleiteten und dynamisierten, erwies sich die Römische Kirche als hilflos, sodass "die Reformation" im Westen eine dauernde Spaltung bewirkte, ähnlich der früheren mit Ostrom. "Die Reformation 1490 - 1700" schildert der Oxforder Kirchenhistoriker Diarmaid MacCulloch als ein gesamteuropäisches, und über Amerika welthistorisches Ereignis.
"Das Gedankengut von Reformation und Gegenreformation ist in den Kulturen Amerikas und bei den Christen Afrikas und Asiens nach wie vor lebendig (wenn auch oft in Besorgnis erregender Weise), während es in Europa, dem Kontinent ihres Ursprunges, überwiegend der Geschichte angehört."
Diarmaid MucCulloch schreibt also für ein Publikum, das höchstens unbestimmte Vorstellungen mit ehedem heftig umstrittenen Glaubensinhalten verbindet. Diese interessieren ihn hier nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als Voraussetzung, um einen historischen Prozess zu verstehen, der aus "dem Christentum" wahrscheinlich endgültig eine Vielfalt christlicher Möglichkeiten entband, die einander als eine andere complexio oppositorum ergänzen können, ohne der kirchlichen Zusammenfassung noch zu bedürfen.
Es waren nicht so sehr innerkirchliche Skandale und Missbräuche, die eine geschwächte Kirche darin hinderten, die richtige Antwort auf gar nicht so ungewöhnliche Herausforderungen zu finden.
"Die alte Kirche war ungemein stark. Nur die Sprengkraft einer Idee konnte eine derartige Macht erschüttern, und im Fall der Reformation war diese Idee eine Neuformulierung der augustinischen Gnadenlehre."
Ein gnädiger Gott schenkt über den Glauben, den er im Sünder entzündet, diesem die Kraft zum Vertrauen in das befreiende Wort Gottes und erwählt den von ihm verwandelten zum ewigen Heil in seiner Nähe. Ist es allein der unverdiente Glaube, der rettet, dann bedarf es keiner weiteren Gnadenvermittler, wie Priester oder Bischöfe, dann wirkt das Wort, in dem sich Gott zu erkennen gibt, mit der Kraft des Heiligen Geistes als Weg zu wahren Leben.
Die Bibel wurde zur mächtigen Waffe, der Kirche und ihrem durch die Tradition bewährten Lehramt die Rechtfertigung zu entziehen.
"Die Reformation war - im Kern betrachtet - der endgültige Sieg der augustinischen Gnadenlehre über die augustinische Kirchenlehre."
Die Kirche verstand sich nie als Buchreligion und hielt die Laien, soweit sie lesen konnten, gar nicht dazu an, die Heiligen Schriften zu lesen. Im Gegenteil, sie warnte davor, weil die Bibel in der Hand unkundiger Leser stets aller Unruhen, sämtlicher Häresien Ursache gewesen sei.
Aber seit dem 14. Jahrhundert suchten die Gläubigen die Nähe des armen, gleich ihnen machtlosen Jesus, den Schmerzensmann, den nackten Christus am nackten Holz, wie er ihnen in der Bibel begegnet. Um den Willen Gottes zu ahnen, musste man darin geübt sein, die Sprache Gottes, die Christus spricht, zu verstehen, um in der Sprache Gottes antworten zu können auf Fragen, die er im inneren Gespräch an jeden Einzelnen richtet.
Die Erfindung des Buchdrucks und dessen stürmische Verbreitung seit 1456 ermöglichte den für damalige Verhältnisse massenhaften Absatz von Bibeln in der Volkssprache. Vor der lutherischen Übersetzung gab es in Deutschland schon über zwanzig deutsche Versionen. Die Kirche misstraute dieser Bewegung und konnte sie doch nicht aufhalten. Die Bibel steht am Anfang der Reformation, welche daher nicht mit Luthers Thesen am 31. Oktober 1517 beginnt.
Die Reformation musste nicht zu Tumulten führen. In Spanien ist sie um 1520 abgeschlossen. Vor allem die Conversos, die neuen Christen, die von Juden abstammten, griffen die gesamteuropäischen Bemühungen auf, sich dem dramatischen Ereignis des liebenden Gottes hinzugeben. Das meinte, sich genau zu prüfen, auf Christi Rede zu achten und wieder und wieder die Bibel zu lesen. Die zu neuem Leben erwachte Kirche in Spanien sollte später die katholische Reform vorantreiben, die ihren Abschluss 1563 auf dem Tridentiner Konzil fand.
Wegen der geglückten Reformation blieb Spanien vor Bürgerkriegen verschont, die alle übrigen europäischen mehr oder weniger lange und heftig erschütterten, weil die Reformation die gesamte Verfassung von Staat und Gesellschaft betraf. Die Reformation vermochte sich in Teilen Europas zu behaupten. Das gelang ihr nicht nur wegen ihrer geistigen Dynamik, die rasch auch wieder in neuer Routine und Konvention erstarren konnte.
Es war der große Gegensatz des gesamten Hauses Österreich, angeführt von Spanien mit Frankreich und dessen wechselnden Verbündeten, in den die Geschichte der katholischen und evangelischen Reformationen verquickt ist. Denn die katholischen Könige gingen Bündnisse mit Protestanten ein, selbst die Päpste, die meist fürchteten unter kaiserliche und spanische Servitut zu geraten, konnten Lutheraner als nützliche und umgängliche Häretiker achten.
Die politische Vernunft mischte sich immer entschiedener ein, um zu neuen Formen des Zusammenlebens zu gelangen. Die Geschichte der Mächte und der Glaubensmächte wird nach und nach über vielfach gescheiterte Versuche zu einer Geschichte der Toleranz, der Einübung in einen Pluralismus der Meinungen, das Christentum wie ein dauerndes, vielzüngiges und bunt schillerndes Pfingstwunder zu begreifen.
Diese Geschichte ist noch nicht abgeschlossen, wie Diarmaid MacCulloch vermutet, weil wir uns immer noch nicht daran gewöhnt haben, dass Toleranz eben nicht nur ein zweckdienliches oder notwendiges Mittel ist, sondern das eigentliche Ziel sein müsse, religiöse Freiheit für alle zu schaffen - ‚Indifferenz gegenüber bestimmten Differenzen.
Das ist aber, wie eh und je, keine Frage allein der Religionsgemeinschaften. Staatlich Bedürfnisse, Ideologien und politisierte Theologie mischen sich und ein, weil ihnen Indifferenz gegenüber Differenzen unheimlich ist.
Diarmaid MacCulloch: Die Reformation 1490 - 1700
Aus dem Englischen von Helke Voß-Becher und Klaus Binder
Deutsche Verlagsanstalt, München 2008
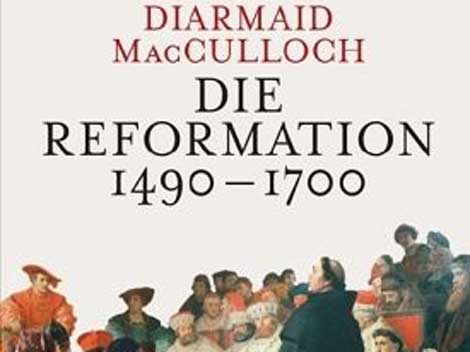
Diarmaid MacCulloch: Die Reformation 1490 - 1700© Deutsche Verlagsanstalt
