Herrschaft und Freiheit
In Schillers Dramen geht es häufig um Herrschaft und Freiheit. Der Autor Walter Müller-Seidel befragt sie deshalb in "Friedrich Schiller und die Politik" nach Herrschaftsformen, Widerstandsrecht und Tyrannenmord.
Die Französische Revolution von 1789 hat Friedrich Schiller begrüßt. Auf dem Theater gespielt wurde er in Frankreich seit 1785, im August 1792 verlieh ihm die französische Nationalversammlung wegen seiner Verdienste um Freiheit und Humanität die Ehrenbürgerschaft. Sein auf der Urkunde ausgeschriebener Name lautet Gillé, mit G als erstem Buchstaben und E-accent-aigu als letztem.
Die Urkunde selbst brauchte viel Zeit, um ihren Empfänger zu erreichen. Schiller erhielt sie erst 1798. Er überließ sie der Weimarer Bibliothek und besaß lediglich eine beglaubigte Kopie. Die mit der Ehrenbürgerschaft verbundenen Privilegien nahm er gerne an und wollte sie an seine Kinder weiterreichen.
Dabei hatte sich seine Haltung zur Revolution inzwischen geändert. Mit der Jakobinerdiktatur war er vom Anhänger zum Gegner geworden, wofür berühmte Zeilen in seinem "Lied von der Glocke" stehen:
"Freiheit und Gleichheit! hört man schallen,
Der ruhge Bürger greift zur Wehr,
Die Straßen füllen sich, die Hallen,
Und Würgerbanden ziehn umher,
Da werden Weiber zu Hyänen
Und treiben mit Entsetzen Scherz,
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,
Zerreißen sie des Feindes Herz."
Beschrieben wird damit die Terreur, die jakobinische Blutherrschaft. Sie begann in exakt in jenem Herbst 1792, auf den Schiller Ehrenbürgerwürde datiert. Die Entscheidung des Dichters, sie gleichwohl zu akzeptieren, hat nach alledem, in Schillers Heimatdialekt zu sprechen, ein Geschmäckle.
Das eben Erzählte behandelt Walter Müller-Seidel bloß in Ansätzen. Der 1918 Geborene, Inhaber eines germanistischen Lehrstuhls an der Münchner Universität, hat über Fontane und Kleist gearbeitet, sein Hauptinteresse gilt der deutschen Klassik. Sein jetzt erschienenes Buch handelt von Schiller und der Politik.
Was aber ist Politik? Wir zitieren Max Weber:
"Der Begriff ist außerordentlich weit und umfasst jede Art selbständig leitender Tätigkeit ... Wir wollen heute darunter nur verstehen: die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute also: eines Staates."
Schiller hat, im Unterschied zu Goethe, keinerlei staatlich-administratives Amt ausgeübt. Er war Schriftsteller und Universitätslehrer. Sein Einfluss auf Politik erfolgte über seine Schriften, von denen er freilich annahm, ganz im Sinne der Aufklärung, dass sie zur Veränderung des Einzelnen und damit auch des Gemeinwesens beitragen könnten. Müller Seidel:
"Ästhetische Erziehung und politisches Glaubensbekenntnis schließen sich im Denken Schillers nicht aus. Sie haben mit höfischer Kultur wenig zu tun, auf die man vor nicht zu langer Zeit die Weimarer Klassik festzulegen suchte."
Das sagt es ziemlich genau, und es beschreibt die Zielrichtung des Buches. Zum historischen Schlüsseldatum wird dabei die öffentliche Hinrichtung des französischen Königs Louis XVI auf der Pariser Place de la Révolution im Januar 1793. Es war dies nicht die erste Exekution eines Monarchen in der europäischen Geschichte. Anderthalb Jahrhunderte zuvor hatte es Englands Herrscher Charles aus dem Hause Stuart ereilt, ebenfalls im Zusammenhang mit einer bürgerlichen Revolution.
Gleichwohl, das vollstreckte Todesurteil gegen den französischen König galt als singuläres Ereignis. Es hat viele Zeitgenossen, auch Sympathisanten der französischen Revolution, gründlich verstört. Dabei waren die konterrevolutionären Handlungen von Louis erwiesen und das harte Urteil war begründbar, doch die tradierte Überzeugung, das Töten eines gesalbten und mit Gottes Gnade ausgestatteten Herrschers verstoße gegen alle religiösen Grundsätze, wirkte stärker.
Auch bei Schiller. Dabei hat er nichts so oft und ausführlich thematisiert wie die Existenz des politischen Herrschers, dessen Aufgaben, dessen Pflichten, dessen Grenzen, dessen mögliche Verstöße gegen Vernunft und Gesetz. Es findet sich selbst die Billigung des politischen Attentats gegen einen Autokraten, in "Wilhelm Tell. Das Stück stammt von 1804. Die Hinrichtung des französischen Königs lag 13 Jahre zurück.
Hatte der Dichter seine Meinung revidiert? Müller Seidel:
"Schiller ist tatsächlich von Jahr zu Jahr ein Gewandelter, ein immer etwas anderer als die Jahre zuvor. Mit der Zeitgeschichte als Basis seines Denkens ist Ernst zu machen."
Dass er seine grundsätzliche Haltung zur Hinrichtung des Königs geändert habe, schließt Müller-Seidel dennoch aus. Im "Wilhelm Tell" handle es sich -
"… um einen Tyrannenmord ... Lässt man sich auf die Argumente ein, die im Drama selbst vorgebracht werden, vor allem auf dasjenige der Notwehr, so hätte man es mit einem Fall von Totschlag zu tun. Aber viel, wenn nicht alles, spricht dafür, dass es sich um einen "klassischen" Fall von Tyrannenmord handelt, der im Programm der Weimarer Klassik eigentlich nicht vorgesehen war."
Den Herrscherfiguren in Schillers Werk geht das Buch ausführlich nach. Viele, von Fiesco und Maria Stuart bis Wallenstein, nehmen ein gewaltsames Ende, was Müller-Seidel eingehend kommentiert. Nicht vergessen werden die Herrscher in den - heute nicht mehr ganz so populären - Balladen Schillers mit ihrem geschichtlichen oder mythischen Personal.
Die Dramen erhalten den breitesten Raum. Sie werden durchdekliniert in der Reihenfolge ihrer Entstehung, bis hin zum Demetrius-Fragment. Wieso ausgerechnet das zur Zeit seiner Entstehung aktualpolitischste aller Schiller-Stücke fehlt, nämlich "Kabale und Liebe", bleibt unbegreiflich. Weil hier der Herrscher als handelnde Gestalt nicht auftritt? Bei den "Räubern" tritt er auch nicht auf, bloß dessen Substitut, in Gestalt von Franz, der Kanaille. Bei "Kabale und Liebe", was eine äußerst raffinierte ästhetische Wahl ist, kommt der Herrscher auch nicht vor, doch sein gesamter Hofstaat, vom Präsidenten bis zur Maitresse, beherrscht als sein Geschöpf die Szene.
Müller-Seidel untersucht die Schiller-Themen Krieg, Tötung und Menschenopfer. Er behandelt die Stellung des Dichters zu Napoleon, die skeptischer und negativer ausgefallen sei als jene Goethes oder Beethovens. Freilich, die Belege dafür sind dürftig. Schiller starb 1805. Napoleons Krönung lag erst ein halbes Jahr zurück. Wie er weiter vorgehen würde, ließ sich noch nicht erkennen.
Gelegentlich der Topoi Tyrann und Tyrannenmord widersteht Müller-Seidel nicht der Versuchung, Verbindungslinien bis in allerjüngste Zeit auszuziehen, wie er überhaupt zu Abschweifungen neigt. Pol Pot findet Erwähnung und der Hitler-Attentäter Stauffenberg. Der war ein dankbarer Jünger Stefan Georges, und so kommen noch andere Angehörige aus dessen Kreis ausführlich zu Wort, voran Max Kommerell. Dass sich auch die marxistische Seite zum Thema geäußert hat, wird immerhin erwähnt. Deren wichtigster Repräsentant, Georg Lucács, bleibt freilich unberücksichtigt.
Den Band beschließen Ausführungen zum Humanitätsbegriff und zum Thema der menschliche Größe, was mit Schiller nur unter anderem zu tun hat und mit dem eigentlichen Buchgegenstand, der Politik, gerade nur so viel, als alles literarische Schreiben politisch wirksam sein kann, irgendwie.
Es gibt ein paar überflüssige Wiederholungen. Die Geschichte von der Köpfmaschine des Doktors Guillotin und die Reaktion Lichtenbergs darauf wird gleich zweimal erzählt. Anderes ist durchaus erhellend, so die ausführliche Erwähnung des Briefpartners Johann Benjamin Erhard, den die Schiller-Literatur sonst gerne verschweigt.
Müller-Seidels Hauptverdienst ist, dass er ausführlich die Widerspiegelung der Französischen Revolution in Denken und Werk eines deutschen Dichters untersucht. Eine generalisierende Darstellung, einbegreifend die anderen Zeitgenossen, von Kant und Arndt bis Hegel und Feuerbach, von Hölderlin und Forster bis Kleist und Büchner, steht immer noch aus.
Walter Müller-Seidel: Friedrich Schiller und die Politik. Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe
C. H. Beck, München 2009
Die Urkunde selbst brauchte viel Zeit, um ihren Empfänger zu erreichen. Schiller erhielt sie erst 1798. Er überließ sie der Weimarer Bibliothek und besaß lediglich eine beglaubigte Kopie. Die mit der Ehrenbürgerschaft verbundenen Privilegien nahm er gerne an und wollte sie an seine Kinder weiterreichen.
Dabei hatte sich seine Haltung zur Revolution inzwischen geändert. Mit der Jakobinerdiktatur war er vom Anhänger zum Gegner geworden, wofür berühmte Zeilen in seinem "Lied von der Glocke" stehen:
"Freiheit und Gleichheit! hört man schallen,
Der ruhge Bürger greift zur Wehr,
Die Straßen füllen sich, die Hallen,
Und Würgerbanden ziehn umher,
Da werden Weiber zu Hyänen
Und treiben mit Entsetzen Scherz,
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,
Zerreißen sie des Feindes Herz."
Beschrieben wird damit die Terreur, die jakobinische Blutherrschaft. Sie begann in exakt in jenem Herbst 1792, auf den Schiller Ehrenbürgerwürde datiert. Die Entscheidung des Dichters, sie gleichwohl zu akzeptieren, hat nach alledem, in Schillers Heimatdialekt zu sprechen, ein Geschmäckle.
Das eben Erzählte behandelt Walter Müller-Seidel bloß in Ansätzen. Der 1918 Geborene, Inhaber eines germanistischen Lehrstuhls an der Münchner Universität, hat über Fontane und Kleist gearbeitet, sein Hauptinteresse gilt der deutschen Klassik. Sein jetzt erschienenes Buch handelt von Schiller und der Politik.
Was aber ist Politik? Wir zitieren Max Weber:
"Der Begriff ist außerordentlich weit und umfasst jede Art selbständig leitender Tätigkeit ... Wir wollen heute darunter nur verstehen: die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute also: eines Staates."
Schiller hat, im Unterschied zu Goethe, keinerlei staatlich-administratives Amt ausgeübt. Er war Schriftsteller und Universitätslehrer. Sein Einfluss auf Politik erfolgte über seine Schriften, von denen er freilich annahm, ganz im Sinne der Aufklärung, dass sie zur Veränderung des Einzelnen und damit auch des Gemeinwesens beitragen könnten. Müller Seidel:
"Ästhetische Erziehung und politisches Glaubensbekenntnis schließen sich im Denken Schillers nicht aus. Sie haben mit höfischer Kultur wenig zu tun, auf die man vor nicht zu langer Zeit die Weimarer Klassik festzulegen suchte."
Das sagt es ziemlich genau, und es beschreibt die Zielrichtung des Buches. Zum historischen Schlüsseldatum wird dabei die öffentliche Hinrichtung des französischen Königs Louis XVI auf der Pariser Place de la Révolution im Januar 1793. Es war dies nicht die erste Exekution eines Monarchen in der europäischen Geschichte. Anderthalb Jahrhunderte zuvor hatte es Englands Herrscher Charles aus dem Hause Stuart ereilt, ebenfalls im Zusammenhang mit einer bürgerlichen Revolution.
Gleichwohl, das vollstreckte Todesurteil gegen den französischen König galt als singuläres Ereignis. Es hat viele Zeitgenossen, auch Sympathisanten der französischen Revolution, gründlich verstört. Dabei waren die konterrevolutionären Handlungen von Louis erwiesen und das harte Urteil war begründbar, doch die tradierte Überzeugung, das Töten eines gesalbten und mit Gottes Gnade ausgestatteten Herrschers verstoße gegen alle religiösen Grundsätze, wirkte stärker.
Auch bei Schiller. Dabei hat er nichts so oft und ausführlich thematisiert wie die Existenz des politischen Herrschers, dessen Aufgaben, dessen Pflichten, dessen Grenzen, dessen mögliche Verstöße gegen Vernunft und Gesetz. Es findet sich selbst die Billigung des politischen Attentats gegen einen Autokraten, in "Wilhelm Tell. Das Stück stammt von 1804. Die Hinrichtung des französischen Königs lag 13 Jahre zurück.
Hatte der Dichter seine Meinung revidiert? Müller Seidel:
"Schiller ist tatsächlich von Jahr zu Jahr ein Gewandelter, ein immer etwas anderer als die Jahre zuvor. Mit der Zeitgeschichte als Basis seines Denkens ist Ernst zu machen."
Dass er seine grundsätzliche Haltung zur Hinrichtung des Königs geändert habe, schließt Müller-Seidel dennoch aus. Im "Wilhelm Tell" handle es sich -
"… um einen Tyrannenmord ... Lässt man sich auf die Argumente ein, die im Drama selbst vorgebracht werden, vor allem auf dasjenige der Notwehr, so hätte man es mit einem Fall von Totschlag zu tun. Aber viel, wenn nicht alles, spricht dafür, dass es sich um einen "klassischen" Fall von Tyrannenmord handelt, der im Programm der Weimarer Klassik eigentlich nicht vorgesehen war."
Den Herrscherfiguren in Schillers Werk geht das Buch ausführlich nach. Viele, von Fiesco und Maria Stuart bis Wallenstein, nehmen ein gewaltsames Ende, was Müller-Seidel eingehend kommentiert. Nicht vergessen werden die Herrscher in den - heute nicht mehr ganz so populären - Balladen Schillers mit ihrem geschichtlichen oder mythischen Personal.
Die Dramen erhalten den breitesten Raum. Sie werden durchdekliniert in der Reihenfolge ihrer Entstehung, bis hin zum Demetrius-Fragment. Wieso ausgerechnet das zur Zeit seiner Entstehung aktualpolitischste aller Schiller-Stücke fehlt, nämlich "Kabale und Liebe", bleibt unbegreiflich. Weil hier der Herrscher als handelnde Gestalt nicht auftritt? Bei den "Räubern" tritt er auch nicht auf, bloß dessen Substitut, in Gestalt von Franz, der Kanaille. Bei "Kabale und Liebe", was eine äußerst raffinierte ästhetische Wahl ist, kommt der Herrscher auch nicht vor, doch sein gesamter Hofstaat, vom Präsidenten bis zur Maitresse, beherrscht als sein Geschöpf die Szene.
Müller-Seidel untersucht die Schiller-Themen Krieg, Tötung und Menschenopfer. Er behandelt die Stellung des Dichters zu Napoleon, die skeptischer und negativer ausgefallen sei als jene Goethes oder Beethovens. Freilich, die Belege dafür sind dürftig. Schiller starb 1805. Napoleons Krönung lag erst ein halbes Jahr zurück. Wie er weiter vorgehen würde, ließ sich noch nicht erkennen.
Gelegentlich der Topoi Tyrann und Tyrannenmord widersteht Müller-Seidel nicht der Versuchung, Verbindungslinien bis in allerjüngste Zeit auszuziehen, wie er überhaupt zu Abschweifungen neigt. Pol Pot findet Erwähnung und der Hitler-Attentäter Stauffenberg. Der war ein dankbarer Jünger Stefan Georges, und so kommen noch andere Angehörige aus dessen Kreis ausführlich zu Wort, voran Max Kommerell. Dass sich auch die marxistische Seite zum Thema geäußert hat, wird immerhin erwähnt. Deren wichtigster Repräsentant, Georg Lucács, bleibt freilich unberücksichtigt.
Den Band beschließen Ausführungen zum Humanitätsbegriff und zum Thema der menschliche Größe, was mit Schiller nur unter anderem zu tun hat und mit dem eigentlichen Buchgegenstand, der Politik, gerade nur so viel, als alles literarische Schreiben politisch wirksam sein kann, irgendwie.
Es gibt ein paar überflüssige Wiederholungen. Die Geschichte von der Köpfmaschine des Doktors Guillotin und die Reaktion Lichtenbergs darauf wird gleich zweimal erzählt. Anderes ist durchaus erhellend, so die ausführliche Erwähnung des Briefpartners Johann Benjamin Erhard, den die Schiller-Literatur sonst gerne verschweigt.
Müller-Seidels Hauptverdienst ist, dass er ausführlich die Widerspiegelung der Französischen Revolution in Denken und Werk eines deutschen Dichters untersucht. Eine generalisierende Darstellung, einbegreifend die anderen Zeitgenossen, von Kant und Arndt bis Hegel und Feuerbach, von Hölderlin und Forster bis Kleist und Büchner, steht immer noch aus.
Walter Müller-Seidel: Friedrich Schiller und die Politik. Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe
C. H. Beck, München 2009
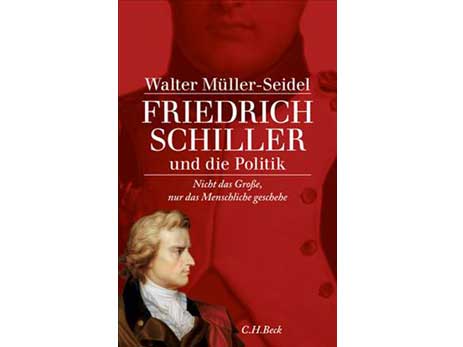
Cover: "Walter Müller-Seidel: Friedrich Schiller und die Politik"© C. H. Beck
