Heillose Selbstüberschätzung
John Gray nennt in seinem Buch alle die Denk- und Handlungsweisen, die von einer Sonderstellung des Menschen ausgehen, "Humanismus" - und zwar deshalb, weil im deutschen Verständnis von Humanismus der ehrfurchtsvolle Dienst an der Menschheit gemeint ist.
John Gray will das Menschenbild auf den Boden der Darwinschen Evolutionstheorie zurückführen, der Mensch bleibt seiner Abstammung (oder seinem Stammbaum) verhaftet, bleibt Teil der Natur, ist eine Spezies unter anderen. Wenn er sich nicht mehr über das Tier - "die anderen Tiere" sagt der Autor - erhebt, wird er sich nicht länger Illusionen über seine Stellung in der Welt machen. Er wird sich nicht als Herr über Globus und Biosphäre fühlen und in heilloser Selbstüberschätzung Fehlentscheidungen treffen.
Man kennt die Attribute, mit denen sich der Mensch zum Wesen höherer Art erklärt: es sind Vernunftbegabung, Fortschrittsglaube, Wissenschaft. Aber diese stolzen Eigenheiten des Menschen sind, genau besehen, nichts als Tröstungen über das unausgesprochene Eingeständnis, das tierische Wesen in sich doch nicht ablegen zu können und bei allen Versuchen, darüber hinauszuwachsen, immer wieder scheitern zu müssen.
John Gray nennt alle die Denk- und Handlungsweisen, die von einer Sonderstellung des Menschen ausgehen, "Humanismus". Das ist zu bedenken, weil im deutschen Verständnis von Humanismus der ehrfurchtsvolle Dienst an der Menschheit gemeint ist.
Der Mensch vollführt mit seinesgleichen keine Fortschritte, sondern bleibt in einer zyklischen Bewegung von Gewinn und Verlust gefangen und steht fassungslos vor seinen Rückschlägen. Das Buch liest sich wie ein "Zurück zur eigenen Natur!", doch nicht wie eine literarische Anweisung nach Jean-Jacques Rousseau, sondern wie eine Reparatur-Anleitung nach Abstürzen:
"Als die abendländische Kultur noch ganz von der Religion bestimmt war, konnte sie offen zugestehen, dass das irdische Leben hart ist, denn sie stellte eine andere Welt in Aussicht, in der alle Tränen getrocknet werden. Der Humanismus, der die Stelle der Religion eingenommen hat, propagiert eine noch weniger glaubhafte Phantasie, nämlich dass in der Zukunft, ja sogar in naher Zukunft jedem das Glück offensteht. Gesellschaften, die auf einen Fortschrittsglauben gegründet sind, können sich mit dem ganz normalen Unglück des menschlichen Lebens nicht abfinden."
Der Mensch flüchtet daraufhin in das Selbstbild einer geschlossenen höheren Wesenheit und in rastloses Tätigsein, nur um der Vergeblichkeit seiner Bemühungen nicht innezuwerden. Und so gibt er sich Täuschungen hin, die ihn von den Lebewesen abheben, vor der ganzen Kreatur auszeichnen – und da wären neben Vernunft, Fortschritt und Wissenschaft noch ein freier Wille und ein Bewusstsein. Beide würden reichen, damit eine neue Welt zu gestalten.
Doch die Erfahrungen gehen in eine andere Richtung: in allen seinen Intentionen muss der Mensch Niederlagen hinnehmen und bedarf deshalb des Trostes. Er findet ihn in der Fortschrittsidee, die in der Wissenschaft ihr Instrument findet und gerade mit Entzauberung der Welt die humanistischen Ersatzreligionen umso mehr hervorruft und bestärkt; abgesehen davon, dass sie aus Europa den einzigen säkularen, das heißt religionsfernen Erdteil macht.
"In der Wissenschaft ist Erkenntnis etwas unvermischt Gutes, während sie in Ethik und Politik sowohl positive als auch negative Aspekte hat. Wissenschaft mehrt die Macht des Menschen – und vervielfacht die Wirkung seiner Schwächen. Sie lässt uns länger und behaglicher leben als unsere Vorfahren. Wissenschaft offeriert uns ein Fortschrittsgefühl, das wir in Politik und Ethik vergeblich suchen."
John Gray sieht noch mehr Indizien für Ersatzreligion – so in der Suche nach einem Sinn in der Geschichte und nach Wahrheit. Doch das ist ein müßiges Unterfangen, weil beide mit der Evolution nichts zu schaffen haben:
"Der Darwinschen Theorie ist zu entnehmen, dass für Überleben und Fortpflanzung kein Interesse an der Wahrheit vonnöten ist. In den meisten Fällen wäre es von Nachteil. Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit."
Es ist unbestreitbar: ein Menschenbild, das den Möglichkeiten menschlichen Handelns entspricht, bewahrt vor irrealen Zielen, zumal sie auf Ideologien beruhen und von fanatischen Eliten durchgesetzt werden wollen. Das 20. Jahrhundert war angefüllt damit, einen "Neuen Menschen" in gemachter Geschichte hervorzupeitschen.
Doch wie sieht der Autor selbst sein Ergebnis? Was schlägt er vor? Er übergibt uns keinen Bauplan, kein Ziel, keine Projekte, sondern nur eine Sicht der Dinge – einen Menschen ohne die Überfrachtungen mit Philosophie und ersatzreligiösen Ansprüchen:
"Gut zu leben bedeutet heute, den größtmöglichen Nutzen aus Wissenschaft und Technik zu ziehen – ohne der Illusion zu erliegen, sie könnten uns frei und vernünftig oder auch nur verstandesklar machen. Es bedeutet, nach Frieden zu streben – ohne auf eine Welt ohne Kriege zu hoffen. Es bedeutet, die Freiheit als kostbares Gut zu schätzen – und sich darüber im Klaren zu sein, dass sie immer nur ein Intermezzo zwischen Anarchie und Tyrannei ist. Das gute Leben ist nicht in Fortschrittsträumen zu finden, sondern im Bewältigen der unentrinnbaren Tragik schicksalhafter Zufälle."
Der Autor spielt mit dem Gedanken einer heroischen Lebensauffassung und ist konsequent genug, zu Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger je ein kompaktes Kapitel zu liefern. Er fordert zugleich, im Menschenbild zur Nüchternheit darwinscher Evolution zurückzukehren. Ob das gelingt?!
Der Mensch mag ein Säugetier sein, aber die Tatsache biologischer Frühgeburt macht ihn weltoffen, geistig beweglich, kreativ - und vor allem unstillbar neugierig. Er kennt auch als Einziger seine Großeltern und fühlt sich in genealogischer Erbfolge. Das verschafft ihm eine persönliche Geschichte und eine Gruppenbindung. Der Autor hat Recht, wenn er auch "anderen Tieren" Sprache zubilligt, doch abstraktes Denken, Symbolbildung und "Kulturverstehen" gehören allein dem Menschen.
Die Darwinsche Forderung an jedwede Spezies, Dauerhaftigkeit und ausreichend Nachwuchs zu sichern, sollte auch Anlass sein, in Zeiten des Artenschwunds und der Bevölkerungsungleichgewichte die Ökosysteme des Menschen "und anderer Tiere" zu überprüfen. John Grays Werk kann man hierzu heranziehen. Es bestätigt eigenes Wissen und reizt zu Ergänzung und Widerspruch.
John Gray: Von Menschen und anderen Tieren - Abschied vom Humanismus
Klett-Cotta/Stuttgart, 2010
Man kennt die Attribute, mit denen sich der Mensch zum Wesen höherer Art erklärt: es sind Vernunftbegabung, Fortschrittsglaube, Wissenschaft. Aber diese stolzen Eigenheiten des Menschen sind, genau besehen, nichts als Tröstungen über das unausgesprochene Eingeständnis, das tierische Wesen in sich doch nicht ablegen zu können und bei allen Versuchen, darüber hinauszuwachsen, immer wieder scheitern zu müssen.
John Gray nennt alle die Denk- und Handlungsweisen, die von einer Sonderstellung des Menschen ausgehen, "Humanismus". Das ist zu bedenken, weil im deutschen Verständnis von Humanismus der ehrfurchtsvolle Dienst an der Menschheit gemeint ist.
Der Mensch vollführt mit seinesgleichen keine Fortschritte, sondern bleibt in einer zyklischen Bewegung von Gewinn und Verlust gefangen und steht fassungslos vor seinen Rückschlägen. Das Buch liest sich wie ein "Zurück zur eigenen Natur!", doch nicht wie eine literarische Anweisung nach Jean-Jacques Rousseau, sondern wie eine Reparatur-Anleitung nach Abstürzen:
"Als die abendländische Kultur noch ganz von der Religion bestimmt war, konnte sie offen zugestehen, dass das irdische Leben hart ist, denn sie stellte eine andere Welt in Aussicht, in der alle Tränen getrocknet werden. Der Humanismus, der die Stelle der Religion eingenommen hat, propagiert eine noch weniger glaubhafte Phantasie, nämlich dass in der Zukunft, ja sogar in naher Zukunft jedem das Glück offensteht. Gesellschaften, die auf einen Fortschrittsglauben gegründet sind, können sich mit dem ganz normalen Unglück des menschlichen Lebens nicht abfinden."
Der Mensch flüchtet daraufhin in das Selbstbild einer geschlossenen höheren Wesenheit und in rastloses Tätigsein, nur um der Vergeblichkeit seiner Bemühungen nicht innezuwerden. Und so gibt er sich Täuschungen hin, die ihn von den Lebewesen abheben, vor der ganzen Kreatur auszeichnen – und da wären neben Vernunft, Fortschritt und Wissenschaft noch ein freier Wille und ein Bewusstsein. Beide würden reichen, damit eine neue Welt zu gestalten.
Doch die Erfahrungen gehen in eine andere Richtung: in allen seinen Intentionen muss der Mensch Niederlagen hinnehmen und bedarf deshalb des Trostes. Er findet ihn in der Fortschrittsidee, die in der Wissenschaft ihr Instrument findet und gerade mit Entzauberung der Welt die humanistischen Ersatzreligionen umso mehr hervorruft und bestärkt; abgesehen davon, dass sie aus Europa den einzigen säkularen, das heißt religionsfernen Erdteil macht.
"In der Wissenschaft ist Erkenntnis etwas unvermischt Gutes, während sie in Ethik und Politik sowohl positive als auch negative Aspekte hat. Wissenschaft mehrt die Macht des Menschen – und vervielfacht die Wirkung seiner Schwächen. Sie lässt uns länger und behaglicher leben als unsere Vorfahren. Wissenschaft offeriert uns ein Fortschrittsgefühl, das wir in Politik und Ethik vergeblich suchen."
John Gray sieht noch mehr Indizien für Ersatzreligion – so in der Suche nach einem Sinn in der Geschichte und nach Wahrheit. Doch das ist ein müßiges Unterfangen, weil beide mit der Evolution nichts zu schaffen haben:
"Der Darwinschen Theorie ist zu entnehmen, dass für Überleben und Fortpflanzung kein Interesse an der Wahrheit vonnöten ist. In den meisten Fällen wäre es von Nachteil. Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit."
Es ist unbestreitbar: ein Menschenbild, das den Möglichkeiten menschlichen Handelns entspricht, bewahrt vor irrealen Zielen, zumal sie auf Ideologien beruhen und von fanatischen Eliten durchgesetzt werden wollen. Das 20. Jahrhundert war angefüllt damit, einen "Neuen Menschen" in gemachter Geschichte hervorzupeitschen.
Doch wie sieht der Autor selbst sein Ergebnis? Was schlägt er vor? Er übergibt uns keinen Bauplan, kein Ziel, keine Projekte, sondern nur eine Sicht der Dinge – einen Menschen ohne die Überfrachtungen mit Philosophie und ersatzreligiösen Ansprüchen:
"Gut zu leben bedeutet heute, den größtmöglichen Nutzen aus Wissenschaft und Technik zu ziehen – ohne der Illusion zu erliegen, sie könnten uns frei und vernünftig oder auch nur verstandesklar machen. Es bedeutet, nach Frieden zu streben – ohne auf eine Welt ohne Kriege zu hoffen. Es bedeutet, die Freiheit als kostbares Gut zu schätzen – und sich darüber im Klaren zu sein, dass sie immer nur ein Intermezzo zwischen Anarchie und Tyrannei ist. Das gute Leben ist nicht in Fortschrittsträumen zu finden, sondern im Bewältigen der unentrinnbaren Tragik schicksalhafter Zufälle."
Der Autor spielt mit dem Gedanken einer heroischen Lebensauffassung und ist konsequent genug, zu Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger je ein kompaktes Kapitel zu liefern. Er fordert zugleich, im Menschenbild zur Nüchternheit darwinscher Evolution zurückzukehren. Ob das gelingt?!
Der Mensch mag ein Säugetier sein, aber die Tatsache biologischer Frühgeburt macht ihn weltoffen, geistig beweglich, kreativ - und vor allem unstillbar neugierig. Er kennt auch als Einziger seine Großeltern und fühlt sich in genealogischer Erbfolge. Das verschafft ihm eine persönliche Geschichte und eine Gruppenbindung. Der Autor hat Recht, wenn er auch "anderen Tieren" Sprache zubilligt, doch abstraktes Denken, Symbolbildung und "Kulturverstehen" gehören allein dem Menschen.
Die Darwinsche Forderung an jedwede Spezies, Dauerhaftigkeit und ausreichend Nachwuchs zu sichern, sollte auch Anlass sein, in Zeiten des Artenschwunds und der Bevölkerungsungleichgewichte die Ökosysteme des Menschen "und anderer Tiere" zu überprüfen. John Grays Werk kann man hierzu heranziehen. Es bestätigt eigenes Wissen und reizt zu Ergänzung und Widerspruch.
John Gray: Von Menschen und anderen Tieren - Abschied vom Humanismus
Klett-Cotta/Stuttgart, 2010
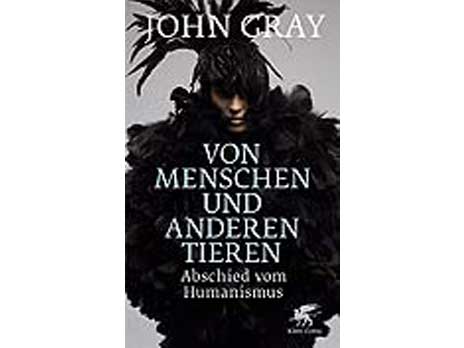
Cover: "John Gray: Von Menschen und anderen Tieren"© Klett-Cotta
