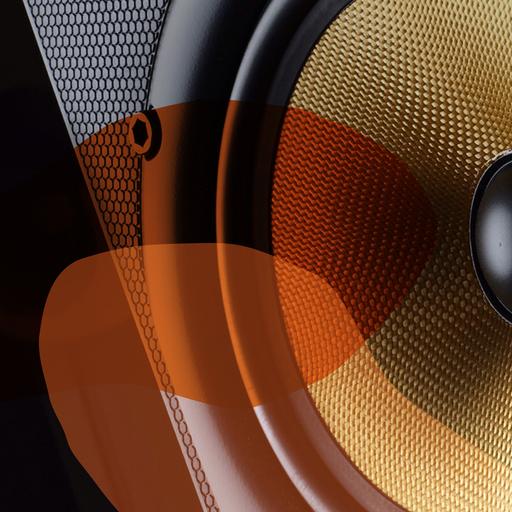Arno Frank, geboren 1971 in Kaiserslautern, ist Publizist. Von 1999 bis 2011 war er bei der Tageszeitung "taz" in verschiedenen Funktionen tätig – zuletzt als Ressortleiter des von ihm mitgegründeten Gesellschaftsteils. Seit 2011 schreibt er frei, unter anderem für den "Spiegel", "Spiegel Online", "Die Zeit", das Gesellschaftsmagazin "Dummy", den "Fluter" und nach wie vor für die "taz". Als Essayist und Schriftsteller veröffentliche er bisher "Meute mit Meinung – Versuch über die Schwarmdummheit" (Kein & Aber, Zürich 2013), "Mehr Musenküsse – Die täglichen Rituale berühmter Künstler" (mit Mason Currey, Los Angeles, Kein & Aber, Zürich 2015) sowie den Roman "So, und jetzt kommst du" (Klett-Cotta/Tropen, Stuttgart 2017).
Mit Tunnelblick durchs Leben

Smartphones machen es möglich: Fotos überall, jederzeit und von allem zu schießen. Der Publizist Arno Frank fordert uns auf, besonderen Momenten endlich wieder beizuwohnen - statt sofort unsere leuchtenden Geräte zu zücken, um sie zu dokumentieren.
Warum fotografieren wir? Um Eindrücke festzuhalten. Um etwas, das wir gesehen oder erlebt haben, mit anderen Menschen zu teilen. Früher, die Älteren unter uns erinnern sich, mussten wir zu diesem Zweck im Besitz einer Kamera sein, das Motiv sorgfältig in den Sucher nehmen, im richtigen Moment den Auslöser drücken – und dann eine Woche warten, bis die Bilder aus der Entwicklung kamen.
Heute tragen wir alle – auch die Älteren – rund um die Uhr eine Kamera mit uns herum, auf dem Smartphone, als sogenannte "Killer-Applikation", die vor allem den klassischen Fotoapparat "gekillt" hat. Alles wird Schnappschuss oder Botschaft, manchmal sogar künstlerischer Ausdruck. Jeder Mensch ein Andy Warhol.
Handykameras verführen zur Totalaufzeichnung
Mit dem Handy haben wir aber nicht nur eine Kamera in der Hand. Wir alle tragen ein gigantisches Fotoalbum mit uns herum – und damit ein gutes Stück unserer Vergangenheit. Zugleich ein Fotolabor, um diese Vergangenheit beliebig ins rechte Licht zu rücken. Und einen Sender, um es an jeden beliebigen Empfänger zu verschicken. Das Smartphone ist Notizbuch und Gedächtnisstütze. Polaroid und Postkarte. Intime Impression und weltweite Nachricht.
Es ist aber auch ein Instrument, dessen Macht nicht unterschätzt werden sollte. Es kann, wie ein Hammer, Werkzeug oder Waffe sein. Wer aber immer einen Hammer zu Hand hat, für den sieht bald alles aus wie ein Nagel. Ein Ding, mit dem man alles machen kann, macht auch etwas mit einem selber.
Mit dem Smartphone ist ein Sonnenuntergang oder ein Kindergeburtstag kein Ereignis mehr, das verinnerlicht und damit erlebt werden will. Es ist ein Motiv, das fotografiert und damit festgehalten werden muss, bestenfalls in serieller Dokumentation. Im Englischen gibt es für den Zwang zur Dokumentation von allem schon einen Ausdruck, der zugleich ein Imperativ ist: "Pics ... or it didn't happen!"
Was nicht im Bild fixiert wurde, das ist nicht passiert. So befinden wir uns auf dem besten Weg zur Totalaufzeichnung dessen, was wir unseren Alltag nennen. Unser Leben.
Fotoarchiv wird zur digitalen Müllhalde
Auf der Suche nach dem Motiv, beim Tasten nach dem Smartphone verpassen wir womöglich das Wichtigste, das Leben selbst, seine Veränderlichkeit und Komplexität. Wie ein Vogelschwarm durch den Sonnenuntergang fliegt, oder das Kind auf der Bühne unseren Blick sucht und dann auch findet.
Wenn also zwischen mir und dem Wahrgenommenen eine Verbindung besteht, die über den Blick aufs Display hinausgeht – und möglicherweise sogleich wieder verweht. Und vielleicht wünschen sich auch unsere Kinder, dass wir ihrem Theaterspiel einfach zuschauen, wirklich beiwohnen – statt ihnen unsere leuchtenden Geräte entgegenzuhalten.
Dabei ist dieses vermeintliche Festhalten eigentlich ein Entgleitenlassen. Wir erinnern nichts mehr, wir lagern nur aus, vom Kopf in die Cloud oder auf die externe Festplatte. Dort liegen 3000 Fotos, die wir alle noch nicht gesichtet haben und, seien wir ehrlich, auch niemals kuratieren werden. Eine digitale Müllhalde.
Nach Motiven fahnden statt besondere Momente erleben
Die Möglichkeit zur sofortigen Fixierung von schlechterdings allem verändert unseren Blick auf die Welt. Wer nur noch nach Motiven fahndet, der bringt sich um exakt jene Augenblicke und Ansichten, die er doch so gerne verewigen will.
Es stimmt schon: Von Kulturpessimisten ist bisher noch jeder technische Fortschritt als Bedrohung wahrgenommen worden. Es hat aber noch keinen Fortschritt gegeben, für den nicht andernorts zu zahlen gewesen wäre.
Hin und wieder sollten wir abwägen, was es uns wirklich bringt – und was es uns nimmt. Und welchen Preis wir dafür zu zahlen bereit sind.