Handeln statt reden
Gutmenschen haben für Management Trainer Boris Grundl große Absichten - sie scheuen aber die eigene Verantwortung. Etwas verändern kann für ihn nur, wer handelt anstatt nur über Probleme zu diskutieren.
"Es mangelt Gutmenschen an Selbsterkenntnis."
Na, das fängt ja schon mal mit einer Salve an.
" ... ich habe gemerkt, wie dick die süßliche Glasur von sozialer Gerechtigkeit und Moral ist, mit der sie unser Land überziehen und zur Erstarrung bringen. Wie schwer ihre Macht zu brechen, ja wie unmenschlich sie ist, weil sie die wahre Größe des Menschen leugnet, die in seiner Entwicklungsfähigkeit liegt."
Und mit solchen Paukenschlägen geht das Buch auch weiter. Also eine der üblichen Provokationen gegen das politisch Korrekte, wie wir sie kennen? Schon. Oder auch nicht. Boris Grundl ist Management Trainer, und das sehr erfolgreich. Was er sagt, bestimmt also in dem einen oder anderen Fall womöglich die Strategien von Schlüsselunternehmen. Und da wird es schon interessant, einmal genauer hinzusehen. Für Grundl sind Gutmenschen jene, die große Absichten haben, aber eigene Verantwortung scheuen. Die lieber Probleme haben als sie zu lösen. Die Gerechtigkeit fordern und dabei das Mittelmaß fördern. Die Kreativität und Produktivität ersticken.
Spricht hier ein Provo der Unternehmenskultur? Ja und nein. Seine Analyse und seine Pointen sind eingängig und auf ein Publikum zugeschnitten, dass "gecoacht" werden, also auf den Weg zum Erfolg gebracht werden will. Sein Publikum liest wahrscheinlich eher das Handelsblatt als das Feuilleton und kümmert sich wenig um den neuesten Intellektuellenstreit.
Umso deutlicher wird, dass in der Debatte ums Gute und um die Moral nicht der politische Streitwert allein entscheidend ist – sondern die volkswirtschaftliche Summe. Der deutsche Hang zum Moralisieren hat handfeste ökonomische Folgen. Denn: Wer heilen will, braucht Kranke. Wer hilft, braucht Menschen, denen man helfen muss. Kurz: Es geht um die entmündigenden Folgen einer Kultur, die Menschen lieber als Opfer wahrnimmt, damit man sie nicht als Konkurrenten fürchten muss. Die Entwicklungshilfe für Afrika etwa, das hat sich herumgesprochen, fordert nicht und fördert meistens die Bereicherungslust einheimischer Clanchefs.
Doch warum wollen viele diesen Zusammenhang nicht wahrnehmen? Weil sich unangreifbar macht, wer sich auf höhere Werte bezieht. Weil die Moralgewissheit einen Urtrieb befriedigt: den Egoismus.
"Stets ist es das Ego, das mit dem Gefühl genährt werden möchte, immer auf der richtigen Seite zu stehen und Verteidiger einer unumstößlichen Wahrheit zu sein. Moralisten wollen ihre Überlegenheitsgefühle auskosten und sonst nichts. Moralisten kreisen nur um sich selbst."
Boris Grundl ist ein Linkenfresser, das ist mal klar. Von Che Guevara bis Summerhill: Er zerschreddert mit beispielgesättigter Inbrunst linke und antiautoritäre Mythen. Bei allem Verständnis für die Lust am Abwatschen des ideologischen Gegners: Auf die Dauer ist das wenig spannend. Wichtiger ist die Frage dahinter: Was macht einen Menschen kreativ und produktiv und was behindert seine Entwicklung? Grundls Antwort: Die größten Hindernisse sind Harmoniesucht, Menscheln, Verantwortungsscheu und Kapitalismushass.
Die Erfolge rechtspopulistischer Politiker wie Geert Wilders in den Niederlanden rechnet er folgerichtig der holländischen Konsensgesellschaft zu: Man habe in Wohlfühlholland den Streit und die Auseinandersetzung verlernt und begreife erst jetzt wieder, dass man sich entscheiden müsse, wie man leben will.
"Die Gutmenschen glauben mit grenzenloser Selbstüberschätzung, die Welt würde allein dadurch ein besserer Ort, dass man über sie diskutiert. Doch wirklich etwas verändern kann nur, wer sich auf das konzentriert, was ihm gegeben ist und worauf er Einfluss hat."
Derlei Sätze kennt man aus Selbsthilfebüchern, deren Botschaften einfach und austauschbar sind. Als politisches Manifest schmiert das Buch ab. Denn Analyse ist des Autors Sache nicht – auf die hofft vergebens, wer wissen will, warum so viele Menschen das Offensichtliche nicht begreifen wollen: die schlichte Wahrheit etwa, dass man Starke braucht, wenn den Schwachen geholfen werden soll.
Als Einstimmungsrap für die Leistungsträger der deutschen Volkswirtschaft aber dürfte das Buch taugen. In diesem Sinne möchte man allen deutschen Unternehmen und ihren Führungskräften zurufen: Schluss mit den Parolen, es gibt viel zu tun, seid nicht Teil des Problems, werdet endlich Teil der Lösung!
Boris Grundl: "Diktatur der Gutmenschen. Was Sie sich nicht gefallen lassen dürfen, wenn Sie etwas bewegen wollen"
Econ Verlag, Berlin/2010
Na, das fängt ja schon mal mit einer Salve an.
" ... ich habe gemerkt, wie dick die süßliche Glasur von sozialer Gerechtigkeit und Moral ist, mit der sie unser Land überziehen und zur Erstarrung bringen. Wie schwer ihre Macht zu brechen, ja wie unmenschlich sie ist, weil sie die wahre Größe des Menschen leugnet, die in seiner Entwicklungsfähigkeit liegt."
Und mit solchen Paukenschlägen geht das Buch auch weiter. Also eine der üblichen Provokationen gegen das politisch Korrekte, wie wir sie kennen? Schon. Oder auch nicht. Boris Grundl ist Management Trainer, und das sehr erfolgreich. Was er sagt, bestimmt also in dem einen oder anderen Fall womöglich die Strategien von Schlüsselunternehmen. Und da wird es schon interessant, einmal genauer hinzusehen. Für Grundl sind Gutmenschen jene, die große Absichten haben, aber eigene Verantwortung scheuen. Die lieber Probleme haben als sie zu lösen. Die Gerechtigkeit fordern und dabei das Mittelmaß fördern. Die Kreativität und Produktivität ersticken.
Spricht hier ein Provo der Unternehmenskultur? Ja und nein. Seine Analyse und seine Pointen sind eingängig und auf ein Publikum zugeschnitten, dass "gecoacht" werden, also auf den Weg zum Erfolg gebracht werden will. Sein Publikum liest wahrscheinlich eher das Handelsblatt als das Feuilleton und kümmert sich wenig um den neuesten Intellektuellenstreit.
Umso deutlicher wird, dass in der Debatte ums Gute und um die Moral nicht der politische Streitwert allein entscheidend ist – sondern die volkswirtschaftliche Summe. Der deutsche Hang zum Moralisieren hat handfeste ökonomische Folgen. Denn: Wer heilen will, braucht Kranke. Wer hilft, braucht Menschen, denen man helfen muss. Kurz: Es geht um die entmündigenden Folgen einer Kultur, die Menschen lieber als Opfer wahrnimmt, damit man sie nicht als Konkurrenten fürchten muss. Die Entwicklungshilfe für Afrika etwa, das hat sich herumgesprochen, fordert nicht und fördert meistens die Bereicherungslust einheimischer Clanchefs.
Doch warum wollen viele diesen Zusammenhang nicht wahrnehmen? Weil sich unangreifbar macht, wer sich auf höhere Werte bezieht. Weil die Moralgewissheit einen Urtrieb befriedigt: den Egoismus.
"Stets ist es das Ego, das mit dem Gefühl genährt werden möchte, immer auf der richtigen Seite zu stehen und Verteidiger einer unumstößlichen Wahrheit zu sein. Moralisten wollen ihre Überlegenheitsgefühle auskosten und sonst nichts. Moralisten kreisen nur um sich selbst."
Boris Grundl ist ein Linkenfresser, das ist mal klar. Von Che Guevara bis Summerhill: Er zerschreddert mit beispielgesättigter Inbrunst linke und antiautoritäre Mythen. Bei allem Verständnis für die Lust am Abwatschen des ideologischen Gegners: Auf die Dauer ist das wenig spannend. Wichtiger ist die Frage dahinter: Was macht einen Menschen kreativ und produktiv und was behindert seine Entwicklung? Grundls Antwort: Die größten Hindernisse sind Harmoniesucht, Menscheln, Verantwortungsscheu und Kapitalismushass.
Die Erfolge rechtspopulistischer Politiker wie Geert Wilders in den Niederlanden rechnet er folgerichtig der holländischen Konsensgesellschaft zu: Man habe in Wohlfühlholland den Streit und die Auseinandersetzung verlernt und begreife erst jetzt wieder, dass man sich entscheiden müsse, wie man leben will.
"Die Gutmenschen glauben mit grenzenloser Selbstüberschätzung, die Welt würde allein dadurch ein besserer Ort, dass man über sie diskutiert. Doch wirklich etwas verändern kann nur, wer sich auf das konzentriert, was ihm gegeben ist und worauf er Einfluss hat."
Derlei Sätze kennt man aus Selbsthilfebüchern, deren Botschaften einfach und austauschbar sind. Als politisches Manifest schmiert das Buch ab. Denn Analyse ist des Autors Sache nicht – auf die hofft vergebens, wer wissen will, warum so viele Menschen das Offensichtliche nicht begreifen wollen: die schlichte Wahrheit etwa, dass man Starke braucht, wenn den Schwachen geholfen werden soll.
Als Einstimmungsrap für die Leistungsträger der deutschen Volkswirtschaft aber dürfte das Buch taugen. In diesem Sinne möchte man allen deutschen Unternehmen und ihren Führungskräften zurufen: Schluss mit den Parolen, es gibt viel zu tun, seid nicht Teil des Problems, werdet endlich Teil der Lösung!
Boris Grundl: "Diktatur der Gutmenschen. Was Sie sich nicht gefallen lassen dürfen, wenn Sie etwas bewegen wollen"
Econ Verlag, Berlin/2010
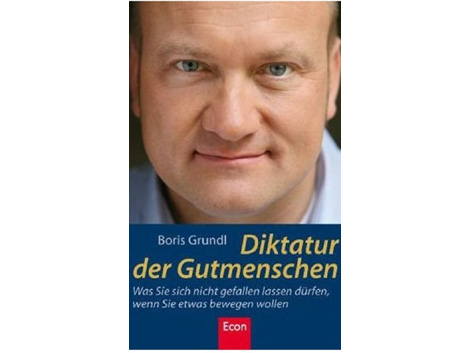
Buchcover: Boris Grundl: "Diktatur der Gutmenschen. Was Sie sich nicht gefallen lassen dürfen, wenn Sie etwas bewegen wollen"© Econ Verlag
