Großgrundbesitzer des Geistes
Es ist ein 700 Seiten starker Band und er würdigt einen außergewöhnlichen Philosophen: Jan Philipp Reemtsma wird 60. Die Festschrift ist dabei mehr als eine Reihe an pflichtschuldigen Dankesadressen - die Beiträge widmen sich ausnahmslos seinen großen Lebensthemen.
Er liebt die Philosophie, aber nicht die Philosophen. Er hat sie schon mal mit tollen Hunden verglichen und behauptet, er zöge einem Philosophen jederzeit einen sprechenden Kürbis vor.
Allerdings: Kürbisse verfassen keine Festschriften, und erst recht keinen krachenden 700-Seiten-Klotz, wie er jetzt dem Hamburger Literaturwissenschaftler, Publizisten und Mäzen Jan Philipp Reemtsma zu seinem 60. Geburtstag gewidmet wurde.
Die Herausgeber eröffnen den Band nicht ohne Hintersinn mit einem feinen Aufsatz der Philosophin Susan Neiman, die Reemtsmas Philosophenschelte als Ausdruck zwiespältiger Liebe zur Denkerzunft sieht, "denn nur Philosophen leiden wirklich darunter, was die Zunft aus der Philosophie macht".
"Man bringt ihnen bei, dass es ein Zeichen von gutem Geschmack ist, ihre Intelligenz auf die Lösung von Rätseln zu verwenden, und ein Zeichen von peinlicher Naivität, wenn sie sich den Fragen zuwenden würden, die sie ursprünglich zur Philosophie gebracht haben."
Gegen akademischen Stumpfsinn hilft nur Witz. Schon Pascal schrieb in seinen Pensées: "Sich über die Philosophie lustig machen, das heißt in Wahrheit philosophieren".
Wer Jan Philipp Reemtsma persönlich erlebt hat, der weiß, dass hinter der immer wieder aufblitzenden Spottlust dieses fast schüchtern wirkenden Menschen ein tiefes Interesse an den grundlegenden Themen unserer Kultur und Gesellschaft steckt, an Themen wie Angst, Macht, Vertrauen und Gewalt.
Im Land der Dichter und Denker ist Reemtsma ein Sonderfall: Ein öffentlicher Privatgelehrter, akademisch versiert und doch in vielem universeller Autodidakt und auch darin ein Glücksfall unter all den verzopften deutschen Denker-Meistern, die sich am liebsten der Verwaltung ihres geisteswissenschaftlichen Gartenwinkels widmen.
Reemtsma dagegen ist kein Schrebergärtner, sondern ein Großgrundbesitzer des Geistes. Freilich: als Erbe eines Tabakunternehmers kann es sich der Hamburger Patriziersohn im wahrsten Sinne des Wortes leisten, die Grenzen seiner intellektuellen Neugier ohne Rücksicht auf ökonomische Notwendigkeiten weiträumig abzustecken.
Diesem weiten Feld haben die Herausgeber der Festschrift den gebührenden Respekt gezollt, indem sie Beiträge aus den unterschiedlichsten Disziplinen versammelt haben:
"Philosophie und Kunst, Literatur, Theater und Film, Soziologie und Sozialtheorie, Recht und Rechtstheorie: auch sie haben in diesem Band ihren Ort; erst dadurch rundet sich das Bild, wird das Profil eines Gelehrten deutlich, dem viele mit großem Dank für vieles verpflichtet sind."
Wie ist das alles unter einen Hut zu bringen? Die "Festschrift" ist ein so urdeutsches Genre, dass sich der Name sogar im Angelsächsischen eingebürgert hat. Im schlimmsten Fall handelt es sich um eine Reihe pflichtschuldiger Gruß- und Dankadressen ehemaliger Schüler und Protegés, deren einziges gemeinsames Merkmal der süßliche Duft akademischer Selbstbeweihräucherung ist.
Im günstigsten Fall - und der liegt hier vor - widmen sich die Beiträge den Interessen des Geehrten aus den unterschiedlichsten Perspektiven und bilden so einen Spiegel seines Lebenswerks.
Eines der Lebensthemen Jan Philipp Reemtsmas ist die Gewalt. Er hat sie nicht nur als Entführungsopfer am eigenen Leib erfahren und darüber mit seinem Tatsachenbericht "Im Keller" einen Bestseller geschrieben. Er hat sie auch geistig immer wieder umkreist als ein Grundproblem der Moderne im 20. Jahrhundert und sich die Frage gestellt:
"Ist das Säugling-mit-dem-Kopf-gegen-eine-Wand-schlagen, von dem wir immer wieder lesen müssen, eine habituelle Handlung des Homo sapiens oder eine habituelle Phantasie, die er über seinesgleichen anstellt?
Ist es unvorstellbar, dass solche Leute Kinder auf ihren Knien geschaukelt haben? Wir mögen es uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass es durch die Geschichte so gewesen ist."
Der zivilisatorischen Enttäuschung des 20. Jahrhunderts durch Weltkriege, Genozide und Terror hat Jan Philipp Reemtsma das Vertrauen in die Moderne entgegengesetzt. Die beiden Begriffe Gewalt und Vertrauen ziehen sich als roter Faden durch die Festschrift.
Da schreibt der Historiker Michael Wildt über die "Gewaltkonstruktion des Volkes" in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, der Politologe Wolfgang Kraushaar untersucht Michael Kohlhaas als Projektionsfigur der 68er-Bewegung und der Neurobiologe Gerhard Roth denkt über den "freien Willen" bei Gewaltstraftätern nach.
Selbst die schöngeistigen Interessen Reemtsmas sind davon nicht ausgenommen, der als großzügiger Mäzen und kluger Leser den Werken seiner Hausgötter Christoph Martin Wieland und Arno Schmidt neue Aufmerksamkeit verschafft hat. Der Literaturwissenschaftler Bernd Rauschenbach etwa befasst sich in seinem Essay "Prügel und Wörter" mit dem ambivalenten Verhältnis Arno Schmidts zu seinem Vater:
"Er war freiwilliger Berufssoldat und ist Sergeant geworden; er war Polizeioberwachtmeister, hat mit Kollegen gezotet, Huren und Geliebte gehabt und seine Kinder verprügelt. Aber seinem Sohn hat er von zauberhaften Dingen erzählt, ihm geheimnisvolle Wörter geschenkt und die unendlichen Weiten der Literatur gewiesen."
Die Macht der Gewalt und die Macht des Wortes - sie bilden den Spannungsbogen im Denken Jan Philipp Reemtsmas, über den Susan Neiman schreibt:
"Es geht ja um einen Menschen, der permanent an den Klippenrändern tanzt, von denen die meisten irgendwann abstürzen - in den einen oder anderen Abgrund des Zynismus. Stattdessen hat er eine glänzende Widerlegung des Zynismus vorgelegt."
Also doch: ein Philosoph, aber einer, der Scharfsinn mit Schönheitssinn zu verbinden weiß und wohl auch deshalb Schriften wie Kants "Kritik der reinen Vernunft" als antiaufklärerisch sieht. In einem Punkt muss ihm sogar die Philosophin Niemann zustimmen:
"Kant war nicht der erste lausige Schriftsteller in der Geschichte der Philosophie… Was für Kant der Witz der ganzen Anstrengung ist, wird erst nach 800 Seiten erreicht, zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Leser entweder eingeschlafen sind … oder sich aussichtsreicheren Schriften zugewandt haben."
Nichts davon droht Lesern dieser außergewöhnlichen Festschrift für einen außergewöhnlichen Denker, denn die Autoren haben sich an ein anderes Motto Jan Philipp Reemtsmas gehalten:
"Die Leute langweilen: das ist das einzige, was man nicht tun darf."
Allerdings: Kürbisse verfassen keine Festschriften, und erst recht keinen krachenden 700-Seiten-Klotz, wie er jetzt dem Hamburger Literaturwissenschaftler, Publizisten und Mäzen Jan Philipp Reemtsma zu seinem 60. Geburtstag gewidmet wurde.
Die Herausgeber eröffnen den Band nicht ohne Hintersinn mit einem feinen Aufsatz der Philosophin Susan Neiman, die Reemtsmas Philosophenschelte als Ausdruck zwiespältiger Liebe zur Denkerzunft sieht, "denn nur Philosophen leiden wirklich darunter, was die Zunft aus der Philosophie macht".
"Man bringt ihnen bei, dass es ein Zeichen von gutem Geschmack ist, ihre Intelligenz auf die Lösung von Rätseln zu verwenden, und ein Zeichen von peinlicher Naivität, wenn sie sich den Fragen zuwenden würden, die sie ursprünglich zur Philosophie gebracht haben."
Gegen akademischen Stumpfsinn hilft nur Witz. Schon Pascal schrieb in seinen Pensées: "Sich über die Philosophie lustig machen, das heißt in Wahrheit philosophieren".
Wer Jan Philipp Reemtsma persönlich erlebt hat, der weiß, dass hinter der immer wieder aufblitzenden Spottlust dieses fast schüchtern wirkenden Menschen ein tiefes Interesse an den grundlegenden Themen unserer Kultur und Gesellschaft steckt, an Themen wie Angst, Macht, Vertrauen und Gewalt.
Im Land der Dichter und Denker ist Reemtsma ein Sonderfall: Ein öffentlicher Privatgelehrter, akademisch versiert und doch in vielem universeller Autodidakt und auch darin ein Glücksfall unter all den verzopften deutschen Denker-Meistern, die sich am liebsten der Verwaltung ihres geisteswissenschaftlichen Gartenwinkels widmen.
Reemtsma dagegen ist kein Schrebergärtner, sondern ein Großgrundbesitzer des Geistes. Freilich: als Erbe eines Tabakunternehmers kann es sich der Hamburger Patriziersohn im wahrsten Sinne des Wortes leisten, die Grenzen seiner intellektuellen Neugier ohne Rücksicht auf ökonomische Notwendigkeiten weiträumig abzustecken.
Diesem weiten Feld haben die Herausgeber der Festschrift den gebührenden Respekt gezollt, indem sie Beiträge aus den unterschiedlichsten Disziplinen versammelt haben:
"Philosophie und Kunst, Literatur, Theater und Film, Soziologie und Sozialtheorie, Recht und Rechtstheorie: auch sie haben in diesem Band ihren Ort; erst dadurch rundet sich das Bild, wird das Profil eines Gelehrten deutlich, dem viele mit großem Dank für vieles verpflichtet sind."
Wie ist das alles unter einen Hut zu bringen? Die "Festschrift" ist ein so urdeutsches Genre, dass sich der Name sogar im Angelsächsischen eingebürgert hat. Im schlimmsten Fall handelt es sich um eine Reihe pflichtschuldiger Gruß- und Dankadressen ehemaliger Schüler und Protegés, deren einziges gemeinsames Merkmal der süßliche Duft akademischer Selbstbeweihräucherung ist.
Im günstigsten Fall - und der liegt hier vor - widmen sich die Beiträge den Interessen des Geehrten aus den unterschiedlichsten Perspektiven und bilden so einen Spiegel seines Lebenswerks.
Eines der Lebensthemen Jan Philipp Reemtsmas ist die Gewalt. Er hat sie nicht nur als Entführungsopfer am eigenen Leib erfahren und darüber mit seinem Tatsachenbericht "Im Keller" einen Bestseller geschrieben. Er hat sie auch geistig immer wieder umkreist als ein Grundproblem der Moderne im 20. Jahrhundert und sich die Frage gestellt:
"Ist das Säugling-mit-dem-Kopf-gegen-eine-Wand-schlagen, von dem wir immer wieder lesen müssen, eine habituelle Handlung des Homo sapiens oder eine habituelle Phantasie, die er über seinesgleichen anstellt?
Ist es unvorstellbar, dass solche Leute Kinder auf ihren Knien geschaukelt haben? Wir mögen es uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass es durch die Geschichte so gewesen ist."
Der zivilisatorischen Enttäuschung des 20. Jahrhunderts durch Weltkriege, Genozide und Terror hat Jan Philipp Reemtsma das Vertrauen in die Moderne entgegengesetzt. Die beiden Begriffe Gewalt und Vertrauen ziehen sich als roter Faden durch die Festschrift.
Da schreibt der Historiker Michael Wildt über die "Gewaltkonstruktion des Volkes" in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, der Politologe Wolfgang Kraushaar untersucht Michael Kohlhaas als Projektionsfigur der 68er-Bewegung und der Neurobiologe Gerhard Roth denkt über den "freien Willen" bei Gewaltstraftätern nach.
Selbst die schöngeistigen Interessen Reemtsmas sind davon nicht ausgenommen, der als großzügiger Mäzen und kluger Leser den Werken seiner Hausgötter Christoph Martin Wieland und Arno Schmidt neue Aufmerksamkeit verschafft hat. Der Literaturwissenschaftler Bernd Rauschenbach etwa befasst sich in seinem Essay "Prügel und Wörter" mit dem ambivalenten Verhältnis Arno Schmidts zu seinem Vater:
"Er war freiwilliger Berufssoldat und ist Sergeant geworden; er war Polizeioberwachtmeister, hat mit Kollegen gezotet, Huren und Geliebte gehabt und seine Kinder verprügelt. Aber seinem Sohn hat er von zauberhaften Dingen erzählt, ihm geheimnisvolle Wörter geschenkt und die unendlichen Weiten der Literatur gewiesen."
Die Macht der Gewalt und die Macht des Wortes - sie bilden den Spannungsbogen im Denken Jan Philipp Reemtsmas, über den Susan Neiman schreibt:
"Es geht ja um einen Menschen, der permanent an den Klippenrändern tanzt, von denen die meisten irgendwann abstürzen - in den einen oder anderen Abgrund des Zynismus. Stattdessen hat er eine glänzende Widerlegung des Zynismus vorgelegt."
Also doch: ein Philosoph, aber einer, der Scharfsinn mit Schönheitssinn zu verbinden weiß und wohl auch deshalb Schriften wie Kants "Kritik der reinen Vernunft" als antiaufklärerisch sieht. In einem Punkt muss ihm sogar die Philosophin Niemann zustimmen:
"Kant war nicht der erste lausige Schriftsteller in der Geschichte der Philosophie… Was für Kant der Witz der ganzen Anstrengung ist, wird erst nach 800 Seiten erreicht, zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Leser entweder eingeschlafen sind … oder sich aussichtsreicheren Schriften zugewandt haben."
Nichts davon droht Lesern dieser außergewöhnlichen Festschrift für einen außergewöhnlichen Denker, denn die Autoren haben sich an ein anderes Motto Jan Philipp Reemtsmas gehalten:
"Die Leute langweilen: das ist das einzige, was man nicht tun darf."
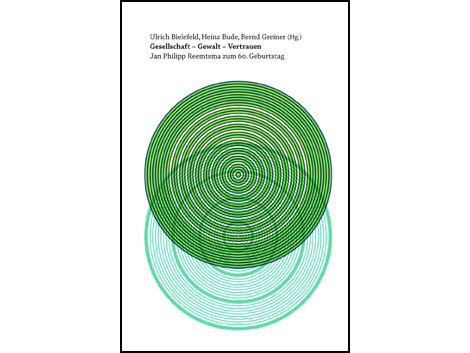
Bielefeld, Bude, Greiner - Gesellschaft, Gewalt, Vertrauen© Promo
Ulrich Bielefeld, Heinz Bude, Bernd Greiner: Gesellschaft - Gewalt - Vertrauen
Hamburger Edition, Hamburg 2013
703 Seiten, 30,00 Euro
Hamburger Edition, Hamburg 2013
703 Seiten, 30,00 Euro
