Grobschlächtige Schwarzweißmalerei
Nachdem sich Günter Ogger in den vergangenen Jahren die Führungsriege der Wirtschaft vorgeknöpft hat, ihre Gier und Verantwortungslosigkeit anprangerte und dafür vor allem aus dem Mittelbau der Gesellschaft Applaus erhielt, steht dieser Mittelbau nun selbst im Fokus Oggerscher Ermittlungen: das träge Angestelltenmilieu.
"Als Individuum trat er bescheiden auf. Ordentlich, aber nicht extravagant gekleidet, zeichnete er sich durch ein angenehmes, selten zum Widerspruch neigendes Wesen aus. Zum Problem wurde er erst durch seine massenhafte Verbreitung. Im Rudel entwickelte der Angestellte nämlich Eigenschaften, die seinen Nutzen erheblich einschränkten. Dazu gehörte etwa seine Neigung, sich und seinesgleichen für den Nabel des Unternehmens, wenn nicht des Universums zu halten."
Damit wird nun bald Schluss sein, sagt der Spezialist für Empörungsliteratur, Abteilung Ökonomie und angrenzende Gebiete, Günter Ogger. Nachdem er sich in den letzten Jahren die Führungsriege der Wirtschaft vorgeknöpft hat, ihre Gier und Verantwortungslosigkeit anprangerte und dafür vor allem aus dem Mittelbau der Gesellschaft Applaus erhielt, steht dieser Mittelbau nun selbst im Fokus Oggerscher Ermittlungen: das kreuzbrave, dafür aber träge Angestelltenmilieu der Bundesrepublik. 18 Millionen Menschen droht eine Zeitenwende, die mindestens so dramatisch verlaufen wird wie der Demografieschock der Überalterung.
Der deutsche "Luxusangestellte" mit 14 Monatsgehältern, Kündigungsschutz und betrieblicher Altersversorgung, der Konjunkturdellen bislang unbeschadet überstand, ja einen beträchtlichen Teil der nationalen Wertschöpfung auf sein Gehaltskonto umzuleiten vermochte, ohne dass dabei klar gewesen wäre, wie groß sein eigener Verdienst an dieser Wertschöpfung ist - dieser "Luxusangestellte" wird abdanken. Dabei meint Günter Ogger nicht die schon von anderen Autoren gescholtenen Angestellten des Öffentlichen Dienstes, sondern die graue Armee der "Privatbeamten", wie man sie im 19. Jahrhundert noch nannte. Sie, deren Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich über die Jahre hinweg sank, ohne dass die Bürokommunikationspausen merklich geschrumpft wären, müssen sich auf raue Zeiten gefasst machen. Der Milde des Dauerarbeitsplatzprivilegs ohne harsche Leistungskontrolle folgt nun der Stress permanenter Konkurrenz von außen:
"Unter dem verschärften Druck des globalisierten Wirtschaftsgeschehens wird sich die gute alte Angestelltenrepublik in eine offene Wettbewerbsgesellschaft verwandeln müssen, die den Tüchtigen belohnt, den Faulen und Unfähigen aber nur noch mit dem Nötigsten versorgt. Es wird nicht ohne Kampf abgehen, bis die Republik der Besitzstandswahrer und Umverteiler reformiert ist - doch der Prozess läuft und ist weder aufzuhalten noch umzudrehen."
So die These des Buches, die noch etwas zugespitzter lautet: Angestellte auf Höhe des gewohnten Versorgungsniveaus kann sich die nationale Volkswirtschaft Deutschlands nicht mehr leisten. Doch selbst ein versierter Wirtschaftsboulevardier wie Günter Ogger tut sich schwer, mit einem einzigen, mäßig provokanten Gedanken 300 Seiten zu füllen. Zahlen hat er fleißig aufgelesen, Faktenwissen und Anekdoten zusammengetragen - wie etwa die skurrile Tatsache, dass deutsche Büros doppelt so groß sind wie die aller anderen Europäer -, doch das verdeckt nur mühsam das Problem seiner Kampfschrift "Die Abgestellten". Schon im Titel kommt sie ungenau daher, eigentlich müsste von "Abgeschafften" die Rede sein, "abgestellt", sprich auf einen unattraktiven Arbeitsplatz verschoben, wird hierzulande ja immer noch bei weitgehend vollen Bezügen.
Dass effekthascherische Momente dem Autor wichtiger sind denn eine konsistente Gedankenführung, kündigt sich somit schon auf dem Schutzumschlag an. Auf ganzer Länge hat der Text dann ein immanentes Haltungsproblem. Für seine Pamphlete braucht Günter Ogger klar umrissene Feindbilder - doch er benötigt auch eine große Anhängerschaft, die diese Feindbilder teilt. Mehrheit gegen Minderheit, lautete sein Erfolgsrezept bislang. Diesmal kann es nicht aufgehen. Tatsächlich gehört der freiberufliche Publizist Günter Ogger selbst der Minderheit an, die sich gegen die angestellte Mehrheit zur Wehr setzt, zugleich aber von dieser ihr Auskommen bezieht. Fallen die Angestellten nämlich als Käufer aus, kann das Buch am Markt nicht reüssieren, jedenfalls kaum in Bestsellerhöhen. Die daraus resultierende Spaltung durchzieht den Text auf groteske Weise.
Kaum schießt Ogger sich aufs Feindbild des leistungsfeindlichen, überversorgten "Luxusangestellten" ein, muss er auch schon auf die Tränendrüse drücken, sich im konkreten Beispiel ins Leid eines mittleren Managers einfühlen, der von 250.000 Euro Jahresgehalt auf einen Job mit 70.000 Euro absteigt. Relational eine Verarmung, gewiss. In absoluten Werten gemessen aber bestenfalls eine Luxusschrumpfung, die alles verdient, bloß kein Mitleid. Besonders krass wird die Kluft zwischen sarkastisch-kämpferischem Tonfall auf der einen und mangelnder Feindbildkonsistenz auf der anderen Seite am Schluss des Buches. Nachdem das Zünglein an der Oggerschen Waage per saldo gegen die Angestelltenkultur ausschlagen hat, drückt der Autor zur Wahrung seiner Marktschancen schnell auf die andere Waagschale und imaginiert die Schreckensversion einer durchflexibilisierten Welt ohne Angestellte. Und siehe: Nichts geht mehr! Nein, schlimmer noch, ausgerechnet Günter Ogger bewirbt sich um den großen Naomi-Klein-Preis der Globalisierungsschwarzmalerei:
"Ärzte und Krankenhäuser verlangten Vorauszahlungen, Konsumentenkredite würden teurer. Ordnungskräfte und Reinigungsdienste bekämen reichlich zu tun, die Sicherheitsbranche verzeichnete satte Zuwachsraten. Die Anträge auf Ausstellung von Waffenscheinen häuften sich, die Villenvororte verwandelten sich in Hochsicherheitszonen, die Autohersteller verlegten sich auf Panzerfahrzeuge, und um die Ghettos der Armen zöge man Stacheldraht. Auf die ausufernde Kriminalität würde der Staat mit der totalen Überwachung seiner Bürger reagieren; zur Durchsetzung ihrer Zero-Tolerance-Policy würde die Polizei nach den neuesten Strahlenwaffen, Arrestkäfigen und elektronischen Fußfesseln verlangen."
Spätestens hier schlägt das anfängliche Amüsement der Lektüre in Verärgerung um: In seinen Auswirkungen ist der Untergang des Angestelltenmilieus viel zu kompliziert, als dass ihn ein grobschlächtiger Schwarzweißmaler wie Günter Ogger auch nur halbwegs zu prognostizieren vermochte. Leider haben hier ein wichtiges Thema und ein Autor zusammengefunden, die partout nicht zusammen passen wollen. Vielleicht etabliert der stets neue Trends witternde und überaus geschäftstüchtige Günter Ogger besser eine Börse, an der er seine Themen an Leute verkauft, die damit differenzierter umgehen. Geld verdienen könnte er so ebenfalls - nur mit viel weniger schweißtreibendem Aufwand.
Günter Ogger: Die Abgestellten - Nachruf auf einen festen Arbeitsplatz
C. Bertelsmann Verlag, München 2007
Damit wird nun bald Schluss sein, sagt der Spezialist für Empörungsliteratur, Abteilung Ökonomie und angrenzende Gebiete, Günter Ogger. Nachdem er sich in den letzten Jahren die Führungsriege der Wirtschaft vorgeknöpft hat, ihre Gier und Verantwortungslosigkeit anprangerte und dafür vor allem aus dem Mittelbau der Gesellschaft Applaus erhielt, steht dieser Mittelbau nun selbst im Fokus Oggerscher Ermittlungen: das kreuzbrave, dafür aber träge Angestelltenmilieu der Bundesrepublik. 18 Millionen Menschen droht eine Zeitenwende, die mindestens so dramatisch verlaufen wird wie der Demografieschock der Überalterung.
Der deutsche "Luxusangestellte" mit 14 Monatsgehältern, Kündigungsschutz und betrieblicher Altersversorgung, der Konjunkturdellen bislang unbeschadet überstand, ja einen beträchtlichen Teil der nationalen Wertschöpfung auf sein Gehaltskonto umzuleiten vermochte, ohne dass dabei klar gewesen wäre, wie groß sein eigener Verdienst an dieser Wertschöpfung ist - dieser "Luxusangestellte" wird abdanken. Dabei meint Günter Ogger nicht die schon von anderen Autoren gescholtenen Angestellten des Öffentlichen Dienstes, sondern die graue Armee der "Privatbeamten", wie man sie im 19. Jahrhundert noch nannte. Sie, deren Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich über die Jahre hinweg sank, ohne dass die Bürokommunikationspausen merklich geschrumpft wären, müssen sich auf raue Zeiten gefasst machen. Der Milde des Dauerarbeitsplatzprivilegs ohne harsche Leistungskontrolle folgt nun der Stress permanenter Konkurrenz von außen:
"Unter dem verschärften Druck des globalisierten Wirtschaftsgeschehens wird sich die gute alte Angestelltenrepublik in eine offene Wettbewerbsgesellschaft verwandeln müssen, die den Tüchtigen belohnt, den Faulen und Unfähigen aber nur noch mit dem Nötigsten versorgt. Es wird nicht ohne Kampf abgehen, bis die Republik der Besitzstandswahrer und Umverteiler reformiert ist - doch der Prozess läuft und ist weder aufzuhalten noch umzudrehen."
So die These des Buches, die noch etwas zugespitzter lautet: Angestellte auf Höhe des gewohnten Versorgungsniveaus kann sich die nationale Volkswirtschaft Deutschlands nicht mehr leisten. Doch selbst ein versierter Wirtschaftsboulevardier wie Günter Ogger tut sich schwer, mit einem einzigen, mäßig provokanten Gedanken 300 Seiten zu füllen. Zahlen hat er fleißig aufgelesen, Faktenwissen und Anekdoten zusammengetragen - wie etwa die skurrile Tatsache, dass deutsche Büros doppelt so groß sind wie die aller anderen Europäer -, doch das verdeckt nur mühsam das Problem seiner Kampfschrift "Die Abgestellten". Schon im Titel kommt sie ungenau daher, eigentlich müsste von "Abgeschafften" die Rede sein, "abgestellt", sprich auf einen unattraktiven Arbeitsplatz verschoben, wird hierzulande ja immer noch bei weitgehend vollen Bezügen.
Dass effekthascherische Momente dem Autor wichtiger sind denn eine konsistente Gedankenführung, kündigt sich somit schon auf dem Schutzumschlag an. Auf ganzer Länge hat der Text dann ein immanentes Haltungsproblem. Für seine Pamphlete braucht Günter Ogger klar umrissene Feindbilder - doch er benötigt auch eine große Anhängerschaft, die diese Feindbilder teilt. Mehrheit gegen Minderheit, lautete sein Erfolgsrezept bislang. Diesmal kann es nicht aufgehen. Tatsächlich gehört der freiberufliche Publizist Günter Ogger selbst der Minderheit an, die sich gegen die angestellte Mehrheit zur Wehr setzt, zugleich aber von dieser ihr Auskommen bezieht. Fallen die Angestellten nämlich als Käufer aus, kann das Buch am Markt nicht reüssieren, jedenfalls kaum in Bestsellerhöhen. Die daraus resultierende Spaltung durchzieht den Text auf groteske Weise.
Kaum schießt Ogger sich aufs Feindbild des leistungsfeindlichen, überversorgten "Luxusangestellten" ein, muss er auch schon auf die Tränendrüse drücken, sich im konkreten Beispiel ins Leid eines mittleren Managers einfühlen, der von 250.000 Euro Jahresgehalt auf einen Job mit 70.000 Euro absteigt. Relational eine Verarmung, gewiss. In absoluten Werten gemessen aber bestenfalls eine Luxusschrumpfung, die alles verdient, bloß kein Mitleid. Besonders krass wird die Kluft zwischen sarkastisch-kämpferischem Tonfall auf der einen und mangelnder Feindbildkonsistenz auf der anderen Seite am Schluss des Buches. Nachdem das Zünglein an der Oggerschen Waage per saldo gegen die Angestelltenkultur ausschlagen hat, drückt der Autor zur Wahrung seiner Marktschancen schnell auf die andere Waagschale und imaginiert die Schreckensversion einer durchflexibilisierten Welt ohne Angestellte. Und siehe: Nichts geht mehr! Nein, schlimmer noch, ausgerechnet Günter Ogger bewirbt sich um den großen Naomi-Klein-Preis der Globalisierungsschwarzmalerei:
"Ärzte und Krankenhäuser verlangten Vorauszahlungen, Konsumentenkredite würden teurer. Ordnungskräfte und Reinigungsdienste bekämen reichlich zu tun, die Sicherheitsbranche verzeichnete satte Zuwachsraten. Die Anträge auf Ausstellung von Waffenscheinen häuften sich, die Villenvororte verwandelten sich in Hochsicherheitszonen, die Autohersteller verlegten sich auf Panzerfahrzeuge, und um die Ghettos der Armen zöge man Stacheldraht. Auf die ausufernde Kriminalität würde der Staat mit der totalen Überwachung seiner Bürger reagieren; zur Durchsetzung ihrer Zero-Tolerance-Policy würde die Polizei nach den neuesten Strahlenwaffen, Arrestkäfigen und elektronischen Fußfesseln verlangen."
Spätestens hier schlägt das anfängliche Amüsement der Lektüre in Verärgerung um: In seinen Auswirkungen ist der Untergang des Angestelltenmilieus viel zu kompliziert, als dass ihn ein grobschlächtiger Schwarzweißmaler wie Günter Ogger auch nur halbwegs zu prognostizieren vermochte. Leider haben hier ein wichtiges Thema und ein Autor zusammengefunden, die partout nicht zusammen passen wollen. Vielleicht etabliert der stets neue Trends witternde und überaus geschäftstüchtige Günter Ogger besser eine Börse, an der er seine Themen an Leute verkauft, die damit differenzierter umgehen. Geld verdienen könnte er so ebenfalls - nur mit viel weniger schweißtreibendem Aufwand.
Günter Ogger: Die Abgestellten - Nachruf auf einen festen Arbeitsplatz
C. Bertelsmann Verlag, München 2007
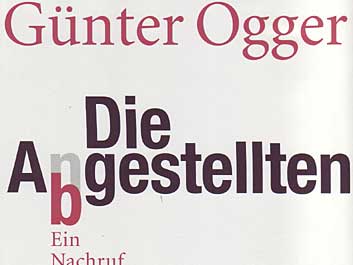
Günter Ogger: Die Abgestellten© C. Bertelsmann Verlag
