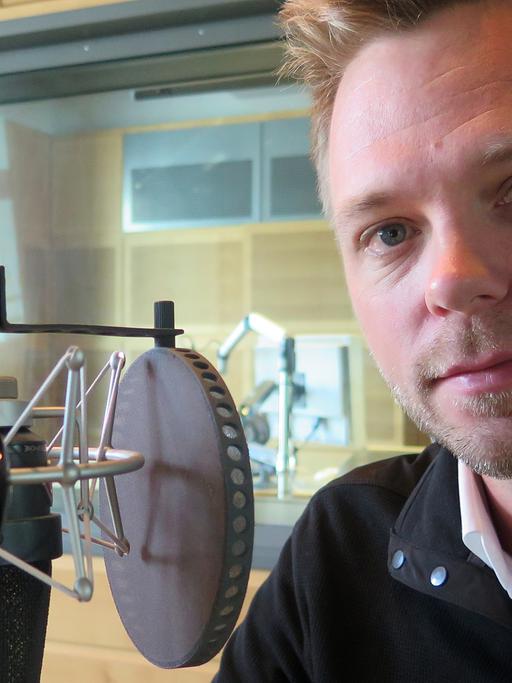Vom Verlust der Seriosität in der amerikanischen Politik

Aus dem "Spalter" Donald Trump scheint plötzlich ein Staatsmann geworden zu sein, so beurteilt Thomas Rommel von der American Academy dessen öffentliches Auftreten. Er analysiert, warum Trump mit seinen verbalen Tabu-Brüchen dennoch für viele Menschen wählbar war.
Die USA hat einen neuen Präsidenten, aber das Land bleibt gespalten: Zwischen Clinton und Trump Anhängern, zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen reich und arm. Der US-Schriftsteller Jonathan Franzen hat während des Wahlkampfes schon die Befürchtung geäußert, es könnte im schlimmsten Fall zu einem Bürgerkrieg kommen. Sicher ist: Der extrem agressive Wahlkampf wird noch lange negative Folgen in der amerikanischen Gesellschaft zeigen.
Thomas Rommel, Programmdirektor der American Academy in Berlin, analysierte im Deutschlandradio Kultur das Auftreten Donald Trumps nach Bekanntwerden seines Wahlsiegs. Dessen öffentliche Präsentation als Staatsmann habe ihn erstaunt, denn Trump habe sich vorher als Spalter und Polarisierer positioniert:
"Wir haben ihn wahr genommen – sowohl aus europäischer wie aus amerikanischer Perspektive - als den Mann, der mit vergleichsweise wenig Fakten hingeht und bewusst einen Keil in die Gesellschaft treibt. Der es letztlich möglich gemacht, hat, dass sich Leute zu einer Wahl positioniert haben, die sich vorher gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Das Erstaunliche ist: Trump repräsentiert einen Typus Politiker, den man so in dieser Form gar nicht gesehen habe."
"Wir haben ihn wahr genommen – sowohl aus europäischer wie aus amerikanischer Perspektive - als den Mann, der mit vergleichsweise wenig Fakten hingeht und bewusst einen Keil in die Gesellschaft treibt. Der es letztlich möglich gemacht, hat, dass sich Leute zu einer Wahl positioniert haben, die sich vorher gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Das Erstaunliche ist: Trump repräsentiert einen Typus Politiker, den man so in dieser Form gar nicht gesehen habe."
"Medienversierter Meister" mit Lust an der Provokation
Hillary Clinton habe für das Establishment gestanden, sagt Rommel. Deshalb hätten sich viele Künstler bei ihrer Wahlentscheidung auch in einem Dilemma befunden:
"Wenn man sich das ansieht, geht diese Spaltung der Gesellschaft nicht nur durch die politischen Parteien, also durch Republikaner und Demokraten. Sondern es ist eine Spaltung, die über Generationen und Geschlechter, über ethnische Gruppen, über Bildungsstandards hinweg geht. Es ist eine Spaltung auf vielfältigen Ebenen. Und das macht die Situation so außerordentlich schwierig."
"Wenn man sich das ansieht, geht diese Spaltung der Gesellschaft nicht nur durch die politischen Parteien, also durch Republikaner und Demokraten. Sondern es ist eine Spaltung, die über Generationen und Geschlechter, über ethnische Gruppen, über Bildungsstandards hinweg geht. Es ist eine Spaltung auf vielfältigen Ebenen. Und das macht die Situation so außerordentlich schwierig."
Donald Trump habe ganz bewusst polarisiert, meint Rommel – mit einer gewissen Lust an der Provokation. Trump habe sich als ein "medienversierter Meister" dieses Verfahrens präsentiert, kritisierte er. In der Politik habe es – bis zum Fall Trump - immer ein gewisses Element der Seriosität gegeben:
"Und bei Trump hat man den Eindruck: Wenn er sich hin gestellt hat und Minoritäten, Frauen und Ausländer letztendlich nicht nur marginalisiert, sondern letztlich bewusst angegriffen hat – dann hat er einen Tabu-Bruch vollzogen, der eigentlich in der Politik sehr ungewöhnlich ist."
"Und bei Trump hat man den Eindruck: Wenn er sich hin gestellt hat und Minoritäten, Frauen und Ausländer letztendlich nicht nur marginalisiert, sondern letztlich bewusst angegriffen hat – dann hat er einen Tabu-Bruch vollzogen, der eigentlich in der Politik sehr ungewöhnlich ist."
Trumps Tabu-Brüche hatte eine unglaubliche Signalwirkung
Dieser Tabu-Bruch habe in Amerika eine "ganz unglaubliche Signalwirkung" gehabt, meint Rommel. Viele Menschen hätten Trump darauf hin als mutigen und "aufrechten" Mann eingeschätzt:
"Diese Vorstellung, dass sich jemand traut, etwas zu sagen, was viele offenbar denken, aber nicht sagen wollen. Und der auch noch den Mut hat, sich als Präsident aufstellen zu lassen – das ist offensichtlich etwas, was funktioniert hat. Und das unterscheidet diesen Wahlkampf fundamental von allen anderen."
"Diese Vorstellung, dass sich jemand traut, etwas zu sagen, was viele offenbar denken, aber nicht sagen wollen. Und der auch noch den Mut hat, sich als Präsident aufstellen zu lassen – das ist offensichtlich etwas, was funktioniert hat. Und das unterscheidet diesen Wahlkampf fundamental von allen anderen."
Die Rolle der "meinungsführenden Intelligenz" in Amerika
Die Diskussion um den Wahlausgang werde jetzt von den Kreisen der "meinungsführenden Intelligenz" geführt werden, lautet Rommels Einschätzung: :
"Jetzt werden die Feuilletons in Amerika und die Meinungsteile in den Zeitungen und den Nachrichten immer wieder Intellektuelle präsentieren, die sagen: 'Wie konnte das nur passieren? Wo kommt diese Spaltung her? Aber diejenigen, die ihn gewählt haben – immerhin eine große Anzahl von Amerikanern – die haben eigentlich gar kein Forum, gar keine Plattform. Denn meinungsbildend sind eigentlich mehrheitlich die Trump-Gegner. Die Universitäten sind voll von kritischen Trump-Stimmen. Die Künstler sind diejenigen, die sich am deutlichsten gegen Donald Trump positioniert haben und das immer noch tun. Die Bildende Kunst, die Literaten, die Musiker, alle."
Wie bewertet Rommel das Engagement vieler Intellektueller, Schriftsteller und Größen des Show-Business gegen Trump? Interessant sei, dass sie ihr Ziel nicht erreicht hätten, sagt Rommel und liefert Gründe dafür:
"Auf der einen Seite sieht man, dass die Kultur konsumiert wird in ganz Amerika. Aber offensichtlich gibt es da eine Trennung zwischen dem, was die Künstler als Künstlerpersonen sagen – und was möglicherweise verpufft – und dem, was die Leute, die letztendlich zu wählen haben, sich für ihr eigenes Leben vorstellen."
"Jetzt werden die Feuilletons in Amerika und die Meinungsteile in den Zeitungen und den Nachrichten immer wieder Intellektuelle präsentieren, die sagen: 'Wie konnte das nur passieren? Wo kommt diese Spaltung her? Aber diejenigen, die ihn gewählt haben – immerhin eine große Anzahl von Amerikanern – die haben eigentlich gar kein Forum, gar keine Plattform. Denn meinungsbildend sind eigentlich mehrheitlich die Trump-Gegner. Die Universitäten sind voll von kritischen Trump-Stimmen. Die Künstler sind diejenigen, die sich am deutlichsten gegen Donald Trump positioniert haben und das immer noch tun. Die Bildende Kunst, die Literaten, die Musiker, alle."
Wie bewertet Rommel das Engagement vieler Intellektueller, Schriftsteller und Größen des Show-Business gegen Trump? Interessant sei, dass sie ihr Ziel nicht erreicht hätten, sagt Rommel und liefert Gründe dafür:
"Auf der einen Seite sieht man, dass die Kultur konsumiert wird in ganz Amerika. Aber offensichtlich gibt es da eine Trennung zwischen dem, was die Künstler als Künstlerpersonen sagen – und was möglicherweise verpufft – und dem, was die Leute, die letztendlich zu wählen haben, sich für ihr eigenes Leben vorstellen."