Geld regiert die Welt
Die Wirtschaft war nie so mächtig wie heute: Unter dem globalen Druck expandieren Unternehmen, bemächtigen sich zusehends der Politik und gefährden die Demokratie, so die These Robert Reichs. Der ehemalige amerikanische Arbeitsminister prognostiziert einen ungehemmten "Superkapitalismus".
Die Marktwirtschaft frisst ihre Kinder. Kürzlich der Fall Zumwinkel, davor Korruption bei Siemens, leichte Mädchen zur Betriebsratsbeglückung bei VW, Bankenkrise und immer wieder satte Goldene Handschläge zur Verabschiedung von Managern, die offenkundig und für jedermann sichtbar versagt haben. Ist das das wahre Gesicht der sozialen Marktwirtschaft? Für viele Menschen offenbar ja.
Haben wir uns durch die Globalisierung von einem sozial orientierten Kapitalismus - in Deutschland auch soziale Marktwirtschaft genannt - verabschiedet? In seinem neuen Buch stellt der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Robert Reich genau diese These auf. Superkapitalismus statt Kapitalismus. Nein, Reich ist kein Linker, er ist ein kluger Kopf der Demokraten - er war einst Arbeitsminister unter dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton. Und was er spannend beschreibt, ist ein Buch geworden, das niemandem fehlen sollte, der in den aktuellen Debatten zur Globalisierung, Wirtschaftspolitik und ethischen Fundierung der Marktwirtschaft mitreden will. Ausgangspunkt der Analyse von Reich ist folgende Feststellung:
"Die Marktwirtschaft hat gesiegt, doch die Demokratie ist geschwächt."
Warum ist das so? Weil sich die soziale Marktwirtschaft gehäutet hat. Sie hat sich von einem überschaubaren System mit wenigen Akteuren in einem begrenzten Raum, früher gerne "Volkswirtschaft" genannt, zu einem globalen Spiel mit einer unüberschaubaren Zahl von Akteuren gewandelt. Dabei ist ein Paradox entstanden:
"Der Superkapitalismus ist ein immer stärker werdendes Wirtschaftssystem, in dem Verbraucher und Anleger immer mehr Macht haben und Arbeitnehmer und Bürger immer weniger."
Die Folgen sind fatal:
"Der Superkapitalismus hat unsere Spielräume als Verbraucher und Anleger radikal vergrößert und ermöglich es uns, in aller Welt nach Schnäppchen zu suchen. Den Preis dafür bezahlen wir als Arbeitnehmer und Bürger. Unsere Arbeitsplätze und Löhne werden immer unsicherer, und wir sind immer weniger imstande, unsere Rolle als Bürger auszufüllen."
Mit einem fulminanten Ritt durch die Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschreibt Reich die Veränderungen. Dabei erfährt der Leser Interessantes zur Entstehung der Globalisierung: Dass etwa das Militär mit neuen Bedürfnissen in Technik und Logistik wesentlicher Treiber dieses Prozesses war. Der Container - heute Symbol für die globale Vernetzung - wurde zunächst von Militärs für Einsätze in Übersee erfunden, um einheitliche und berechenbare Laderäume zu haben.
Bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts herrschte für Reich sogar ein "beinahe goldenes Zeitalter". In jeder Branche gab es nur einige, wenige Anbieter. So bestimmten die "großen Drei" - Ford, Chrysler und General Motors - den Automobilmarkt in den USA. Der Wettbewerb blieb berechenbar. Der damalige Kapitalismus habe einige Bezüge zum System der Planwirtschaft gehabt, schreibt Reich. Der Unternehmer war vor Überraschungen gefeit und so gab es auch ein schiedlich-friedliches Miteinander mit den Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Nach und nach bekam jeder Kühlschrank, Fernseher und Auto. Auch die Gehälter wuchsen regelmäßig:
"Kapitalismus und Demokratie schienen ein Tandem zu bilden und miteinander zu verschmelzen. Der demokratische Kapitalismus der USA wurde zum Modell für die Welt und zum historischen Gegenentwurf zum Sowjetkommunismus."
Wann aber kam der Bruch? Der Erfolg des "alten" Kapitalismus gründete auf der Massenproduktion mit ihren niedrigen Kosten. Heute jedoch lassen sich niedrige Kosten auch von Anbietern erreichen, die nicht in Massen produzieren. Die Mischung aus globaler Neuverteilung von Arbeitsmöglichkeiten und der Nutzung des weltweiten Internets geben neuen Firmen die Möglichkeit, Marktführer ihrer Macht zu berauben.
An dieser Stelle vermisst man die Differenzierung. Und es wäre gut gewesen, wenn Reich auch auf Vorteile dieser Entwicklung hingewiesen hätte: Niedrige Preise erlauben den Menschen heute mehr für dasselbe Geld einkaufen zu können, womit die Inflation gedrückt und Wohlstand für alle befördert wird. Oder waren Produktionsoligopole - beispielsweise in der Autoindustrie - wirklich so gut? Heute reden mehr Menschen im Wirtschaftsprozess mit, auch die Nicht-Regierungsorganisationen. Ohne sie und den starken Konkurrenzkampf wären beispielsweise die Innovationen im Umweltbereich nicht denkbar.
Dem Buch fehlt an diesen Stellen eine deutsche Sicht der Dinge - das deutsche Vorwort ist zu wenig. Dies gilt nicht zuletzt für Reichs Forderungen zur Zähmung des Superkapitalismus. Bessere Arbeitslosenunterstützung und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall - um aus Arbeitnehmern selbstbewusste Bürger zu machen - haben wir in Deutschland bereits. Gesetze zur Kapitalmarktregulierung sind bei uns teilweise besser als in den USA. Die von Reich geforderten Transfersteuern, um schnelle Aktienverkäufe zu verhindern, gibt es bei uns schon längst. Auch hätte man sich einen tieferen Einblick in die ethischen Kapitalmärkte gewünscht.
Ja, es gibt sie, Investmentfonds, die vor allem in Unternehmen investieren, die bestimmte soziale und ökologische Standards einhalten. Inzwischen schlummern über 2000 Milliarden US-Dollar in solchen ethischen Fonds. Aber dies schmälert nicht den Verdienst des Buches, das die Defizite der Globalisierung mit einer neuen Sicht beschreibt und die richtigen Fragen stellt.
Warum bin ich als Bürger für Klimaschutz - kaufe mir aber dann doch den großen Geländewagen? Darüber sollten wir nachdenken und selbst eine Antwort finden.
Robert Reich: Superkapitalismus
Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt!
Übersetzt von Jürgen Neubauer
Campus Verlag, Frankfurt 2008
Haben wir uns durch die Globalisierung von einem sozial orientierten Kapitalismus - in Deutschland auch soziale Marktwirtschaft genannt - verabschiedet? In seinem neuen Buch stellt der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Robert Reich genau diese These auf. Superkapitalismus statt Kapitalismus. Nein, Reich ist kein Linker, er ist ein kluger Kopf der Demokraten - er war einst Arbeitsminister unter dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton. Und was er spannend beschreibt, ist ein Buch geworden, das niemandem fehlen sollte, der in den aktuellen Debatten zur Globalisierung, Wirtschaftspolitik und ethischen Fundierung der Marktwirtschaft mitreden will. Ausgangspunkt der Analyse von Reich ist folgende Feststellung:
"Die Marktwirtschaft hat gesiegt, doch die Demokratie ist geschwächt."
Warum ist das so? Weil sich die soziale Marktwirtschaft gehäutet hat. Sie hat sich von einem überschaubaren System mit wenigen Akteuren in einem begrenzten Raum, früher gerne "Volkswirtschaft" genannt, zu einem globalen Spiel mit einer unüberschaubaren Zahl von Akteuren gewandelt. Dabei ist ein Paradox entstanden:
"Der Superkapitalismus ist ein immer stärker werdendes Wirtschaftssystem, in dem Verbraucher und Anleger immer mehr Macht haben und Arbeitnehmer und Bürger immer weniger."
Die Folgen sind fatal:
"Der Superkapitalismus hat unsere Spielräume als Verbraucher und Anleger radikal vergrößert und ermöglich es uns, in aller Welt nach Schnäppchen zu suchen. Den Preis dafür bezahlen wir als Arbeitnehmer und Bürger. Unsere Arbeitsplätze und Löhne werden immer unsicherer, und wir sind immer weniger imstande, unsere Rolle als Bürger auszufüllen."
Mit einem fulminanten Ritt durch die Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschreibt Reich die Veränderungen. Dabei erfährt der Leser Interessantes zur Entstehung der Globalisierung: Dass etwa das Militär mit neuen Bedürfnissen in Technik und Logistik wesentlicher Treiber dieses Prozesses war. Der Container - heute Symbol für die globale Vernetzung - wurde zunächst von Militärs für Einsätze in Übersee erfunden, um einheitliche und berechenbare Laderäume zu haben.
Bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts herrschte für Reich sogar ein "beinahe goldenes Zeitalter". In jeder Branche gab es nur einige, wenige Anbieter. So bestimmten die "großen Drei" - Ford, Chrysler und General Motors - den Automobilmarkt in den USA. Der Wettbewerb blieb berechenbar. Der damalige Kapitalismus habe einige Bezüge zum System der Planwirtschaft gehabt, schreibt Reich. Der Unternehmer war vor Überraschungen gefeit und so gab es auch ein schiedlich-friedliches Miteinander mit den Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Nach und nach bekam jeder Kühlschrank, Fernseher und Auto. Auch die Gehälter wuchsen regelmäßig:
"Kapitalismus und Demokratie schienen ein Tandem zu bilden und miteinander zu verschmelzen. Der demokratische Kapitalismus der USA wurde zum Modell für die Welt und zum historischen Gegenentwurf zum Sowjetkommunismus."
Wann aber kam der Bruch? Der Erfolg des "alten" Kapitalismus gründete auf der Massenproduktion mit ihren niedrigen Kosten. Heute jedoch lassen sich niedrige Kosten auch von Anbietern erreichen, die nicht in Massen produzieren. Die Mischung aus globaler Neuverteilung von Arbeitsmöglichkeiten und der Nutzung des weltweiten Internets geben neuen Firmen die Möglichkeit, Marktführer ihrer Macht zu berauben.
An dieser Stelle vermisst man die Differenzierung. Und es wäre gut gewesen, wenn Reich auch auf Vorteile dieser Entwicklung hingewiesen hätte: Niedrige Preise erlauben den Menschen heute mehr für dasselbe Geld einkaufen zu können, womit die Inflation gedrückt und Wohlstand für alle befördert wird. Oder waren Produktionsoligopole - beispielsweise in der Autoindustrie - wirklich so gut? Heute reden mehr Menschen im Wirtschaftsprozess mit, auch die Nicht-Regierungsorganisationen. Ohne sie und den starken Konkurrenzkampf wären beispielsweise die Innovationen im Umweltbereich nicht denkbar.
Dem Buch fehlt an diesen Stellen eine deutsche Sicht der Dinge - das deutsche Vorwort ist zu wenig. Dies gilt nicht zuletzt für Reichs Forderungen zur Zähmung des Superkapitalismus. Bessere Arbeitslosenunterstützung und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall - um aus Arbeitnehmern selbstbewusste Bürger zu machen - haben wir in Deutschland bereits. Gesetze zur Kapitalmarktregulierung sind bei uns teilweise besser als in den USA. Die von Reich geforderten Transfersteuern, um schnelle Aktienverkäufe zu verhindern, gibt es bei uns schon längst. Auch hätte man sich einen tieferen Einblick in die ethischen Kapitalmärkte gewünscht.
Ja, es gibt sie, Investmentfonds, die vor allem in Unternehmen investieren, die bestimmte soziale und ökologische Standards einhalten. Inzwischen schlummern über 2000 Milliarden US-Dollar in solchen ethischen Fonds. Aber dies schmälert nicht den Verdienst des Buches, das die Defizite der Globalisierung mit einer neuen Sicht beschreibt und die richtigen Fragen stellt.
Warum bin ich als Bürger für Klimaschutz - kaufe mir aber dann doch den großen Geländewagen? Darüber sollten wir nachdenken und selbst eine Antwort finden.
Robert Reich: Superkapitalismus
Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt!
Übersetzt von Jürgen Neubauer
Campus Verlag, Frankfurt 2008
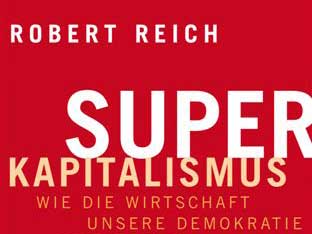
Robert Reich: Superkapitalismus© Campus Verlag
