Gegen den Strich bürsten
"Ohne Wachstum ist alles nichts": Dieser Satz stammt aus einem CDU-Grundsatzpapier, und er kann als allgemeines Credo unserer Gesellschaft gelten. Der Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel hält nicht viel davon, wie sein neues Buch "Exit" verdeutlicht.
Einer gegen alle, möchte meinen, wer Meinhard Miegels neues Buch "Exit" liest. Dass nur wirtschaftliches Wachstum uns in die Lage versetzen kann, unseren riesigen Schuldenberg abzubauen, dass nur Wachstum helfen wird, Arbeitsplätze zu schaffen oder die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, ist ökonomischer Konsens, und alle predigen ihn quer durch den Bundestag - die Grünen ebenso wie die Linken, die Sozialdemokraten genau so wie die Schwarzgelben, die gerade ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz verabschiedet haben. "Ohne Wachstum ist alles nichts" - so nachzulesen in einem jüngeren Grundsatzpapier der CDU.
Nun kommt Meinhard Miegel und bürstet gegen den Strich. Wachstum sei in Gesellschaften wie der Deutschen zur Ideologie des Mainstreams erstarrt, nüchtern und emotionsfrei lasse sich in der Berliner Republik über Wachstum gar nicht mehr reden, denn es werde stereotyp und fälschlich gleichgesetzt mit Wohlstandsmehrung, Fortschritt und Wohlbefinden.
"Wer sich zu ihm bekennt und mehr davon fordert, gehört automatisch zu den Guten, Fortschrittlichen, Zukunftsorientierten und kann sich breiter Zustimmung gewiss sein. Wer sich hingegen erkühnt, Schattenseiten aufzuzeigen, muss sich rechtfertigen, ja verteidigen."
Dass Miegel nicht zu den Guten zählt, war nach dem, was er bislang den Deutschen ins Stammbuch geschrieben hat, so gut wie sicher. In seinem Buch "Die deformierte Gesellschaft" stellte er 2002 die Strukturen unseres Sozialstaates in Frage, in dem 2005 veröffentlichten "Epochenwende" erregte er Aufsehen als ein Prophet des Niedergangs: In der globalisierten Wirtschaft sah er einen Ausgleichs- und Angleichungsprozess am Werk, der für Chinesen und Inder ganz natürlich Aufstieg, für den Westen aber - und darunter versteht er die frühindustrialisierten Länder Europas und die USA - ganz selbstverständlich Abstieg bedeute – Abstieg also auch für uns Deutsche.
Wer Miegels neues Buch liest, fragt sich, ob er, ein Freund und enger Mitarbeiter Kurt Biedenkopfs und christdemokratischer Querdenker von Format, inzwischen zum Grünen mutiert ist. Denn in "Exit" kommt er immer wieder auf Überlegungen und Analysen zurück, die 1972 der Club of Rome mit der Studie über die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows zur Debatte gestellt hatte. Unendliches Wachstum in einer endlichen Welt sei schon prinzipiell ein Ding der Unmöglichkeit, meint Miegel.
Den Begriff "Grün" würde er, auf ihn angewandt, lieber durch "Wertkonservativ" ersetzen. An vielen Beispielen macht er deutlich, dass die Gefahren, die der Club of Rome 1972 für die Menschheit in etwa 40 Jahren heraufziehen sah, inzwischen eingetreten sind. Wer die nationale Selbstbezogenheit, ja die nationale Nabelschau unserer deutschen Talk-Show- und Diskussionskultur im Auge hat, wird mit Freude vermerken, dass hier einer weit über unseren nationalen Tellerrand hinaus schaut. Miegel denkt global.
Und doch weist er in aller Deutlichkeit auf die Konsequenzen hin, welche die globale Entwicklung für unsere nationale Wirtschafts-, vor allem aber die Sozialpolitik haben muss. Die Erdbevölkerung werde in den nächsten Jahrzehnten auf neun oder zehn Milliarden Menschen anwachsen - und er fragt, wie diese Milliarden leben werden:
"Ja, die Erde kann zehn Milliarden Menschen ernähren, aber nach dem derzeitigen Wissens- und Könnensstand nur solche, die jeweils ungefähr so viel - das heißt: So wenig - konsumieren wie heute im Durchschnitt ein Inder. Von Menschen mit den Ess- und Trinkgewohnheiten eines Europäers könnte sie höchstens die Hälfte oder weniger tragen, von Menschen mit der Esslust von Amerikanern allenfalls 2,5 Milliarden."
Die noch vor Jahrzehnten in Europa und Amerika gängige Vorstellung, diese Milliarden könnten sich mit Fleiß, Disziplin und Innovationskraft nach und nach auf unseren Lebensstandard hocharbeiten, nennt er eine glatte Illusion. Er fordert statt dessen:
"Jetzt muss ein neues Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der Zahl der Menschen und ihren materiellen Ansprüchen einerseits und den Kapazitäten der Erde und den menschlichen Fähigkeiten andererseits. Für die Völker der früh industrialisierten Länder bedeutet dies, dass ihr materieller Lebensstandard vorerst nicht mehr steigen, sondern eher sinken wird."
Miegels Grundthese lautet, dass die westlichen Gesellschaften ihr bisheriges Glücks- und Heilsversprechen der immerwährenden Mehrung des sozialen Wohlstands nicht länger einlösen können. Folgt man seiner Argumentation, dann ist dieser Prozess der Stagnation, ja des Niedergangs längst im Gange, stillschweigend, schleichend wenn man so will, schon durch die Marktkräfte bedingt.
Die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Konsequenzen, die sich nach Miegel für die deutsche Gesellschaft und ihren Sozialstaat ergeben, dürften deshalb zur Nagelprobe für die Stabilität der deutschen Demokratie werden. Für die Aufrechterhaltung des jetzigen Sozialstaates, vor allem für dessen jetzige Leistungen an die Bürger, meint Miegel, lassen sich auf die Dauer die Mittel nicht beschaffen. Und so tun, als müsse man den Sozialstaat nur wollen, um ihn zu bewahren – eine Überzeugung, die im politischen Spektrum vor allem links verbreitet ist - nennt er eine "zutiefst rückwärtsgewandte oder im eigentlichen Wortsinn reaktionäre Haltung.
"Deshalb muss die Politik die Bürger darauf vorbereiten, dass sie künftig nicht mehr die gewohnten Sozialleistungen erhalten werden, erhalten können. Dies muss sie ihnen, auch wenn es schwierig ist und schmerzt, unmissverständlich vermitteln.
Darum herumzureden nützt auf die Dauer niemandem und schürt nur den Verdruss an Politik. Warum nicht freimütig bekennen, dass aufgrund der Rentenreformmaßnahmen der jüngeren Vergangenheit oder der Rente mit 67 die Alterseinkommen sinken werden? Das ist politisch gewollt und in der Sache richtig. Also sollte es auch gesagt werden. Und ebenso offen sollten die Leistungskürzungen in den übrigen Sozialsystemen zur Sprache kommen, von der Kranken- über die Pflege- bis zur Arbeitslosenversicherung."
Miegel fordert nicht nur mehr Ehrlichkeit der Politik und mehr gesellschaftlich-bürgerschaftliches Engagement des Einzelnen. Mit der Abwendung von einer ausschließlich auf materielles Wachstum fokussierten Haltung propagiert er zugleich die Rückbesinnung auf immaterielle Werte der Kultur, auf Musik und Theater, Kunst und Literatur, ja er sieht dadurch den Verlust an materiellem durch immaterielles Wachstum ausgeglichen. Wie viel gerade daran Utopie ist und bleiben wird, sei dahingestellt.
Ich wünschte mir jedoch, die politisch Verantwortlichen würden offen seine Thesen diskutieren. Und natürlich sähe ich es gern, wenn ein Nobelpreisträger wie Paul Krugmann, der so ganz auf wirtschaftliche Dynamik und Wachstum setzt, sich mit Miegels Abkehr von den Grundüberzeugungen aller herkömmlichen Ökonomie gründlich auseinandersetzte. Im nationalen Alleingang dürften wir bei der Einbindung nach Europa und der globalen Verflechtung der Weltwirtschaft die geforderte Wachstumskehrtwende wohl kaum bewältigen.
Meinhard Miegel:
Exit. Wohlstand ohne Wachstum
Propyläen Verlag, Berlin/2010.
Nun kommt Meinhard Miegel und bürstet gegen den Strich. Wachstum sei in Gesellschaften wie der Deutschen zur Ideologie des Mainstreams erstarrt, nüchtern und emotionsfrei lasse sich in der Berliner Republik über Wachstum gar nicht mehr reden, denn es werde stereotyp und fälschlich gleichgesetzt mit Wohlstandsmehrung, Fortschritt und Wohlbefinden.
"Wer sich zu ihm bekennt und mehr davon fordert, gehört automatisch zu den Guten, Fortschrittlichen, Zukunftsorientierten und kann sich breiter Zustimmung gewiss sein. Wer sich hingegen erkühnt, Schattenseiten aufzuzeigen, muss sich rechtfertigen, ja verteidigen."
Dass Miegel nicht zu den Guten zählt, war nach dem, was er bislang den Deutschen ins Stammbuch geschrieben hat, so gut wie sicher. In seinem Buch "Die deformierte Gesellschaft" stellte er 2002 die Strukturen unseres Sozialstaates in Frage, in dem 2005 veröffentlichten "Epochenwende" erregte er Aufsehen als ein Prophet des Niedergangs: In der globalisierten Wirtschaft sah er einen Ausgleichs- und Angleichungsprozess am Werk, der für Chinesen und Inder ganz natürlich Aufstieg, für den Westen aber - und darunter versteht er die frühindustrialisierten Länder Europas und die USA - ganz selbstverständlich Abstieg bedeute – Abstieg also auch für uns Deutsche.
Wer Miegels neues Buch liest, fragt sich, ob er, ein Freund und enger Mitarbeiter Kurt Biedenkopfs und christdemokratischer Querdenker von Format, inzwischen zum Grünen mutiert ist. Denn in "Exit" kommt er immer wieder auf Überlegungen und Analysen zurück, die 1972 der Club of Rome mit der Studie über die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows zur Debatte gestellt hatte. Unendliches Wachstum in einer endlichen Welt sei schon prinzipiell ein Ding der Unmöglichkeit, meint Miegel.
Den Begriff "Grün" würde er, auf ihn angewandt, lieber durch "Wertkonservativ" ersetzen. An vielen Beispielen macht er deutlich, dass die Gefahren, die der Club of Rome 1972 für die Menschheit in etwa 40 Jahren heraufziehen sah, inzwischen eingetreten sind. Wer die nationale Selbstbezogenheit, ja die nationale Nabelschau unserer deutschen Talk-Show- und Diskussionskultur im Auge hat, wird mit Freude vermerken, dass hier einer weit über unseren nationalen Tellerrand hinaus schaut. Miegel denkt global.
Und doch weist er in aller Deutlichkeit auf die Konsequenzen hin, welche die globale Entwicklung für unsere nationale Wirtschafts-, vor allem aber die Sozialpolitik haben muss. Die Erdbevölkerung werde in den nächsten Jahrzehnten auf neun oder zehn Milliarden Menschen anwachsen - und er fragt, wie diese Milliarden leben werden:
"Ja, die Erde kann zehn Milliarden Menschen ernähren, aber nach dem derzeitigen Wissens- und Könnensstand nur solche, die jeweils ungefähr so viel - das heißt: So wenig - konsumieren wie heute im Durchschnitt ein Inder. Von Menschen mit den Ess- und Trinkgewohnheiten eines Europäers könnte sie höchstens die Hälfte oder weniger tragen, von Menschen mit der Esslust von Amerikanern allenfalls 2,5 Milliarden."
Die noch vor Jahrzehnten in Europa und Amerika gängige Vorstellung, diese Milliarden könnten sich mit Fleiß, Disziplin und Innovationskraft nach und nach auf unseren Lebensstandard hocharbeiten, nennt er eine glatte Illusion. Er fordert statt dessen:
"Jetzt muss ein neues Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der Zahl der Menschen und ihren materiellen Ansprüchen einerseits und den Kapazitäten der Erde und den menschlichen Fähigkeiten andererseits. Für die Völker der früh industrialisierten Länder bedeutet dies, dass ihr materieller Lebensstandard vorerst nicht mehr steigen, sondern eher sinken wird."
Miegels Grundthese lautet, dass die westlichen Gesellschaften ihr bisheriges Glücks- und Heilsversprechen der immerwährenden Mehrung des sozialen Wohlstands nicht länger einlösen können. Folgt man seiner Argumentation, dann ist dieser Prozess der Stagnation, ja des Niedergangs längst im Gange, stillschweigend, schleichend wenn man so will, schon durch die Marktkräfte bedingt.
Die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Konsequenzen, die sich nach Miegel für die deutsche Gesellschaft und ihren Sozialstaat ergeben, dürften deshalb zur Nagelprobe für die Stabilität der deutschen Demokratie werden. Für die Aufrechterhaltung des jetzigen Sozialstaates, vor allem für dessen jetzige Leistungen an die Bürger, meint Miegel, lassen sich auf die Dauer die Mittel nicht beschaffen. Und so tun, als müsse man den Sozialstaat nur wollen, um ihn zu bewahren – eine Überzeugung, die im politischen Spektrum vor allem links verbreitet ist - nennt er eine "zutiefst rückwärtsgewandte oder im eigentlichen Wortsinn reaktionäre Haltung.
"Deshalb muss die Politik die Bürger darauf vorbereiten, dass sie künftig nicht mehr die gewohnten Sozialleistungen erhalten werden, erhalten können. Dies muss sie ihnen, auch wenn es schwierig ist und schmerzt, unmissverständlich vermitteln.
Darum herumzureden nützt auf die Dauer niemandem und schürt nur den Verdruss an Politik. Warum nicht freimütig bekennen, dass aufgrund der Rentenreformmaßnahmen der jüngeren Vergangenheit oder der Rente mit 67 die Alterseinkommen sinken werden? Das ist politisch gewollt und in der Sache richtig. Also sollte es auch gesagt werden. Und ebenso offen sollten die Leistungskürzungen in den übrigen Sozialsystemen zur Sprache kommen, von der Kranken- über die Pflege- bis zur Arbeitslosenversicherung."
Miegel fordert nicht nur mehr Ehrlichkeit der Politik und mehr gesellschaftlich-bürgerschaftliches Engagement des Einzelnen. Mit der Abwendung von einer ausschließlich auf materielles Wachstum fokussierten Haltung propagiert er zugleich die Rückbesinnung auf immaterielle Werte der Kultur, auf Musik und Theater, Kunst und Literatur, ja er sieht dadurch den Verlust an materiellem durch immaterielles Wachstum ausgeglichen. Wie viel gerade daran Utopie ist und bleiben wird, sei dahingestellt.
Ich wünschte mir jedoch, die politisch Verantwortlichen würden offen seine Thesen diskutieren. Und natürlich sähe ich es gern, wenn ein Nobelpreisträger wie Paul Krugmann, der so ganz auf wirtschaftliche Dynamik und Wachstum setzt, sich mit Miegels Abkehr von den Grundüberzeugungen aller herkömmlichen Ökonomie gründlich auseinandersetzte. Im nationalen Alleingang dürften wir bei der Einbindung nach Europa und der globalen Verflechtung der Weltwirtschaft die geforderte Wachstumskehrtwende wohl kaum bewältigen.
Meinhard Miegel:
Exit. Wohlstand ohne Wachstum
Propyläen Verlag, Berlin/2010.
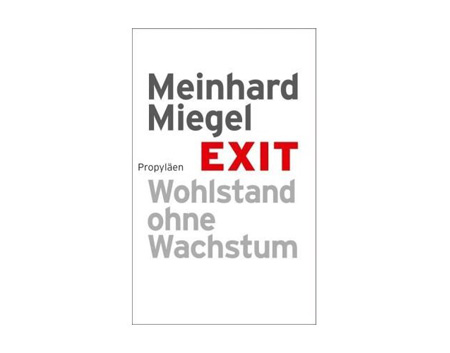
Cover: "Meinhard Miegel: Exit"© Probyläen Verlag
