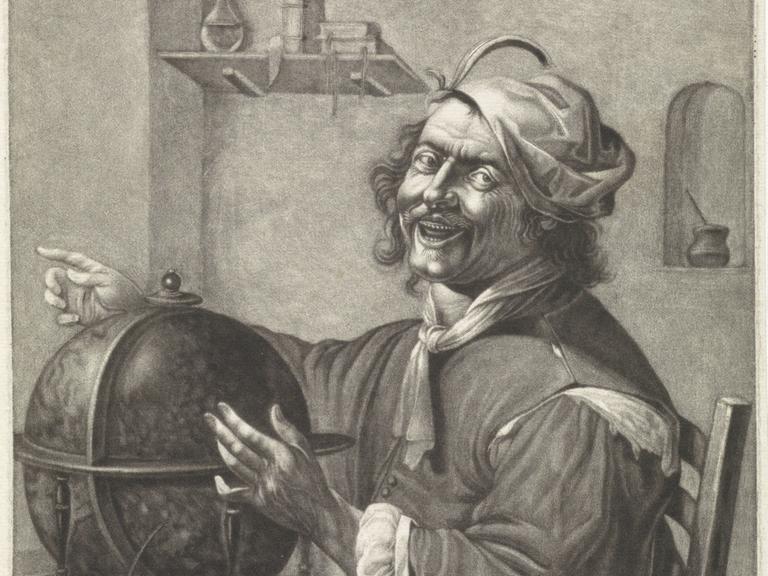Experimentelle Philosophie

Im Central Park in New York begann mit der Siegeszug der experimentellen Philosophie. © IMAGO / NurPhoto / Beata Zawrzel
Neue Antworten für große Fragen?
07:14 Minuten

Vor 20 Jahren befragte der Doktorand Joshua Knobe Passanten in New York. Nach seinen Erkenntnissen wurde schließlich der Knobe-Effekt benannt. Seitdem hat sich die Experimentelle Philosophie zum festen Bestandteil der Philosophie entwickelt.
Stellen Sie sich vor: Sie spazieren nichts ahnend durch einen Park, ganz in Gedanken versunken. Da spricht Sie ein junger Mann an.
Ob Sie an seiner Studie teilnehmen wollen, fragt Sie der junge Doktorand. Sein Name ist Joshua Knobe. 2003 hat er im New Yorker Central Park Spaziergängern folgendes Szenario vorgestellt.
„Stellen Sie sich vor, der Vizepräsident eines Unternehmens sagt zum Vorstandschef: ´Wir haben da einen neuen Plan, mit dem wir eine Menge Geld verdienen, aber auch die Umwelt schädigen.‘ Und der Vorstandsvorsitzende sagt. Das ist mir völlig egal. Mir geht es darum, so viel Geld zu verdienen, wie wir nur können.“
Die Firma setzten den Plan um, die Umwelt nimmt Schaden. Dann fragt Sie der Doktorand: Hat der Vorstandsvorsitzende der Umwelt absichtlich geschadet? Die meisten Befragten sagen darauf: Ja, das hat er. Bei der Umfrage im Park gibt es ein zweites Szenario: Der einzige Unterschied: Der Plan, viel Geld zu verdienen, schadet nicht der Umwelt, sondern hilft ihr. Und nun wieder die Frage: Hat der Vorstandsvorsitzende absichtlich der Umwelt geholfen?
„Und hier sagte die überwältigende Mehrheit der Leute: Nein er hat der Umwelt nicht mit Absicht geholfen. Es sieht so aus, dass unsere moralische Haltung, ob etwas gut oder schlecht ist, unser Urteil beeinflusst über eine scheinbar komplett unmoralische Frage: Nämlich: Hat er es absichtlich getan?“
Doktorand Joshua Knobe wird Gesprächsthema
Dieser Effekt wird als Knobe-Effekt bekannt. Er macht seinen Erfinder, den jungen Doktoranden Joshua Knobe zum Gesprächsthema. Auch weil seine Befragung von Passanten im Central Park 2003 eines der ersten empirischen Experimente der Philosophie war.
Knobe brach dabei mit einer Jahrtausende alten Tradition: Er wollte neue Erkenntnisse nicht nur durch gründliches Überlegen über Beobachtungen im Lehnstuhl gewinnen. Zunächst fand das wenig Anklang in Philosoph:innen-Kreisen. Einige Kolleg:innen führten aber dennoch ähnliche Experimente zu der Zeit durch.
„Und wir hatten alle ein Gefühl, das vielleicht vergleichbar war mit der Indie-Rock-Bewegung in dieser Zeit: Wir werden es damit niemals in den Mainstream schaffen. Niemand hat sich wirklich dafür interessiert, doch wir hatten jede Menge Spaß. Und von da an machten wir viele Untersuchungen gemeinsam.“
Aussagen von Laien für die Forschung?
Aus der Indie-Bewegung wird eine eigene Strömung: die experimentelle Philosophie. Die ist 20 Jahre später etabliert. Joshua Knobe ist Professor an der Yale-Universität – einer der wichtigsten Hochschulen der USA. Auch in Deutschland und anderen Ländern findet sie Anhänger:innen:
„Was alle in der experimentellen Philosophie verbindet, ist nicht, dass sie alle an gemeinsame richtige Antworten glauben. Was sie verbindet, ist eine Methode: die Methode, Experimente zu machen/anzustellen/aufzusetzen.“
Die sind häufig sozialwissenschaftliche oder psychologische Befragungen. Die Sicht vieler Laien versteht die experimentelle Philosophie als Gewinn. Für andere ist genau das die größte Kritik. Denn Menschen ohne philosophisches Studium könnten philosophische Fragen viel schlechter beantworten als ausgebildete Philosoph:innen. Knobe entgegnet, auch das hätte die experimentelle Philosophie untersucht:
„Natürlich können Philosophen viel besser große Theorien entwickeln, die uns helfen Ideen aus verschiedenen Themen zusammenzusetzen. Aber wenn man fragt, was ihre Intuition in einem ganz bestimmten Fall ist, dann sind die Urteile auffallend ähnlich – von gewöhnlichen Menschen und von Leuten, die einen Doktortitel in Philosophie haben.“
Philosophie und Neurowissenschaften
So zumindest die Sicht eines experimentellen Philosophen. Die Disziplin behandelt heute verschiedenste Themen: auch aus dem Bereich der Neurowissenschaften. Die Fragen zwischen Gehirnstrukturen und Bewusstseinsprozessen ziehen auch andere Philosoph:innen in ihren Bann, wie Adina Roski. Neben ihrem Doktor in Philosophie hat sie einen in Neurowissenschaften. Und das hält sie für ihre Forschungsinteressen für entscheidend.
„Aus meiner Erfahrung gibt es viele in der Philosophie, die Neurowissenschaften nicht verstehen. Sie nehmen nur stark vereinfachte Kernbotschaften und interpretieren sie falsch. Andererseits gibt es bei der Neurowissenschaft Menschen, die nicht verstehen, was philosophische Fragen ausmacht und wie tief greifend sie sind.“
Ein Beispiel für eine verschränkte Forschung mit dem Wissen aus beiden Disziplinen ist das sogenannte Bereitschaftspotenzial – ein elektrochemisches Signal in Nervenzellen. Das lässt sich messen – Millisekunden bevor wir uns entscheiden, eine Bewegung zu machen. Daraus leiten viele Studien ab, dass unsere Handlungen vorbestimmt sind und wir keinen freien Willen hätten. Für Roski eine grobe Fehlannahme:
„Erstens glaube ich, das Bereitschaftspotenzial ist nur ein Messfehler der durchgeführten Experimente und Techniken. Zweitens, glaube ich, ein Gehirn das etwas macht, bevor wir uns darüber bewusst sind, ist exakt das, was man von einem biologischen System erwartet.“
Außerdem gibt es in der Philosophie mehrere Theorien, die zeigen: Vorbestimmtheit und freier Willen schließen sich nicht gegenseitig aus. Für Adina Roski ein Beispiel, das zeigt: Es braucht Philosoph:innen, die mit empirischen Methoden arbeiten UND sie interpretieren können. Sie hofft, dass die Kombination hilft, die Geheimnisse unseres Geistes und Gehirns zu entschlüsseln. Und auch Joshua Knobe ist sicher: Die experimentelle Philosophie entwickelt sich weiter.
„Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen: Der große Erfolg der Bewegung der experimentellen Philosophie wird dazu führen, eine Idee zu eliminieren. Nämlich die Idee, dass es überhaupt eine experimentelle Philosophiebewegung gibt. Irgendwann wird man verstehen, dass Philosophen viele Dinge können. Und eines davon ist, Experimente zu machen.“