Roman Herzog: Europa neu erfinden. Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie
Siedler Verlag München, März 2014
160 Seiten, 17,99 Euro, auch als ebook
Die Undankbarkeit der Bürger

Er bringt einen nüchternen Ton in die Europa-Debatte. Altbundespräsident Roman Herzog verzichtet auf jenes Pathos, mit dem Politiker den Blick auf die realen Probleme des politischen Alltags gelegentlich vernebeln. Zugleich verweigert er sich einer blindwütigen Kritik an den Institutionen der Europäischen Union.
Dies ist umso angenehmer, als eine bisweilen hasserfüllte Polemik gegen die EU nach den Erfolgen links- und rechtsextremer Anti-Europa-Parteien in vielen Ländern populär geworden ist.
Der Altbundespräsident verweist hingegen darauf, dass Menschen positive Entwicklungen sehr schnell für selbstverständlich erachten. Er spricht von der "notorischen Undankbarkeit der Unionsbürger". Sie würden oft zu spät erkennen, dass Errungenschaften wieder verloren gehen können.
Wie gefährdet zum Beispiel der Frieden in Europa ist, zeigt die Krise um die Ukraine. Selbst innerhalb der EU sind Konflikte nicht ausgeschlossen. Man denke nur an die nationalistische Rhetorik der wiedergewählten Regierung Orbán in Ungarn gegenüber den EU-Nachbarn Rumänien und Slowakei.
Herzog relativiert auch den häufig gehörten Vorwurf, die EU versage regelmäßig außen- und sicherheitspolitisch. Zwar sei die Leistungsbilanz auf diesem Feld schlecht, doch sei dies nicht die Schuld der europäischen Institutionen:
"Dem großen Feld der 'außenpolitischen Bedürfnisse', die ein moderner Europäer sieht, steht eine weitreichende Kompetenzlosigkeit der EU gegenüber. Hier haben wir einen weiteren, entscheidenden Grund für die Unzufriedenheit der Unionsbürger mit der EU.
Die Verantwortung dafür tragen allerdings nicht so sehr die Organe der EU als vielmehr die Mitgliedstaaten, die diesen entweder wesentliche Funktionen vorenthalten oder selbst zu keiner einheitlichen Linie finden."
Ironie am Rande: Ausgerechnet die demokratieferne Abstimmung zwischen den Regierungen, wie sie in der Außen- und Sicherheitspolitik vorgesehen ist, dient den europakritischen Bewegungen für fast alle Politikbereiche als Vorbild.
Kritik an "Normenhypotrophie" in Brüssel
Sein besonderes Augenmerk richtet Herzog in dieser Denkschrift auf das, was andere "das Bürokratiemonster Brüssel" nennen. Er spricht lieber im nüchternen juristischen Duktus von einer Normenhypotrophie. Erschrocken konstatiert er, dass sämtliche Vorschriften der EU zusammengenommen rund 70.000 Druckseiten ergäben. So viele Vorschriften könne kein Mensch "im Kopf haben".
Natürlich weiß der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, dass dies auch niemand verlangen würde, zumal sich die Vorschriften auf viele spezielle Rechtsgebiete beziehen. Er gibt zudem zu, dass auch die Mitgliedstaaten unzählige, oft überflüssige Vorschriften hervorbringen.
Dennoch plädiert er dafür, das Prinzip der Subsidiarität, wie es in den europäischen Verträgen festgelegt ist, entschiedener durchzusetzen. Dieses Prinzip besagt: Nur was auf der niedrigeren Ebene nicht geregelt werden kann, sollte auf einer höheren Ebene geregelt werden.
Wer diesem sehr vernünftigen Vorschlag zustimmt, muss allerdings wissen: Der EU-Binnenmarkt kann unter diesen Umständen nur funktionieren, wenn alle Mitglieder ihre nationalen und regionalen Vorschriften untereinander anerkennen. Das gilt auch für den Verbraucherschutz, etwa bei der Technik- und Lebensmittelsicherheit. Es ist klar, dass auch ein solches Vorgehen Konflikte verursachen würde.
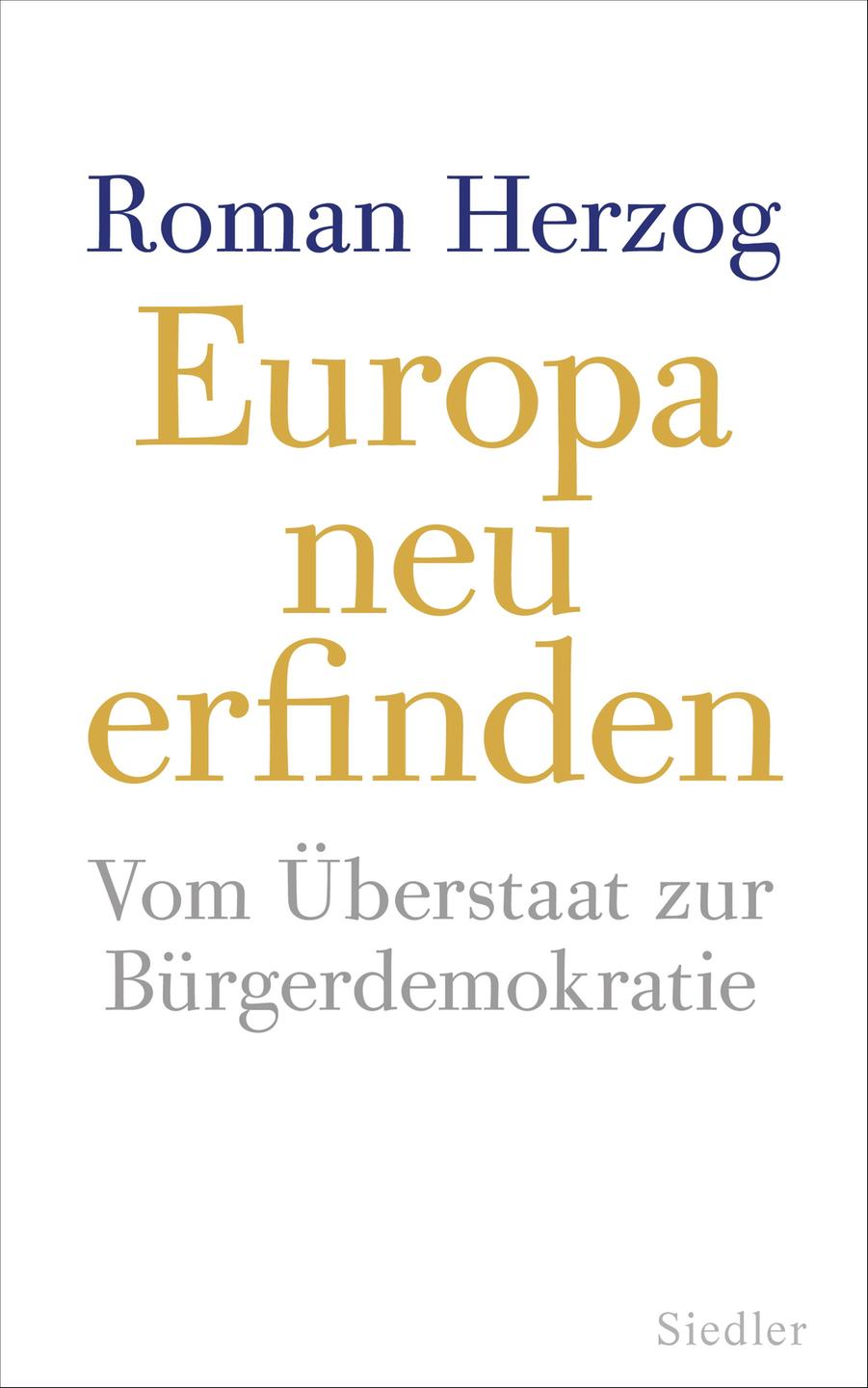
Cover Roman Herzog "Europa neu erfinden"© Siedler Verlag
Für die bestehenden Vorschriften der EU macht Herzog einen drastischen Vorschlag:
"Es kann also nicht darum gehen, jede europäische Rechtsnorm einzeln auf ihren Sinn hin zu überprüfen, sondern es muss von der Anzahl der Paragrafen ausgegangen werden. Ich habe einmal öffentlich empfohlen, für ein paar Rechtsgebiete Kommissionen zu bilden, diese einige Jahre arbeiten zu lassen und ihnen jedes Jahr eine Zahl von Vorschriften vorzugeben, die sie, mit welcher Begründung auch immer, außer Kraft setzen. Das mag auf den ersten Blick irrational erscheinen. Aber die Normenmenge ist ja ebenso entstanden."
Für Herzog besteht das Problem darin, dass die meisten Europäer sich zwar der Regelungskompetenz ihrer Nationalstaaten unterwürfen. Gegenüber dem Staatenverbund der EU fehle es ihnen jedoch an Loyalität. Es gebe keine europäische Nation. Deshalb seien die Völker nicht bereit, sich Mehrheitsentscheidungen zu unterwerfen, wenn sie ihren Kerninteressen widersprächen.
Er beschäftigt sich ausführlich mit der begriffstheoretischen Frage, ob die EU eher als Bundesstaat oder als Staatenbund zu werten sei. Und ringt sich zu keinem eindeutigen Urteil durch:
"So viel ist jedenfalls jetzt schon klar: kein Staat ohne Nation. Die EU hat keine Nation. Also ist sie kein Staat."
Dem kann man als Zustandsbeschreibung wenig entgegensetzen. Es handelt sich aber um eine erstaunlich unpolitische und unhistorische Betrachtung.
Zum einen sind weder Großbritannien mit Schottland noch Spanien mit Katalonien und dem Baskenland einheitliche Nationen. Zum anderen werden Nationen gemacht. Frankreich wurde nach der Revolution von 1789, Italien im Risorgimento aus heterogenen Regionen zur Nation zusammengeschweißt. Österreich und Deutschland hingegen wurden erst im 19. Jahrhundert zu zwei getrennten Nationen.
Herzogs altmodisch-statisches Nationenverständnis wird besonders deutlich, wenn er in einem historischen Exkurs von "früheren Kolonialvölkern" spricht, die nach dem Ende der Kolonialzeit zu ihrer "eigenen Identität" zurückgekehrt seien. In Wirklichkeit entstanden die meisten Völker und ihre angeblich ureigene Identität erst im Zuge der Kolonisierung.
Roman Herzogs kleine Denkschrift zu Europa ist klug. Sie ist begrifflich scharf und verständlich geschrieben, wenngleich nicht elegant. Aber letztlich handelt es sich um Betrachtungen eines Unpolitischen, eines Juraprofessors, dem das Uneindeutige des politischen Prozesses widerstrebt.
