Etwas zu waghalsig
Cay Rademacher hat zwar Geschichte studiert, verfolgt aber keinen rein wissenschaftlichen Anspruch. Als Autor zahlreicher historischer Krimis geht es ihm vor allem um die Darstellung, mit der man ein breites Publikum erreicht. Sein neuestes Buch handelt von den Kreuzzügen.
Mit "Blutige Pilgerfahrt" hat Cay Rademacher jetzt ein Buch über den ersten Kreuzzug vorgelegt, das ein bisschen von allem ist: journalistische Reportage, Sachbuch und epische Erzählung. Es beginnt mit einem dramatisierten Vorgriff auf die Erstürmung Jerusalems, um dann darzustellen, wie alles angefangen hatte: "Dienstag, 27. November 1095, vor den Mauern von Clermont" ist der Abschnitt überschrieben, in dem Papst Urban II. vor eine fanatisierte Menge tritt und sie zum Krieg gegen die Ungläubigen anstachelt:
"Und deshalb ermahne ich, nein, nicht ich, ermahnt Gott Euch als inständige Herolde Christi mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, reiche und arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern auszurotten und den christlichen Bewohnern rechtzeitig zu helfen."
Das ist eine Übersetzung jener Worte, mit denen Urban II. auf dem Konzil zu Clermont zum Kreuzzug aufgerufen haben soll. Dass er die Türken, stellvertretend für alle muslimischen Gegner, als "wertlose Rasse" schmähte, hat der Chronist Fulcher von Chartres überliefert. Ohne viel Aufhebens hat Rademacher seine Leser so an die historischen Quellen herangeführt, und es gelingt ihm gut, auch anderes Hintergrundwissen einfließen zu lassen: ‚Investiturstreit’, ‚Byzanz’, ‚Schisma’ und ‚Ehrbegriff’ sind Stichwörter, um die sich Schüler gerne herumdrücken. Hier bekommt man sie nebenbei mitserviert und dazu eine anschauliche Darstellungen dessen, was sich dahinter verbirgt.
Auch Rademachers Sinn für Action ist dem Gegenstand durchaus angemessen. Weder Kreuzfahrer noch Muslime bildeten einheitliche Fronten. Beide Lager, zwischen denen als Dritter noch der Kaiser von Byzanz intrigierte, bestanden aus instabilen Allianzen, deren Mitglieder einander oft wütend befehdeten. Rademacher zeigt auch, wie der Kreuzzug schon am Start von mörderischen Pogromen begleitet wurde, und wie manche hohen Herren den angeblichen Befreiungskrieg in eine Kolonisierung verwandelten, die ihnen kurzlebige Fürstentümer im Nahen Osten bescherte.
Statt Europa zu zerfleischen, wurde ein erheblicher Teil des europäischen Gewaltpotentials dadurch gen Osten abgeleitet – und hinterließ bei den Muslimen einen verheerenden, ja barbarischen Eindruck. Dass aber, wie Rademacher am Schluss unterstellt, Urban II. mit seinem Kreuzzugsaufruf schon die Globalisierung eingeläutet habe, erscheint etwas zu waghalsig.
Aber Rademachers Anliegen ist ja weniger die Neubewertung des Ersten Kreuzzuges als vielmehr dessen populäre Darstellung. Das klingt dann so:
"Montag, 13. Juni 1099, Jerusalem, morgens. Von der Stadtmauer hoch über dem rissigen, trockenen Boden regnet der Tod auf die Christen hinab. Sudanesische Bogenschützen, deren Geschosse noch auf hundert Meter Distanz schreckliche Wunden reißen, feuern Pfeil auf Pfeil. Arabische Männer werfen Speere und kopfgroße Steine. Kräftige Männer wuchten noch größere Brocken in die Schlinge einer Mangonel, einer baumlangen Steinschleuder, die ihre zentnerschwere Ladung anschließend mit einem kurzen Fauchen in die Ferne schickt."
Das ist gut inszeniert, aber ist es tatsächlich Geschichte, wie sie wirklich war? Die präzise Terminierung und Lokalisierung suggeriert eine Art Live-Reportage, doch bei näherer Betrachtung wirkt deren Bild schemenhaft. "Schreckliche Wunden" verursachen später auch die Bolzen europäischer Armbrüste. An anderer Stelle schlagen Pfeile "grausige Wunden". Doch was sagt uns das Wort "grausig"? Und wenn es kopfgroße, gar zentnerschwere Steine hagelt, kann man sich schwerlich vorstellen, dass Pfeilwunden dort besonders schrecklich erschienen.
Hätte Cay Rademacher die Kampfszene als Romancier beschrieben, so hätte er die Pfeilwunden schrecklich ausmalen können. Als Sachbuchautor aber ist er auf überlieferte Darstellungen und allgemeines Wissen über historische Waffen angewiesen. Er kann das kombinieren, auch etwas strapazieren, doch etwas Neues hinzufügen darf er nicht. Andererseits darf er auch kein Quellenverächter sein und muss manches mitnehmen, weil nichts anderes da ist. Deshalb ist sein Bild der Geschichte mal sehr detailliert, mal nur skizzenhaft.
Der Normanne Bohemund von Tarent etwa wird vorgestellt als:
"…gut aussehend, hochgewachsen, wenn auch etwas gebeugt gehend, breitschultrig, schmalhüftig, mit der reinen Haut eines Jünglings"
– ganz so, wie man ihn aus dem Bericht der byzantinischen Kaisertochter Anna Komnena kennt. Dass Bohemund einen starken Eindruck auf sie gemacht hat, lässt sich auch daran ermessen, dass er der einzige Kreuzfahrer ist, den sie näher beschrieben hat. So kämpft dieses breitschultrige Bild von einem Normannen dann in einem Heer meist schattenhafter Gestalten, deren Porträts auszumalen sich der Historiker Cay Rademacher versagen musste.
Obwohl und auch gerade weil der Historiker dem Erzähler Rademacher so immer wieder Zügel anlegt, bietet seine "Blutige Pilgerfahrt" eine oft mitreißende und doch solide Einführung in die Geschichte der Kreuzzüge. Dass deren erzählerische Darstellung manchmal dichter an der historischen Wirklichkeit zu sein scheint als sie es sein kann, ist hier ein Lockmittel, das auch funktioniert, wenn man es durchschaut.
Cay Rademacher: Blutige Pilgerfahrt. Der Erste Kreuzzug ins Heilige Land
Piper Verlag
"Und deshalb ermahne ich, nein, nicht ich, ermahnt Gott Euch als inständige Herolde Christi mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, reiche und arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern auszurotten und den christlichen Bewohnern rechtzeitig zu helfen."
Das ist eine Übersetzung jener Worte, mit denen Urban II. auf dem Konzil zu Clermont zum Kreuzzug aufgerufen haben soll. Dass er die Türken, stellvertretend für alle muslimischen Gegner, als "wertlose Rasse" schmähte, hat der Chronist Fulcher von Chartres überliefert. Ohne viel Aufhebens hat Rademacher seine Leser so an die historischen Quellen herangeführt, und es gelingt ihm gut, auch anderes Hintergrundwissen einfließen zu lassen: ‚Investiturstreit’, ‚Byzanz’, ‚Schisma’ und ‚Ehrbegriff’ sind Stichwörter, um die sich Schüler gerne herumdrücken. Hier bekommt man sie nebenbei mitserviert und dazu eine anschauliche Darstellungen dessen, was sich dahinter verbirgt.
Auch Rademachers Sinn für Action ist dem Gegenstand durchaus angemessen. Weder Kreuzfahrer noch Muslime bildeten einheitliche Fronten. Beide Lager, zwischen denen als Dritter noch der Kaiser von Byzanz intrigierte, bestanden aus instabilen Allianzen, deren Mitglieder einander oft wütend befehdeten. Rademacher zeigt auch, wie der Kreuzzug schon am Start von mörderischen Pogromen begleitet wurde, und wie manche hohen Herren den angeblichen Befreiungskrieg in eine Kolonisierung verwandelten, die ihnen kurzlebige Fürstentümer im Nahen Osten bescherte.
Statt Europa zu zerfleischen, wurde ein erheblicher Teil des europäischen Gewaltpotentials dadurch gen Osten abgeleitet – und hinterließ bei den Muslimen einen verheerenden, ja barbarischen Eindruck. Dass aber, wie Rademacher am Schluss unterstellt, Urban II. mit seinem Kreuzzugsaufruf schon die Globalisierung eingeläutet habe, erscheint etwas zu waghalsig.
Aber Rademachers Anliegen ist ja weniger die Neubewertung des Ersten Kreuzzuges als vielmehr dessen populäre Darstellung. Das klingt dann so:
"Montag, 13. Juni 1099, Jerusalem, morgens. Von der Stadtmauer hoch über dem rissigen, trockenen Boden regnet der Tod auf die Christen hinab. Sudanesische Bogenschützen, deren Geschosse noch auf hundert Meter Distanz schreckliche Wunden reißen, feuern Pfeil auf Pfeil. Arabische Männer werfen Speere und kopfgroße Steine. Kräftige Männer wuchten noch größere Brocken in die Schlinge einer Mangonel, einer baumlangen Steinschleuder, die ihre zentnerschwere Ladung anschließend mit einem kurzen Fauchen in die Ferne schickt."
Das ist gut inszeniert, aber ist es tatsächlich Geschichte, wie sie wirklich war? Die präzise Terminierung und Lokalisierung suggeriert eine Art Live-Reportage, doch bei näherer Betrachtung wirkt deren Bild schemenhaft. "Schreckliche Wunden" verursachen später auch die Bolzen europäischer Armbrüste. An anderer Stelle schlagen Pfeile "grausige Wunden". Doch was sagt uns das Wort "grausig"? Und wenn es kopfgroße, gar zentnerschwere Steine hagelt, kann man sich schwerlich vorstellen, dass Pfeilwunden dort besonders schrecklich erschienen.
Hätte Cay Rademacher die Kampfszene als Romancier beschrieben, so hätte er die Pfeilwunden schrecklich ausmalen können. Als Sachbuchautor aber ist er auf überlieferte Darstellungen und allgemeines Wissen über historische Waffen angewiesen. Er kann das kombinieren, auch etwas strapazieren, doch etwas Neues hinzufügen darf er nicht. Andererseits darf er auch kein Quellenverächter sein und muss manches mitnehmen, weil nichts anderes da ist. Deshalb ist sein Bild der Geschichte mal sehr detailliert, mal nur skizzenhaft.
Der Normanne Bohemund von Tarent etwa wird vorgestellt als:
"…gut aussehend, hochgewachsen, wenn auch etwas gebeugt gehend, breitschultrig, schmalhüftig, mit der reinen Haut eines Jünglings"
– ganz so, wie man ihn aus dem Bericht der byzantinischen Kaisertochter Anna Komnena kennt. Dass Bohemund einen starken Eindruck auf sie gemacht hat, lässt sich auch daran ermessen, dass er der einzige Kreuzfahrer ist, den sie näher beschrieben hat. So kämpft dieses breitschultrige Bild von einem Normannen dann in einem Heer meist schattenhafter Gestalten, deren Porträts auszumalen sich der Historiker Cay Rademacher versagen musste.
Obwohl und auch gerade weil der Historiker dem Erzähler Rademacher so immer wieder Zügel anlegt, bietet seine "Blutige Pilgerfahrt" eine oft mitreißende und doch solide Einführung in die Geschichte der Kreuzzüge. Dass deren erzählerische Darstellung manchmal dichter an der historischen Wirklichkeit zu sein scheint als sie es sein kann, ist hier ein Lockmittel, das auch funktioniert, wenn man es durchschaut.
Cay Rademacher: Blutige Pilgerfahrt. Der Erste Kreuzzug ins Heilige Land
Piper Verlag
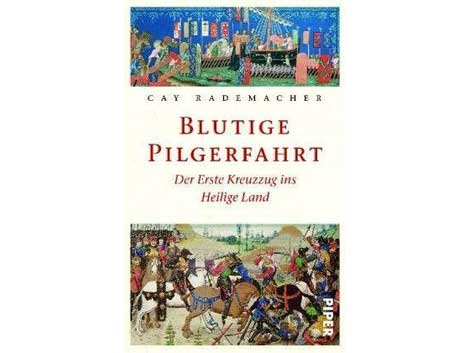
Cay Rademacher: Blutige Pilgerfahrt. Der Erste Kreuzzug ins Heilige Land© Piper Verlag
