Eine schillernde Familie
Die Familie Wittgenstein war reich – an Geld, an Genies, an Verrückten und Selbstmördern. Man könnte auch sagen, an Hochbegabten, von denen die einen sich umgebracht haben und die anderen Berühmtheiten geworden sind.
Ganz vorne im Buch ist der Stammbaum abgedruckt, man sieht gleich, dasss sich nicht (wie in schwierigen Zeiten behauptet) um eine alte, womöglich adelige Familie handelt, sondern um den Clan des Industriellen Karl Wittgenstein, 1847 als erfolgreichstes von 11 Kindern eines Grundstückverwalters geboren. Der Vater wird einhellig als Despot beschrieben. Anfangs selbst ein Rebell, der seinem ebenfalls despotischen Vater davonlief, wurde er mit Stahl-, Berg- und Walzwerken unermesslich reich – auf seine Art ein Mythos.
"Am Ende seiner Laufbahn gefiel es Karl, wenn man ihn als Selfmademan bezeichnete, obwohl dieser Ausdruck nicht ganz den Tatsachen entsprach. Wie viele Männer, denen man nachsagt, sie hätten ihr Leben ganz aus sich selbst heraus gestaltet, übersah Karl gern die Tatsache, dass er eine überaus vermögende Dame geheiratet hatte, ohne deren ergiebige Geldquellen ihm der Sprung vom einfachen Angestellten zum kapitalistischen Unternehmer vielleicht nie geglückt wäre."
Die Frau war Leopoldine Kalmus, trotz ihrer jüdischen Wurzeln eine gläubige Katholikin, was der Familie aber nach 1933 wenig geholfen hat. Alle neun Kinder von Karl und Leopoldine zeigten schon früh ihre Talente – als Musiker, Malerinnen, Mathematiker, drei Söhne haben sich das Leben genommen. Bei allen Kindern zeigen sich - oder zeigen sich ins Waughs Darstellung - Zeichen von Wahnsinn. Streckenweise liest sich das Buch wie ein Bericht über die Normalität von Psychosen, Waugh vertritt dabei manch starke These:
"Die Forderung, die auf den Brüdern Wittgenstein – Hans, Kurt, Rudi, Paul und Ludwig lastete: sich in der Welt der Schwerindustrie und der Banken, einen Namen zu machen, führte zu Nervenschwäche und selbst zerstörerischen Tendenzen, unter denen jeder von ihnen zu leiden hatte."
Die Atmosphäre in dem prächtigen Palais im 4. Wiener Bezirk wurde, abgesehen von den cholerischen Anfällen des Vaters, von Musik geprägt. Im ersten Stock befand sich der Musiksaal, geschmückt mit wertvollen Gobelins und Bildern, zwei Bösendorfer-Flügeln und vergoldeten Stehlampen. Unter den Gästen - Diplomaten, Künstlern, Schriftstellern und Komponisten – waren Richard Strauss, Gustav Mahler, Johannes Brahms und Arnold Schönberg, nicht zu vergessen die wichtigsten Musikkritiker der Zeit.
Der blinde Komponist Josef Labor gehörte gleichsam zur Familie und wurde, wie viele andere Künstler und auch Dichter, von Wittgenstein, Vater wie Mutter, Söhnen und Töchtern, gefördert. Man hat in diesem Haus den Reichtum ausgestellt. Waugh erwähnt wertvolle Autographen und eine Geige aus dem frühen 18. Jahrhundert, und erzählt:
"Es gehörte zu Karl Wittgensteins Obsessionen, die größten Zimmer [...] mit Waschräumen inklusive Klosetts auszustatten; die Hähne und Becken darin waren vergoldet."
Der Autor ist Musikkritiker. Seine Liebe und Bewunderung gehört vor allem Paul, dem einarmigen Klavierspieler, dessen Karriere und Gedanken den größten Teil des Buchs füllen. Er berichtet über Paul Wittgensteins Kriegsbegeisterung und den Schusswechsel, bei dem Paul die rechte Hand verlor und sehr eindrucksvoll über die grauenhaften Erlebnisse in der russischen Gefangenschaft.
Es ist ein Buch über ihn, und wenn man sich damit abgefunden hat, dass – vielleicht aus verkaufstechnischen Erwägungen – Familie draufsteht und Paul drin ist, ist es ein faszinierendes Buch. Man erfährt viel über Kompositionen, Komponisten und Instrumente, über die Musikstücke für die linke Hand, die Paul Wittgenstein bei Josef Labor, Franz Schmidt, Erich Wolfgang Korngold, Paul Hindemith und Sergej Bortkiewicz, auch bei Richard Strauß, Sergej Prokofjew und Maurice Ravel bestellte und die Konflikte, die dabei entstehen.
Paul sichert sich die Rechte an den Werken, er greift ein oder verlangt von den Komponisten Änderungen, streitet, macht großzügige Geschenke und organisiert Aufführungen mit den berühmtesten Orchestern. Der Musikagent Waugh goutiert speziell die rechtlichen und finanziellen Begleiterscheinungen dieser Aufträge:
"Erich Korngold [...] war noch keine dreißig Jahre alt, als Paul ihn bat, ein Concerto für ihn zu schreiben.[...] Seine Musik mag etwas moderner gewesen sein, als Paul es sich wünschte, doch für dreitausend Dollar konnte er wenigstens sicher sein, daß das Werke breite Zuschauerkreise erreichte, denn, wie der frühreife Komponist selbst ihm bestätigte, würden alle Dirigenten in Deutschland ein neues Stück von mir automatisch aufführen."
Als Paul bei Franz Schmidt ein neues Werk in Auftrag gab (Klammer auf Preis $ 6.000) konnte er damit rechnen, dass es in den wichtigsten Konzerthäusern Aufführungen geben würde. Richard Strauß erhält einen Vorschuss von 25.000 $ und komponiert für Paul Wittgenstein ein Parergon zur Sinfonia Domestica, das heißt ein Beiwerk zu einer Sinfonie, die er 20 Jahre davor geschrieben hatte.
"Der Preis für die Auftragswerke mag außergewöhnlich hoch gewesen sein, doch er zahlte sich aus. Genau wie er es geplant hatte, gehörte Paul fünf Jahre danach zu den wichtigen, ernstzunehmenden und hoch begehrten Künstlern der internationalen Konzertszene. Die Zeitungen der ganzen Welt berichteten über die Kompositionen."
Der Rest der Familie ist drumrumdrapiert. Hermine, die älteste Schwester, eine begabte Malerin, hat eine Familienchronik hinterlassen und kommt schon deshalb häufig zu Wort. Waugh bezeichnet sie als unglückliche alte Jungfer. Gretl, Margaret, die einen nur nach dem Grad der Neurosen, nicht nach Stand und Geld zur Familie passenden Mann geheiratet hat, ist laut Waugh frigide.
Sie kämpft als amerikanische Staatsbürgerin nach Hitlers Einmarsch in Österreich mit Beziehungen, Geld, und vor allem Mut, damit die Familie nicht als Volljuden sondern als Mischlinge eingestuft wird. Merkwürdig, beinahe lustig ist, wie in der Wittgenstein-Literatur mit dieser Jüdischkeit umgegangen wird. Hieß es in "Wittgensteins Wien" von 1984, es war eine jüdische Familie, so bei Waugh:
"Ende März kam Paul eines Morgens in Hermines Zimmer und sagte mit vor Entsetzen bleichem Gesicht: Wir gelten als Juden."
Bei aller Bewunderung für den einarmigen Klaviervirtuosen, über den man vieles erfährt, das die Bewunderung steigert, verblüfft, wie wenig von Ludwig die Rede ist. Was immer man von seinen Werken halten mag, hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein doch einen enormen Einfluss auf das Geistesleben des 20. Jahrhunderts gehabt. Waugh zeichnet ihn als eher groteske Figur, geistig erschöpft, eine verlorene Seele, die Gott sucht. So einfühlsam der Autor Pauls Torturen in Sibirien schildert, so wenig hat er ein Ohr für den Philosophen.
Bertrand Russel wird als bedeutender Lehrer erwähnt, aber vor allem berichtet der Chronist, dass Ludwig Wittgenstein ihn belästigt. Von den vielen Vorbildern Wittgensteins bleibt in diesem Buch vor allem Leo Tolstoi und dessen "Kurze Erläuterung des Evangeliums", das als Modell für den Tractatus logico-philosophicus vorgeführt wird.
Ob beim Versuch, sich in Demut zu üben oder als Volksschullehrer den Bauernkindern Mathematik beizubringen, als Architekt oder Philosoph wählt der Autor stets krude Szenen, die Ludwig Wittgenstein als Irren charakterisieren. Wenn er Freundliches zitiert, wischt er ihm mit einem Nebensatz eins aus:
"Ludwig übte auf Männer und Frauen noch immer eine faszinierende Wirkung aus. Wenn man in seiner Nähe war, geriet die enttäuschende Tatsache, dass man nicht in der Lage gewesen war, seine Philosophie zu verstehen, leicht in Vergessenheit."
Oder: "Er diktierte – angespannt, stotternd, schwitzend wie der Prophet Mohammed bei der Verkündigung des Korans in Medina ... philosophische Texte"," hat ""einen christusgleichen Status in den philosophischen Zirkeln in Cambridge."
Es konnte nicht bewiesen werden, aber vielleicht war er als Agent für die Sowjets tätig (während Paul den Heimwehr-Führer Starhemberg finanziert). Er benimmt sich blamabel, geht nicht, wie Paul, spazieren, um die Natur zu genießen "sondern nur, um im Gehen über seine Gedanken zu sprechen" und er ermüdet damit seine Begleiter. Als Architekt
""stellte er die strengsten Ansprüche an sich und die anderen, kümmerte sich mit pedantischer Strenge um die Form jedes Fensterriegels und jedes Heizkörpers, bestand darauf, daß die bereits verputzte Decke wieder heruntergenommen und um ein paar Zentimeter erhöht wurde, und versetzte die Handwerker in Angst und Schrecken, [...] alle Beteiligten waren am Ende ihrer Kraft, niedergeschlagen und erschöpft"."
Man erfährt viel über Zeitgeschichte, Verwandte, Geliebte, Ehemänner und auch ein wenig über Hitler - manches wirkt wie Füllmasse und erinnert an die Pieta von Käthe Kollwitz, die auf Wunsch Helmut Kohls aufgeblasen wurde - als hätte der Verlag befürchtet, daß eine Biographie Paul Wittgensteins allein zu wenige Leser locken würde. Ein interessantes, reiches Buch mit einem irreführenden Titel.
Alexander Waugh: Das Haus Wittgenstein. Geschichte einer ungewöhnlichen Familie
Fischer, Frankfurt/Main 2008
"Am Ende seiner Laufbahn gefiel es Karl, wenn man ihn als Selfmademan bezeichnete, obwohl dieser Ausdruck nicht ganz den Tatsachen entsprach. Wie viele Männer, denen man nachsagt, sie hätten ihr Leben ganz aus sich selbst heraus gestaltet, übersah Karl gern die Tatsache, dass er eine überaus vermögende Dame geheiratet hatte, ohne deren ergiebige Geldquellen ihm der Sprung vom einfachen Angestellten zum kapitalistischen Unternehmer vielleicht nie geglückt wäre."
Die Frau war Leopoldine Kalmus, trotz ihrer jüdischen Wurzeln eine gläubige Katholikin, was der Familie aber nach 1933 wenig geholfen hat. Alle neun Kinder von Karl und Leopoldine zeigten schon früh ihre Talente – als Musiker, Malerinnen, Mathematiker, drei Söhne haben sich das Leben genommen. Bei allen Kindern zeigen sich - oder zeigen sich ins Waughs Darstellung - Zeichen von Wahnsinn. Streckenweise liest sich das Buch wie ein Bericht über die Normalität von Psychosen, Waugh vertritt dabei manch starke These:
"Die Forderung, die auf den Brüdern Wittgenstein – Hans, Kurt, Rudi, Paul und Ludwig lastete: sich in der Welt der Schwerindustrie und der Banken, einen Namen zu machen, führte zu Nervenschwäche und selbst zerstörerischen Tendenzen, unter denen jeder von ihnen zu leiden hatte."
Die Atmosphäre in dem prächtigen Palais im 4. Wiener Bezirk wurde, abgesehen von den cholerischen Anfällen des Vaters, von Musik geprägt. Im ersten Stock befand sich der Musiksaal, geschmückt mit wertvollen Gobelins und Bildern, zwei Bösendorfer-Flügeln und vergoldeten Stehlampen. Unter den Gästen - Diplomaten, Künstlern, Schriftstellern und Komponisten – waren Richard Strauss, Gustav Mahler, Johannes Brahms und Arnold Schönberg, nicht zu vergessen die wichtigsten Musikkritiker der Zeit.
Der blinde Komponist Josef Labor gehörte gleichsam zur Familie und wurde, wie viele andere Künstler und auch Dichter, von Wittgenstein, Vater wie Mutter, Söhnen und Töchtern, gefördert. Man hat in diesem Haus den Reichtum ausgestellt. Waugh erwähnt wertvolle Autographen und eine Geige aus dem frühen 18. Jahrhundert, und erzählt:
"Es gehörte zu Karl Wittgensteins Obsessionen, die größten Zimmer [...] mit Waschräumen inklusive Klosetts auszustatten; die Hähne und Becken darin waren vergoldet."
Der Autor ist Musikkritiker. Seine Liebe und Bewunderung gehört vor allem Paul, dem einarmigen Klavierspieler, dessen Karriere und Gedanken den größten Teil des Buchs füllen. Er berichtet über Paul Wittgensteins Kriegsbegeisterung und den Schusswechsel, bei dem Paul die rechte Hand verlor und sehr eindrucksvoll über die grauenhaften Erlebnisse in der russischen Gefangenschaft.
Es ist ein Buch über ihn, und wenn man sich damit abgefunden hat, dass – vielleicht aus verkaufstechnischen Erwägungen – Familie draufsteht und Paul drin ist, ist es ein faszinierendes Buch. Man erfährt viel über Kompositionen, Komponisten und Instrumente, über die Musikstücke für die linke Hand, die Paul Wittgenstein bei Josef Labor, Franz Schmidt, Erich Wolfgang Korngold, Paul Hindemith und Sergej Bortkiewicz, auch bei Richard Strauß, Sergej Prokofjew und Maurice Ravel bestellte und die Konflikte, die dabei entstehen.
Paul sichert sich die Rechte an den Werken, er greift ein oder verlangt von den Komponisten Änderungen, streitet, macht großzügige Geschenke und organisiert Aufführungen mit den berühmtesten Orchestern. Der Musikagent Waugh goutiert speziell die rechtlichen und finanziellen Begleiterscheinungen dieser Aufträge:
"Erich Korngold [...] war noch keine dreißig Jahre alt, als Paul ihn bat, ein Concerto für ihn zu schreiben.[...] Seine Musik mag etwas moderner gewesen sein, als Paul es sich wünschte, doch für dreitausend Dollar konnte er wenigstens sicher sein, daß das Werke breite Zuschauerkreise erreichte, denn, wie der frühreife Komponist selbst ihm bestätigte, würden alle Dirigenten in Deutschland ein neues Stück von mir automatisch aufführen."
Als Paul bei Franz Schmidt ein neues Werk in Auftrag gab (Klammer auf Preis $ 6.000) konnte er damit rechnen, dass es in den wichtigsten Konzerthäusern Aufführungen geben würde. Richard Strauß erhält einen Vorschuss von 25.000 $ und komponiert für Paul Wittgenstein ein Parergon zur Sinfonia Domestica, das heißt ein Beiwerk zu einer Sinfonie, die er 20 Jahre davor geschrieben hatte.
"Der Preis für die Auftragswerke mag außergewöhnlich hoch gewesen sein, doch er zahlte sich aus. Genau wie er es geplant hatte, gehörte Paul fünf Jahre danach zu den wichtigen, ernstzunehmenden und hoch begehrten Künstlern der internationalen Konzertszene. Die Zeitungen der ganzen Welt berichteten über die Kompositionen."
Der Rest der Familie ist drumrumdrapiert. Hermine, die älteste Schwester, eine begabte Malerin, hat eine Familienchronik hinterlassen und kommt schon deshalb häufig zu Wort. Waugh bezeichnet sie als unglückliche alte Jungfer. Gretl, Margaret, die einen nur nach dem Grad der Neurosen, nicht nach Stand und Geld zur Familie passenden Mann geheiratet hat, ist laut Waugh frigide.
Sie kämpft als amerikanische Staatsbürgerin nach Hitlers Einmarsch in Österreich mit Beziehungen, Geld, und vor allem Mut, damit die Familie nicht als Volljuden sondern als Mischlinge eingestuft wird. Merkwürdig, beinahe lustig ist, wie in der Wittgenstein-Literatur mit dieser Jüdischkeit umgegangen wird. Hieß es in "Wittgensteins Wien" von 1984, es war eine jüdische Familie, so bei Waugh:
"Ende März kam Paul eines Morgens in Hermines Zimmer und sagte mit vor Entsetzen bleichem Gesicht: Wir gelten als Juden."
Bei aller Bewunderung für den einarmigen Klaviervirtuosen, über den man vieles erfährt, das die Bewunderung steigert, verblüfft, wie wenig von Ludwig die Rede ist. Was immer man von seinen Werken halten mag, hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein doch einen enormen Einfluss auf das Geistesleben des 20. Jahrhunderts gehabt. Waugh zeichnet ihn als eher groteske Figur, geistig erschöpft, eine verlorene Seele, die Gott sucht. So einfühlsam der Autor Pauls Torturen in Sibirien schildert, so wenig hat er ein Ohr für den Philosophen.
Bertrand Russel wird als bedeutender Lehrer erwähnt, aber vor allem berichtet der Chronist, dass Ludwig Wittgenstein ihn belästigt. Von den vielen Vorbildern Wittgensteins bleibt in diesem Buch vor allem Leo Tolstoi und dessen "Kurze Erläuterung des Evangeliums", das als Modell für den Tractatus logico-philosophicus vorgeführt wird.
Ob beim Versuch, sich in Demut zu üben oder als Volksschullehrer den Bauernkindern Mathematik beizubringen, als Architekt oder Philosoph wählt der Autor stets krude Szenen, die Ludwig Wittgenstein als Irren charakterisieren. Wenn er Freundliches zitiert, wischt er ihm mit einem Nebensatz eins aus:
"Ludwig übte auf Männer und Frauen noch immer eine faszinierende Wirkung aus. Wenn man in seiner Nähe war, geriet die enttäuschende Tatsache, dass man nicht in der Lage gewesen war, seine Philosophie zu verstehen, leicht in Vergessenheit."
Oder: "Er diktierte – angespannt, stotternd, schwitzend wie der Prophet Mohammed bei der Verkündigung des Korans in Medina ... philosophische Texte"," hat ""einen christusgleichen Status in den philosophischen Zirkeln in Cambridge."
Es konnte nicht bewiesen werden, aber vielleicht war er als Agent für die Sowjets tätig (während Paul den Heimwehr-Führer Starhemberg finanziert). Er benimmt sich blamabel, geht nicht, wie Paul, spazieren, um die Natur zu genießen "sondern nur, um im Gehen über seine Gedanken zu sprechen" und er ermüdet damit seine Begleiter. Als Architekt
""stellte er die strengsten Ansprüche an sich und die anderen, kümmerte sich mit pedantischer Strenge um die Form jedes Fensterriegels und jedes Heizkörpers, bestand darauf, daß die bereits verputzte Decke wieder heruntergenommen und um ein paar Zentimeter erhöht wurde, und versetzte die Handwerker in Angst und Schrecken, [...] alle Beteiligten waren am Ende ihrer Kraft, niedergeschlagen und erschöpft"."
Man erfährt viel über Zeitgeschichte, Verwandte, Geliebte, Ehemänner und auch ein wenig über Hitler - manches wirkt wie Füllmasse und erinnert an die Pieta von Käthe Kollwitz, die auf Wunsch Helmut Kohls aufgeblasen wurde - als hätte der Verlag befürchtet, daß eine Biographie Paul Wittgensteins allein zu wenige Leser locken würde. Ein interessantes, reiches Buch mit einem irreführenden Titel.
Alexander Waugh: Das Haus Wittgenstein. Geschichte einer ungewöhnlichen Familie
Fischer, Frankfurt/Main 2008
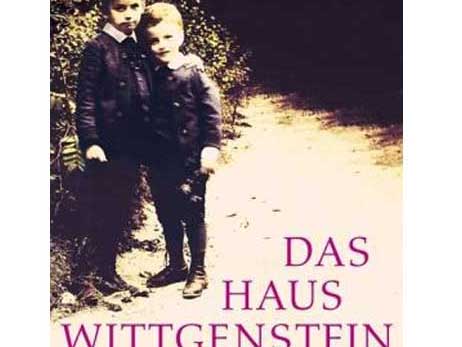
Cover: "Alexander Waugh: Das Haus Wittgenstein"© Fischer Verlag
