Eine machtvolle Familie
Der Wirtschaftsjournalist Jonathan Carr erzählt "die Geschichte einer deutschen Familie" von Richard Wagners Geburt 1813 bis zu den jüngsten Ereignissen rund um Wolfgang Wagners Nachfolge. Das Buch berichtet auch vom Aufstieg eines machtvollen Clans. Es geht um sehr viel Geld, um den Alleinvertretungsanspruch auf ein Kunstwerk sowie um politischen Einfluss.
Die Familie Wagner ist - ähnlich wie die Familie Mann - ein kleiner Kosmos für sich. In diesem Wagner-Universum erblicken wir zwei Fixsterne (Richard und Cosima), die scheinbar unverrückbar am Himmel stehen, fünf kleinere Sterne (die Wagner-Kinder) und – um bei dem Bild zu bleiben – eine ganze Reihe von eingeheirateten Familienmitgliedern, die als Satelliten und Trabanten vorbeiziehen.
Was fehlt, ist so etwas wie eine "Sternenkarte" – ein biografisches Verzeichnis, das die Mitglieder des Clans in ein richtiges Verhältnis zueinander setzt. Der Wirtschaftsjournalist Jonathan Carr hat nun jenen Weltenraum vermessen und erzählt "die Geschichte einer deutschen Familie" von Richard Wagners Geburt 1813 bis zu den jüngsten Ereignissen rund um Wolfgang Wagners Nachfolge.
Carrs Buch berichtet auch vom Aufstieg eines machtvollen Clans. Es geht um Geld, sehr viel Geld, um den Alleinvertretungsanspruch auf ein Kunstwerk sowie um politischen Einfluss:
"[Wagner] wurde 1813 in Leipzig geboren, als Napoleons Heere vor dessen Toren standen, und starb 1883 in Venedig, zwölf Jahre, nachdem Deutschland die Einheit erlangte, die er ersehnt und für die er gekämpft hatte. Sein Sohn Siegfried hingegen bildet den Einstieg in eine immer noch unbehaglich nahe Ära. Zwar starb er 1930, drei Jahre bevor die Nazis ihr ‘Drittes Reich’ ausriefen, musste aber dennoch miterleben, wie sich seine Familie, insbesondere seine Frau Winifred, aufs engste mit Adolf Hitler einließ.
Von Siegfrieds vier Kindern floh die älteste Tochter, Friedelind, die die Nazis hasste, nach Amerika, während die andere, Verena, im Land blieb und einen hohen SS-Offizier heiratete. Nach dem Krieg brachten die beiden Söhne Wieland und Wolfgang es weitgehend fertig, sich der langen Liaison der Familie mit ‘Onkel Wolf’ zu entledigen, und ließen 1951 die Wagner-Festspiele in Bayreuth wiederaufleben, wo ihr Großvater acht Jahrzehnte zuvor das Ganze in Gang gesetzt hatte. Verena und Wolfgang haben den Jahrtausendwechsel überlebt, und letzterer leitet bei Entstehung dieser Zeilen immer noch die Festspiele, trotz gelegentlicher Versuche, ihm die Dinge aus der Hand zu nehmen."
Die Wagners wären nicht die Wagners, wenn sie nicht auch durch viel Getratsche, Streitereien und Intrigen von sich Reden gemacht hätten:
"Die Wagner-Saga zieht selbst jene in ihren Bann, die mit Geschichte wenig und mit Musikdramen in Marathonlänge erst recht nichts im Sinn haben. Die Raffgier und Eifersucht, das Gezänk und Gekeife in und um den mit ‘Wahnfried’ eher das Gegenteil nahe legenden Familiensitz stellen selbst die abgefeimtesten Folgen von ‘Denver’ oder ‘Dallas’ in den Schatten."
Doch der Autor hat mehr im Sinn als eine Chronique scandaleuse. Am Ende seines Vorwortes schreibt er:
"Wer in der Wagner-Saga nach Belegen für den deutschen Volkscharakter sucht, wird mit Sicherheit reichlich fündig werden, doch harrt seiner auch manche Überraschung."
Der "deutsche Volkscharakter"? Eine merkwürdige Formulierung, mag man denken, die nicht recht in das frühe 21. Jahrhundert zu passen scheint. Doch dieser Terminus zeigt eine grundsätzliche Eigenschaft des Werks: man merkt ihm an, dass es ursprünglich für ein Nicht-Deutsches Publikum geschrieben wurde. Hin und wieder liefert der Autor reflexive Einschübe über das "Deutsche", über das deutsche Volk, über deutsche Geschichte, deutsche Musik, deutsche Literatur oder eben den "deutschen Volkscharakter", die einem Nicht-Deutschen Leser offensichtlich Orientierung vermitteln sollen.
Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, doch Carrs Exkurse wirken mitunter unfreiwillig kurios. Carrs Buch ist flott geschrieben – etwas zu flott. Denn was unangenehm auffällt und das Lesevergnügen leider trübt, ist die flapsige Sprache. Im Kapitel "Wolf ante Portas" beschreibt der Autor Adolf Hitlers ersten Bayreuth-Besuch im Stil einer Seifenoper:
"Winifred ihrerseits verliebte sich augenblicklich in den acht Jahre älteren, blauäugigen Charmeur, der so hinreißend von seinen Zielen für Deutschland und seiner Leidenschaft für Richard Wagner zu reden wusste."
Winifreds Ehemann Siegfried sei das einzige Clan-Mitglied gewesen, das Adolf Hitler distanziert gegenüber gestanden habe. Auch hier mag man ein kleines Fragezeichen setzen, zumal die Siegfried-Wagner-Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. Aber so weit – so gut.
Jonathan Carrs "Geschichte einer deutschen Familie", ist dort authentisch, wo der Autor aus eigenem Miterleben schöpfen kann. Und so endet das Buch mit aktuellen Ausführungen über Bayreuths Zukunft. Carr beschreibt die Machtverhältnisse und die Entwicklungen seit Ende der 1990er bis zu Gudrun Wagners Tod im vergangenen Jahr. Kenntnisreich diskutiert er die verschiedenen Anläufe, die Nachfolge Wolfgang Wagners zu regeln:
"Die Konzentration der Nachfolge-Saga auf Katharina war durchaus natürlich, hatte aber auch Nachteile – nicht zuletzt für sie selbst. Unausweichlich lasteten übermäßige, positive wie negative, Erwartungen auf jeder ihrer Neuinszenierungen. Ein halbwegs einfallsreicher Regieschritt wurde von Wohlmeinenden prompt zum Abglanz Wagnerscher Genialität hochstilisiert, jede bescheidene Unstimmigkeit von Kritikern als Beweis ins Feld geführt, das Mädchen verdanke ihre Beschäftigung einzig dem strippen ziehenden Papa. Die schlichte Wahrheit lautet, dass Katharina das Theaterhandwerk ordentlich erlernt hat, eine Truppe mit sanfter, aber fester Hand führen kann und eine Menge Ideen besitzt, darunter ein paar alberne."
Hier ist der Autor in seinem Element. Vom Verlag heißt es: "Als auch in Fachkreisen ausgewiesener Wagner-Kenner und –Liebhaber besucht er seit 1970 regelmäßig Bayreuth." Diese Nähe zum Betrieb und die persönliche Bekanntschaft mit einigen Protagonisten des Clans tun dem Schlusskapitel gut. Alles in allem gewinnt man den Eindruck, dass Jonathan Carr als "ausgewiesener Wagner-Liebhaber" glücklicher fungiert als in der Rolle eines quellenkritisch arbeitenden Biografen.
Jonathan Carr: Der Wagner-Clan – Die Geschichte einer deutschen Familie
aus dem Englischen von Hermann Kusterer
Hoffmann und Campe Verlag 2008
Was fehlt, ist so etwas wie eine "Sternenkarte" – ein biografisches Verzeichnis, das die Mitglieder des Clans in ein richtiges Verhältnis zueinander setzt. Der Wirtschaftsjournalist Jonathan Carr hat nun jenen Weltenraum vermessen und erzählt "die Geschichte einer deutschen Familie" von Richard Wagners Geburt 1813 bis zu den jüngsten Ereignissen rund um Wolfgang Wagners Nachfolge.
Carrs Buch berichtet auch vom Aufstieg eines machtvollen Clans. Es geht um Geld, sehr viel Geld, um den Alleinvertretungsanspruch auf ein Kunstwerk sowie um politischen Einfluss:
"[Wagner] wurde 1813 in Leipzig geboren, als Napoleons Heere vor dessen Toren standen, und starb 1883 in Venedig, zwölf Jahre, nachdem Deutschland die Einheit erlangte, die er ersehnt und für die er gekämpft hatte. Sein Sohn Siegfried hingegen bildet den Einstieg in eine immer noch unbehaglich nahe Ära. Zwar starb er 1930, drei Jahre bevor die Nazis ihr ‘Drittes Reich’ ausriefen, musste aber dennoch miterleben, wie sich seine Familie, insbesondere seine Frau Winifred, aufs engste mit Adolf Hitler einließ.
Von Siegfrieds vier Kindern floh die älteste Tochter, Friedelind, die die Nazis hasste, nach Amerika, während die andere, Verena, im Land blieb und einen hohen SS-Offizier heiratete. Nach dem Krieg brachten die beiden Söhne Wieland und Wolfgang es weitgehend fertig, sich der langen Liaison der Familie mit ‘Onkel Wolf’ zu entledigen, und ließen 1951 die Wagner-Festspiele in Bayreuth wiederaufleben, wo ihr Großvater acht Jahrzehnte zuvor das Ganze in Gang gesetzt hatte. Verena und Wolfgang haben den Jahrtausendwechsel überlebt, und letzterer leitet bei Entstehung dieser Zeilen immer noch die Festspiele, trotz gelegentlicher Versuche, ihm die Dinge aus der Hand zu nehmen."
Die Wagners wären nicht die Wagners, wenn sie nicht auch durch viel Getratsche, Streitereien und Intrigen von sich Reden gemacht hätten:
"Die Wagner-Saga zieht selbst jene in ihren Bann, die mit Geschichte wenig und mit Musikdramen in Marathonlänge erst recht nichts im Sinn haben. Die Raffgier und Eifersucht, das Gezänk und Gekeife in und um den mit ‘Wahnfried’ eher das Gegenteil nahe legenden Familiensitz stellen selbst die abgefeimtesten Folgen von ‘Denver’ oder ‘Dallas’ in den Schatten."
Doch der Autor hat mehr im Sinn als eine Chronique scandaleuse. Am Ende seines Vorwortes schreibt er:
"Wer in der Wagner-Saga nach Belegen für den deutschen Volkscharakter sucht, wird mit Sicherheit reichlich fündig werden, doch harrt seiner auch manche Überraschung."
Der "deutsche Volkscharakter"? Eine merkwürdige Formulierung, mag man denken, die nicht recht in das frühe 21. Jahrhundert zu passen scheint. Doch dieser Terminus zeigt eine grundsätzliche Eigenschaft des Werks: man merkt ihm an, dass es ursprünglich für ein Nicht-Deutsches Publikum geschrieben wurde. Hin und wieder liefert der Autor reflexive Einschübe über das "Deutsche", über das deutsche Volk, über deutsche Geschichte, deutsche Musik, deutsche Literatur oder eben den "deutschen Volkscharakter", die einem Nicht-Deutschen Leser offensichtlich Orientierung vermitteln sollen.
Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, doch Carrs Exkurse wirken mitunter unfreiwillig kurios. Carrs Buch ist flott geschrieben – etwas zu flott. Denn was unangenehm auffällt und das Lesevergnügen leider trübt, ist die flapsige Sprache. Im Kapitel "Wolf ante Portas" beschreibt der Autor Adolf Hitlers ersten Bayreuth-Besuch im Stil einer Seifenoper:
"Winifred ihrerseits verliebte sich augenblicklich in den acht Jahre älteren, blauäugigen Charmeur, der so hinreißend von seinen Zielen für Deutschland und seiner Leidenschaft für Richard Wagner zu reden wusste."
Winifreds Ehemann Siegfried sei das einzige Clan-Mitglied gewesen, das Adolf Hitler distanziert gegenüber gestanden habe. Auch hier mag man ein kleines Fragezeichen setzen, zumal die Siegfried-Wagner-Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. Aber so weit – so gut.
Jonathan Carrs "Geschichte einer deutschen Familie", ist dort authentisch, wo der Autor aus eigenem Miterleben schöpfen kann. Und so endet das Buch mit aktuellen Ausführungen über Bayreuths Zukunft. Carr beschreibt die Machtverhältnisse und die Entwicklungen seit Ende der 1990er bis zu Gudrun Wagners Tod im vergangenen Jahr. Kenntnisreich diskutiert er die verschiedenen Anläufe, die Nachfolge Wolfgang Wagners zu regeln:
"Die Konzentration der Nachfolge-Saga auf Katharina war durchaus natürlich, hatte aber auch Nachteile – nicht zuletzt für sie selbst. Unausweichlich lasteten übermäßige, positive wie negative, Erwartungen auf jeder ihrer Neuinszenierungen. Ein halbwegs einfallsreicher Regieschritt wurde von Wohlmeinenden prompt zum Abglanz Wagnerscher Genialität hochstilisiert, jede bescheidene Unstimmigkeit von Kritikern als Beweis ins Feld geführt, das Mädchen verdanke ihre Beschäftigung einzig dem strippen ziehenden Papa. Die schlichte Wahrheit lautet, dass Katharina das Theaterhandwerk ordentlich erlernt hat, eine Truppe mit sanfter, aber fester Hand führen kann und eine Menge Ideen besitzt, darunter ein paar alberne."
Hier ist der Autor in seinem Element. Vom Verlag heißt es: "Als auch in Fachkreisen ausgewiesener Wagner-Kenner und –Liebhaber besucht er seit 1970 regelmäßig Bayreuth." Diese Nähe zum Betrieb und die persönliche Bekanntschaft mit einigen Protagonisten des Clans tun dem Schlusskapitel gut. Alles in allem gewinnt man den Eindruck, dass Jonathan Carr als "ausgewiesener Wagner-Liebhaber" glücklicher fungiert als in der Rolle eines quellenkritisch arbeitenden Biografen.
Jonathan Carr: Der Wagner-Clan – Die Geschichte einer deutschen Familie
aus dem Englischen von Hermann Kusterer
Hoffmann und Campe Verlag 2008
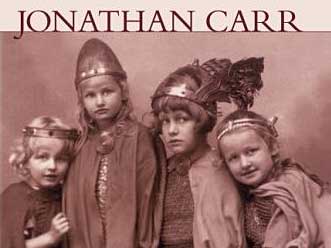
Jonathan Carr: Der Wagner Clan© Hoffmann und Campe
