Eine an Informationen übervolle Welt
Immer mehr Entscheidungen müssten gefällt werden, für die es keine Vorbilder und Beispiele gibt, konstatiert der Soziologe Peter Atteslander in seinem neusten Werk. Das führe zu einer Überforderung sowohl des Einzelnen als auch des Staates. Die leserfreundlichste Tat der Essaysammlung: ein Schlusskapitel mit Strategien gegen die Ratlosigkeit.
Der renommierte Soziologe Peter Atteslander, Emeritus der Universität Augsburg und ausgestattet mit einem beneidenswerten Bildungsweg zwischen der Schweiz, den USA und Deutschland hat mit Werken wie "Die letzten Tage der Gegenwart" und "Grenzen des Wohlstands" schon Marksteine für die öffentliche Diskussion geliefert. Seine zeitnahen und problembewussten Themenstellungen, die ohne Soziologendeutsch auskommen, ließen immer aufhorchen.
Auch sein jüngstes Werk, eine wohlkomponierte Sammlung von Essays fügt sich zu dem treffenden Titel "Anatomie der Ratlosigkeit". Der Zusatz "Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung" will anzeigen, dass unsere moderne Welt längst gezwungen ist, sich nicht nur am Gütermarkt mit der übrigen Welt zu messen.
In einer Welt, die von Information überquillt und an Interpretationsnot leidet, muss man auch im Kulturellen dialogfähig werden. Es ist nicht ausgemacht, dass der Westen das Maß aller Dinge bleibt; er ist vorerst eine "Lokalkultur", die sich mit ihrer anders gewachsenen Umwelt austauschen muss.
Eine Interpretationsnot, die fehlenden Hinweisschilder auf den "Datenautobahnen", führen in eine grassierende Ratlosigkeit angesichts drängender Fragen. Die Quellen der Ratlosigkeit sind an Raum, Kultur und Entwicklungsstand gebunden. Wir stehen der Menschheit nicht unmittelbar gegenüber, sondern vielfältigen Lokalkulturen, die eine eigene Geschichte, eigene Probleme und vor allem ihre eigenen Blindheiten gegenüber ihren Problemen mitbringen.
So wird der Versuch, Erfolgsgeschichten einer Weltregion in eine andere zu verpflanzen, nur scheitern. Der Transfer von Wissen, von sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Brücke zu anderen Welten und auch zur "Anatomie der Ratlosigkeit" in der eigenen. Doch sehen wir bei Atteslander nach, womit wir uns einem Verständnis globaler Konflikte nähern könnten.
Anstatt sich im Modischen umzusehen, greift der Autor lieber zu einem klassischen Konzept und spricht von einer Anomie, die zu erkennen und zu bewältigen sei. Der Ausdruck wurde vor hundert Jahren vom französischen Soziologen Emil Durkheim geprägt und bezeichnet ein Stadium der Regellosigkeit, des Durcheinanders von Hierarchien und Prioritäten im Zuge rasanter Modernisierung:
"Anomie war und ist gleichsam die Schattenseite der Modernisierung. Eine morbide Unruhe entlädt sich in Rastlosigkeit. Sie wird zu einem Merkmal anomischer Zustände und zugleich eine Begründung für die daraus folgende Ratlosigkeit. Anomie ist demnach in erster Linie ein gesellschaftlicher Zustand, in dem Regellosigkeit zur Regel wird. Sie ist auch als Ungewissheit hinsichtlich moralischer Orientierung zu verstehen."
Anomie verbindet sich mit Umbruchphasen. Wie vor hundert Jahren stehen wir heute wieder vor Umbrüchen und Verwerfungen von globalem Ausmaß, wissen aber nicht mehr weiter mit unseren Fragen, wie es vergleichsweise Bismarck, Stresemann und Adenauer mit den ihren noch wussten.
Ist es ein Ziel, die Lebenserwartung immer höher zu treiben, ohne uns um die Lebensqualität der "gewonnen Jahre" zu kümmern? Was sollen die Proteste gegen ein Arbeitsleben bis 67, wenn die Lebenserwartung gegen achtzig Jahre steigt? Wie stehen wir zur alterslastigen Bevölkerungspyramide? Wird sie zum Schicksal der heranwachsenden Jugend? Denken wir ernsthaft über die Funktionsfähigkeit der Sozialsysteme nach? Machen wir uns genügend klar, dass unsere moderne Welt ein Übergewicht des Staates über die Familie herangezüchtet hat, während in der übrigen Welt das Umgekehrte der Fall ist? Was bedeutet das für die Integration der Einwanderer von außerhalb Europas?
Es gab zu allen Zeiten Ratlosigkeit; doch der gegenwärtige Wandel bringt mit sich, dass sie sich über die Gesellschaft hin ausbreitet und in die Entscheidungskörper eindringt. Immer mehr Entscheidungen müssen gefällt werden, für die es keine entlastenden Vorbilder und Beispiele gibt. Wir haben ein Ratlosigkeitskontinuum, das vom Einzelnen bis in die höchsten Gremien eines überforderten Staatswesens reicht.
Wir merken, wie wir mit unseren Problemen in einer gespaltenen Welt an den jeweils anderen Teil stoßen, so wie sich dieser an unserer Welt reibt: Die Schere zwischen Reich und Arm ist zugleich eine zwischen Zeitarmut in der wohlhabenden Welt und Zeitreichtum in armen Regionen. Doch die erstere bestimmt den Takt. Atteslander sagt in einem spannenden Abschnitt "Vom Umgang mit der Zeit", dass die globale Zeit über Informationsnetzwerke den Erdball wie eine Krake im Griff hält. Viele Lokalkulturen im Süden werden ihr nicht folgen können.
Der Informationsfluss im Westen hat keine Filter gegen Sinnloses und Schädliches; in der armen Welt fehlen die Kapazitäten, um sinnvoll Erdachtes umzusetzen. Die vorerst folgenreichste Disparität liegt im Aufeinanderprallen von Gesellschaftsformen, wovon die wohlhabende rasant altert, während in den armen Gesellschaften die Kinder und Jugendlichen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Es ist nicht verwunderlich, wenn sich daraus Wanderströme ergießen.
Ein Weg aus der Ratlosigkeit liegt darin, aus einer Informationsflut relevantes Wissen zu filtern und dieses dann in zwei Wissensformen zu teilen: in ein Wissen zur Verfügung und ein Wissen zur Orientierung:
"Verfügungswissen gibt Aufschluss darüber, wie etwas getan wird, wie etwas effizienter hergestellt, verwaltet oder genutzt wird, während Orientierungswissen die Frage nach dem Wozu und Warum, nach dem Sinn dieser Verrichtungen beantwortet. Die Frage nach dem Wie ist eine Frage des Rechnens, Kontrollierens und Messens. (…) Orientierungswissen indes ruft nach moralischen Maßstäben und (…) sollte den Gefühlen, Erwartungen und Sehnsüchten entsprechen. Mangel an Orientierungswissen bedeutet auch Mangel an moralischen Regeln"
Mit mehr Orientierungswissen wäre schon eines gewonnen: den Stand der Anomie besser einzuschätzen, ihn als Prozess zu betrachten, der die Chance zur besseren Ordnung und zum höheren Organisationsprinzip von Gesellschaft in sich trägt.
Doch neben der heilsamen Anomie finden wir im Süden die katastrophale, die in Bürgerkrieg und Genozid versinkt und mit "zerfallendem Staat" bezeichnet wird. Dort löst der Vergleich mit der Macht und Lebensform des Westens bei bestimmten Jugendlichen Identitätsprobleme und Neigung zum Terrorismus aus:
"Die Quelle des heutigen Terrorismus (…) liegt vor allem in wirtschaftlichen Faktoren und wird wesentlich gestützt durch eine gefühlsmäßige Ablehnung der modernen Welt. Der neue Terror ist nach seinem Selbstverständnis Kampf dem Gift, das in den Laboratorien der Aufklärung gekocht wurde und die Welt überzieht. Paradox dabei ist, dass Terroristen den Machbarkeitswahn der Moderne selbst für ihre Taten usurpieren."
Anomischen Prozessen, die sich als Ratlosigkeit breit machen, ist am besten - so der Autor - mit sozialem Kapital zu begegnen, wofür Trümmerfrauen und Wasserträgerinnen das Musterbild abgeben.
Der Autor besticht mit flüssiger Prosa und punktgenauer Argumentation. Doch er seziert nicht nur als Anatom. Seine leserfreundlichste Tat ist, in einem Schlusskapitel "Strategien gegen Ratlosigkeit" eindrucksvoll darzulegen.
Peter Atteslander: Anatomie der Ratlosigkeit – Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung
Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2007
Auch sein jüngstes Werk, eine wohlkomponierte Sammlung von Essays fügt sich zu dem treffenden Titel "Anatomie der Ratlosigkeit". Der Zusatz "Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung" will anzeigen, dass unsere moderne Welt längst gezwungen ist, sich nicht nur am Gütermarkt mit der übrigen Welt zu messen.
In einer Welt, die von Information überquillt und an Interpretationsnot leidet, muss man auch im Kulturellen dialogfähig werden. Es ist nicht ausgemacht, dass der Westen das Maß aller Dinge bleibt; er ist vorerst eine "Lokalkultur", die sich mit ihrer anders gewachsenen Umwelt austauschen muss.
Eine Interpretationsnot, die fehlenden Hinweisschilder auf den "Datenautobahnen", führen in eine grassierende Ratlosigkeit angesichts drängender Fragen. Die Quellen der Ratlosigkeit sind an Raum, Kultur und Entwicklungsstand gebunden. Wir stehen der Menschheit nicht unmittelbar gegenüber, sondern vielfältigen Lokalkulturen, die eine eigene Geschichte, eigene Probleme und vor allem ihre eigenen Blindheiten gegenüber ihren Problemen mitbringen.
So wird der Versuch, Erfolgsgeschichten einer Weltregion in eine andere zu verpflanzen, nur scheitern. Der Transfer von Wissen, von sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Brücke zu anderen Welten und auch zur "Anatomie der Ratlosigkeit" in der eigenen. Doch sehen wir bei Atteslander nach, womit wir uns einem Verständnis globaler Konflikte nähern könnten.
Anstatt sich im Modischen umzusehen, greift der Autor lieber zu einem klassischen Konzept und spricht von einer Anomie, die zu erkennen und zu bewältigen sei. Der Ausdruck wurde vor hundert Jahren vom französischen Soziologen Emil Durkheim geprägt und bezeichnet ein Stadium der Regellosigkeit, des Durcheinanders von Hierarchien und Prioritäten im Zuge rasanter Modernisierung:
"Anomie war und ist gleichsam die Schattenseite der Modernisierung. Eine morbide Unruhe entlädt sich in Rastlosigkeit. Sie wird zu einem Merkmal anomischer Zustände und zugleich eine Begründung für die daraus folgende Ratlosigkeit. Anomie ist demnach in erster Linie ein gesellschaftlicher Zustand, in dem Regellosigkeit zur Regel wird. Sie ist auch als Ungewissheit hinsichtlich moralischer Orientierung zu verstehen."
Anomie verbindet sich mit Umbruchphasen. Wie vor hundert Jahren stehen wir heute wieder vor Umbrüchen und Verwerfungen von globalem Ausmaß, wissen aber nicht mehr weiter mit unseren Fragen, wie es vergleichsweise Bismarck, Stresemann und Adenauer mit den ihren noch wussten.
Ist es ein Ziel, die Lebenserwartung immer höher zu treiben, ohne uns um die Lebensqualität der "gewonnen Jahre" zu kümmern? Was sollen die Proteste gegen ein Arbeitsleben bis 67, wenn die Lebenserwartung gegen achtzig Jahre steigt? Wie stehen wir zur alterslastigen Bevölkerungspyramide? Wird sie zum Schicksal der heranwachsenden Jugend? Denken wir ernsthaft über die Funktionsfähigkeit der Sozialsysteme nach? Machen wir uns genügend klar, dass unsere moderne Welt ein Übergewicht des Staates über die Familie herangezüchtet hat, während in der übrigen Welt das Umgekehrte der Fall ist? Was bedeutet das für die Integration der Einwanderer von außerhalb Europas?
Es gab zu allen Zeiten Ratlosigkeit; doch der gegenwärtige Wandel bringt mit sich, dass sie sich über die Gesellschaft hin ausbreitet und in die Entscheidungskörper eindringt. Immer mehr Entscheidungen müssen gefällt werden, für die es keine entlastenden Vorbilder und Beispiele gibt. Wir haben ein Ratlosigkeitskontinuum, das vom Einzelnen bis in die höchsten Gremien eines überforderten Staatswesens reicht.
Wir merken, wie wir mit unseren Problemen in einer gespaltenen Welt an den jeweils anderen Teil stoßen, so wie sich dieser an unserer Welt reibt: Die Schere zwischen Reich und Arm ist zugleich eine zwischen Zeitarmut in der wohlhabenden Welt und Zeitreichtum in armen Regionen. Doch die erstere bestimmt den Takt. Atteslander sagt in einem spannenden Abschnitt "Vom Umgang mit der Zeit", dass die globale Zeit über Informationsnetzwerke den Erdball wie eine Krake im Griff hält. Viele Lokalkulturen im Süden werden ihr nicht folgen können.
Der Informationsfluss im Westen hat keine Filter gegen Sinnloses und Schädliches; in der armen Welt fehlen die Kapazitäten, um sinnvoll Erdachtes umzusetzen. Die vorerst folgenreichste Disparität liegt im Aufeinanderprallen von Gesellschaftsformen, wovon die wohlhabende rasant altert, während in den armen Gesellschaften die Kinder und Jugendlichen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Es ist nicht verwunderlich, wenn sich daraus Wanderströme ergießen.
Ein Weg aus der Ratlosigkeit liegt darin, aus einer Informationsflut relevantes Wissen zu filtern und dieses dann in zwei Wissensformen zu teilen: in ein Wissen zur Verfügung und ein Wissen zur Orientierung:
"Verfügungswissen gibt Aufschluss darüber, wie etwas getan wird, wie etwas effizienter hergestellt, verwaltet oder genutzt wird, während Orientierungswissen die Frage nach dem Wozu und Warum, nach dem Sinn dieser Verrichtungen beantwortet. Die Frage nach dem Wie ist eine Frage des Rechnens, Kontrollierens und Messens. (…) Orientierungswissen indes ruft nach moralischen Maßstäben und (…) sollte den Gefühlen, Erwartungen und Sehnsüchten entsprechen. Mangel an Orientierungswissen bedeutet auch Mangel an moralischen Regeln"
Mit mehr Orientierungswissen wäre schon eines gewonnen: den Stand der Anomie besser einzuschätzen, ihn als Prozess zu betrachten, der die Chance zur besseren Ordnung und zum höheren Organisationsprinzip von Gesellschaft in sich trägt.
Doch neben der heilsamen Anomie finden wir im Süden die katastrophale, die in Bürgerkrieg und Genozid versinkt und mit "zerfallendem Staat" bezeichnet wird. Dort löst der Vergleich mit der Macht und Lebensform des Westens bei bestimmten Jugendlichen Identitätsprobleme und Neigung zum Terrorismus aus:
"Die Quelle des heutigen Terrorismus (…) liegt vor allem in wirtschaftlichen Faktoren und wird wesentlich gestützt durch eine gefühlsmäßige Ablehnung der modernen Welt. Der neue Terror ist nach seinem Selbstverständnis Kampf dem Gift, das in den Laboratorien der Aufklärung gekocht wurde und die Welt überzieht. Paradox dabei ist, dass Terroristen den Machbarkeitswahn der Moderne selbst für ihre Taten usurpieren."
Anomischen Prozessen, die sich als Ratlosigkeit breit machen, ist am besten - so der Autor - mit sozialem Kapital zu begegnen, wofür Trümmerfrauen und Wasserträgerinnen das Musterbild abgeben.
Der Autor besticht mit flüssiger Prosa und punktgenauer Argumentation. Doch er seziert nicht nur als Anatom. Seine leserfreundlichste Tat ist, in einem Schlusskapitel "Strategien gegen Ratlosigkeit" eindrucksvoll darzulegen.
Peter Atteslander: Anatomie der Ratlosigkeit – Kulturkonflikte im Schatten der Globalisierung
Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2007
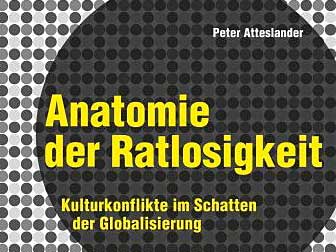
Peter Atteslander: Anatomie der Ratlosigkeit© Verlag Neue Zürcher Zeitung
