Ein Fixpunkt unter den Dichtern und Denkern
"Wo ich bin, ist deutsche Kultur", lautet ein Ausspruch des Schriftstellers Thomas Mann. Und obwohl er den Gegensatz zwischen dem Politischen und Kulturellen stets betonte, ließen ihn die deutsche Geschichte und ihre Abgründe nie los, wie Philipp Gut in seinem Werk "Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur" betont.
Wer etwas wissen will über Thomas Mann und die deutsche Kultur, liest am besten erst einmal den Roman "Doktor Faustus". Ich war 21, als ich das tat, und kam mein Leben lang nicht mehr davon los.
Der Faustroman erzählte mir, wer ich war als Deutscher. Er ließ mir den Kriegsrausch von 1914 nachvollziehbar erscheinen. Er schilderte die berückende Tiefe und die bestürzende Tragik der deutschen Innerlichkeit. Er führte die politische Blindheit der Deutschen unter Hitler auf ihre Musikalität zurück. Er erschloss mir am Beispiel der Musikgeschichte die deutsche Geistesgeschichte. Die Musik als die wortloseste und politikfernste der Künste war hier der Inbegriff der Kultur.
Philipp Gut hat die Hintergründe zu diesem Leseerlebnis entfaltet, in einer voluminösen Studie, die im S. Fischer Verlag erschienen ist - im gleichen Verlag, in dem auch seit 2000 die "Große kommentierte Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns" erscheint, von der Philipp Gut - zu seinem Schaden übrigens, denn er hätte viel dort finden können - keine Kenntnis genommen hat. In seiner Bilanz führt er aus:
"Thomas Mann setzte sich wie kaum ein anderer Schriftsteller von Rang mit der Geschichte seiner Zeit auseinander. Er war zur Politik nicht berufen, seine Leidenschaft war die deutsche Kultur; aber gerade sie hat ihn zu Einsichten in den geschichtsträchtigen Zusammenhang von Ästhetik und Politik in Deutschland geführt, die zum Subtilsten gehören, was diesbezüglich gedacht worden ist.
Dass das Volk der Dichter und Denker zu einem Volk der Richter und Henker wurde, begriff Mann als Zentralproblem, mit dem er sich nicht nur in unzähligen Reden und Essays, auf Kundgebungen und in Radioansprachen befasste, sondern auch in seinen belletristischen Hauptwerken, am eingehendsten im Doktor Faustus."
Dass Thomas Mann 1914 den deutschen Krieg aus dem Geist der Musik verteidigte und dass er im "Doktor Faustus" die deutsche Musik in die Vorgeschichte des Dritten Reiches stellte, das sind bis heute Steine des Anstoßes. Kultur sei das Gegenteil von Politik, konstatierte Thomas Mann im Ersten Weltkrieg, denn Kultur ist nur, was von Zwecken frei ist und keiner Partei dient. Er meint, Deutschland verteidige seine Seele in diesem Krieg. Er definiert in den "Betrachtungen eines Unpolitischen":
"Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur."
Innere Kultur anstelle von nur angelernter Zivilisiertheit, Seele statt Gesellschaft - also vertikale Tiefe anstelle horizontaler Vernetzung, metaphysische anstelle von sozialen Werten -, Freiheit statt Stimmrecht - also innere Souveränität statt pseudodemokratischer Äußerlichkeiten: Alles sinnvoll, aber nicht darum drehte sich der wirkliche Krieg.
Philipp Gut zeigt, wie die schönen Ideale missbraucht wurden von der herrschenden Macht, und wie Thomas Mann später den Missbrauch erkannte, wie er sich in den Jahren der Weimarer Republik immer mehr politisierte, wie er zum sichtbarsten Kritiker Hitlers wurde, wie es ihn 1933 die Heimat kostete, wie er danach am Kalten Krieg litt und 1952 eine pessimistische Summe zog:
Thomas Mann: "Unleugbar hat ja das politische Moralisieren eines Künstlers etwas Komisches, und die Propagierung humanitärer Ideale bringt ihn fast unweigerlich in die Nähe […] der Platitüde. […] es steht leise fragwürdig um meine Haltung, um alles, was Optimismus, Demokratismus, Humanitarismus, Menschheitsgläubigkeit an ihr ist - und sogar um meine 'World Citizenship'. Denn meine Bücher sind verzweifelt deutsch, und was je an Einmischung in gesellschaftlich-politische Fragen darin vorkam, war nicht nur natürlicher Bescheidenheit abzugewinnen, sondern auch dem Pessimismus eines durch Schopenhauers Schule gegangenen Geistes, der zur generös-humanitären Gestik im Grunde wenig geschickt ist. "
Philipp Gut schreibt nicht so elegant wie Thomas Mann, aber er zeigt überzeugend die Kontinuität, die allen politischen Wandlungsprozessen zugrunde liegt. Durch all das abenteuerliche Auf und Ab dieses Lebens blieb tief innen der unpolitische Kulturbegriff intakt.
"Wo ich bin, ist die deutsche Kultur", sagte Thomas Mann, als er 1938 amerikanischen Boden betrat. Nicht dort, wo KZ-Chefs Mozart hörten. Thomas Mann hat sein Deutschland mitgenommen und er hat gezeigt, dass auch aus einem unpolitischen Kulturbegriff wirksamer Widerstand erwachsen kann.
Philipp Gut: Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2008
Der Faustroman erzählte mir, wer ich war als Deutscher. Er ließ mir den Kriegsrausch von 1914 nachvollziehbar erscheinen. Er schilderte die berückende Tiefe und die bestürzende Tragik der deutschen Innerlichkeit. Er führte die politische Blindheit der Deutschen unter Hitler auf ihre Musikalität zurück. Er erschloss mir am Beispiel der Musikgeschichte die deutsche Geistesgeschichte. Die Musik als die wortloseste und politikfernste der Künste war hier der Inbegriff der Kultur.
Philipp Gut hat die Hintergründe zu diesem Leseerlebnis entfaltet, in einer voluminösen Studie, die im S. Fischer Verlag erschienen ist - im gleichen Verlag, in dem auch seit 2000 die "Große kommentierte Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns" erscheint, von der Philipp Gut - zu seinem Schaden übrigens, denn er hätte viel dort finden können - keine Kenntnis genommen hat. In seiner Bilanz führt er aus:
"Thomas Mann setzte sich wie kaum ein anderer Schriftsteller von Rang mit der Geschichte seiner Zeit auseinander. Er war zur Politik nicht berufen, seine Leidenschaft war die deutsche Kultur; aber gerade sie hat ihn zu Einsichten in den geschichtsträchtigen Zusammenhang von Ästhetik und Politik in Deutschland geführt, die zum Subtilsten gehören, was diesbezüglich gedacht worden ist.
Dass das Volk der Dichter und Denker zu einem Volk der Richter und Henker wurde, begriff Mann als Zentralproblem, mit dem er sich nicht nur in unzähligen Reden und Essays, auf Kundgebungen und in Radioansprachen befasste, sondern auch in seinen belletristischen Hauptwerken, am eingehendsten im Doktor Faustus."
Dass Thomas Mann 1914 den deutschen Krieg aus dem Geist der Musik verteidigte und dass er im "Doktor Faustus" die deutsche Musik in die Vorgeschichte des Dritten Reiches stellte, das sind bis heute Steine des Anstoßes. Kultur sei das Gegenteil von Politik, konstatierte Thomas Mann im Ersten Weltkrieg, denn Kultur ist nur, was von Zwecken frei ist und keiner Partei dient. Er meint, Deutschland verteidige seine Seele in diesem Krieg. Er definiert in den "Betrachtungen eines Unpolitischen":
"Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur."
Innere Kultur anstelle von nur angelernter Zivilisiertheit, Seele statt Gesellschaft - also vertikale Tiefe anstelle horizontaler Vernetzung, metaphysische anstelle von sozialen Werten -, Freiheit statt Stimmrecht - also innere Souveränität statt pseudodemokratischer Äußerlichkeiten: Alles sinnvoll, aber nicht darum drehte sich der wirkliche Krieg.
Philipp Gut zeigt, wie die schönen Ideale missbraucht wurden von der herrschenden Macht, und wie Thomas Mann später den Missbrauch erkannte, wie er sich in den Jahren der Weimarer Republik immer mehr politisierte, wie er zum sichtbarsten Kritiker Hitlers wurde, wie es ihn 1933 die Heimat kostete, wie er danach am Kalten Krieg litt und 1952 eine pessimistische Summe zog:
Thomas Mann: "Unleugbar hat ja das politische Moralisieren eines Künstlers etwas Komisches, und die Propagierung humanitärer Ideale bringt ihn fast unweigerlich in die Nähe […] der Platitüde. […] es steht leise fragwürdig um meine Haltung, um alles, was Optimismus, Demokratismus, Humanitarismus, Menschheitsgläubigkeit an ihr ist - und sogar um meine 'World Citizenship'. Denn meine Bücher sind verzweifelt deutsch, und was je an Einmischung in gesellschaftlich-politische Fragen darin vorkam, war nicht nur natürlicher Bescheidenheit abzugewinnen, sondern auch dem Pessimismus eines durch Schopenhauers Schule gegangenen Geistes, der zur generös-humanitären Gestik im Grunde wenig geschickt ist. "
Philipp Gut schreibt nicht so elegant wie Thomas Mann, aber er zeigt überzeugend die Kontinuität, die allen politischen Wandlungsprozessen zugrunde liegt. Durch all das abenteuerliche Auf und Ab dieses Lebens blieb tief innen der unpolitische Kulturbegriff intakt.
"Wo ich bin, ist die deutsche Kultur", sagte Thomas Mann, als er 1938 amerikanischen Boden betrat. Nicht dort, wo KZ-Chefs Mozart hörten. Thomas Mann hat sein Deutschland mitgenommen und er hat gezeigt, dass auch aus einem unpolitischen Kulturbegriff wirksamer Widerstand erwachsen kann.
Philipp Gut: Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2008
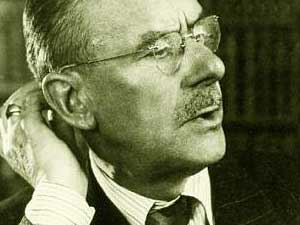
Philipp Gut: Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur© S. Fischer Verlag
