Die USA auf dem falschen Pfad
Der amerikanische Politologe Bacevich beschreibt die Grenzen der amerikanischen Macht – und malt ein düsteres Bild von der Zukunft der westlichen Führungsmacht. Ein Grund für den Niedergang sieht er in der Verschwendung.
Die heikelste Frage muss gleich zu Beginn beantwortet werden: Lohnt es sich eigentlich, ein Buch über die amerikanische Außenpolitik zu lesen, das vor der Wahl Barack Obamas zum neuen US-Präsidenten geschrieben worden ist? Schließlich wird Obamas Amtsantritt als Zeitenwende in der US-Politik beschrieben, für die der Mann im Weißen Haus sogar bereits einen Nobelpreis erhalten hat.
Das Buch des amerikanischen Politologen Andrew Bacevich ist auf jeden Fall eine lohnende Lektüre. Zwar hat sich dieser dabei sichtlich von den acht Jahren der Bush-Regierung und den Kriegen im Irak und in Afghanistan prägen lassen. Bacevich stimmt dabei ein in den Chor derer, die die Hybris eines selbstempfundenen "Empires" scharf kritisieren. Das an sich wäre im Obama-Zeitalter nicht besonders originell. Aber das Buch hat in den USA dennoch für Aufregung gesorgt.
Das liegt an Thesen, die sehr stark am amerikanischen Selbstverständnis kratzen - und zudem an einer sehr düsteren Prognose für die Entwicklung der Supermacht. Dafür zitiert Bacevich sein großes Vorbild, den amerikanischen Theologen Reinhard Niebuhr:
"Am Ende der Geschichte werden Gesellschaftsordnungen sich wahrscheinlich selbst zerstören, in dem Bestreben, ihre Unzerstörbarkeit zu beweisen."
Aus Sicht des 62-jährigen Bacevich befinden sich die USA seit Jahrzehnten auf dem falschen Pfad. Dafür sieht er drei Hauptgründe – die anhaltende Verschwendungssucht der Amerikaner; ein schlecht funktionierendes politisches System, das dazu führte, dass zunehmend Hardliner die Politik bestimmen konnten; und die fortgesetzte Auswahl unfähiger Generäle in die entscheidenden Positionen. Dabei sortiert der Autor alte Fakten und Zusammenhänge neu. So setzt Bacevich den Höhepunkt amerikanischer Macht nicht etwa in die 90er-Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion an, sondern in den zwei Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Immerhin verfügten die USA 1945 über mehr als 50 Prozent der gesamten weltweiten industriellen Produktion. Amerika war in der Nachkriegszeit auch wegen des wachsenden Wohlstands seiner Bevölkerung ein weltweites Vorbild. Der von Ökonomen gefeierte Boom der 80er-Jahre und die lange Wachstumsphase bis 2008 sind für Bacevich dagegen nur Schimären. Denn beide Entwicklungen wurden mit einer horrenden Verschuldung erkauft. Die Stärke der Supermacht sinkt seiner Meinung nach bereits seit dem Vietnamkrieg, weil dort erstmals erhebliche finanzielle und militärische Mittel eingesetzt wurden, die in keinem Verhältnis mehr zur Wohlstandsvermehrung in den USA standen.
Besonders umstritten ist seine Begründung, dass der amerikanische "Way of live" die Basis für eine falsche Ausrichtung und eine fortgesetzt expansionistische Sicherheitspolitik war und ist. Die wertebezogene Begründung der amerikanischen Außenpolitik, die auch Außenministerin Hillary Clinton anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalls wieder betont hatte, hält Bacevich für vorgeschoben. Begriffe wie "Freiheit" und "Demokratie" kaschieren für ihn nur die wahren Interessen, die auf politische und militärische Dominanz zielen. In große Kriege seien die USA nie gezogen, um Völker zu befreien, sondern um elementare Interessen zu befriedigen – wozu der Durst nach Waren und Rohstoffen gehörte.
In aller Härte rechnet er dabei mit früheren sicherheitspolitischen Regierungsstrategen wie Paul Nitze in den 50er-Jahren und Paul Wolfowitz in der Bush-Zeit ab. Diesen wirft er vor, der amerikanischen Außenpolitik das ideologische Rüstzeug für eine ungebremste Militärpolitik geliefert zu haben. Sie hätten die Ansicht durchgesetzt, dass die USA nur durch absolute Dominanz in der Welt Sicherheit erwerben können. Ein völlig aufgeblähter Militärapparat und die auch von der Obama-Regierung verfolgte Vorstellung eines unbefristeten globalen Krieges gegen den Terror sind die Folge.
Teilweise ist die Kritik überzogen und schlicht unfair. Doch der düstere Blick auf die US-Geschichte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bacevich kein linker Pazifist ist. Der Absolvent der Militärschmiede West Point und Vietnam-Kämpfer argumentiert vielmehr aus einer Position heraus, die durchaus die Notwendigkeit Amerikas sieht, Werte zu verteidigen – und sehr kritisch auf die sinkende Bereitschaft seiner Landsleute blickt, sich überhaupt noch für das eigene Land zu engagieren. Die einen kämpfen, die anderen shoppen.
Dankenswerterweise bricht Bacevich dabei mit der in den USA vorherrschenden Lager-Argumentation, in der Konservative und Demokraten wechselseitig und vorhersehbar aufeinander einprügeln. Auch er zieht zwar hart mit der Außenpolitik etwa von Bush oder Ronald Reagan ins Gericht. Aber letztlich wirft er einer langen Kette von US-Präsidenten vor, darunter auch Bill Clinton, die eigenen Ideale verraten und eine Politik verhängnisvoller Militärinterventionen betrieben zu haben.
Besonders nachdenkenswert ist dabei die erwähnte These, dass sich ein erheblicher Teil der amerikanischen Außenpolitik durch den ungebremsten Drang der amerikanischen Gesellschaft nach Konsum erklärt.
"Ob es um Erdöl, Kredit oder die Verfügbarkeit billiger Konsumgüter geht – wir erwarten, dass die Welt dem American way of life entgegenkommt."
Nimmt man die Bedürfnisse des "Imperiums des Konsums" zum Dreh- und Angel-Punkte der Analyse, wird auch das sehr unterschiedliche historische Image von Präsidenten erklärlicher. So begründet Bacevich das Scheitern des US-Präsidenten Jimmy Carter auch mit dessen Maßhalte-Rede im Jahr 1979.
Für europäische Leser wirkt fast visionär, was Carter damals etwa zum Thema Energieabhängigkeit und zum nötigen Klimaschutz gesagt hatte. Aber die Amerikaner wollten in der Krise keine Appelle zum Maßhalten hören, sondern wählten lieber den Republikaner Ronald Reagan, der ihnen genau das versprach, was sie hören wollten – ungebremstes Wachstum und wachsenden Wohlstand. Bis heute hat es dem Image Reagans nicht geschadet, dass er den USA eine gigantische Verschuldung beschert hat und er die Supermacht an ein Leben auf Pump gewöhnte.
Selten ist auf wenigen Seiten zudem so klar ein entscheidender Kontrast zwischen den Kriegspräsidenten Theodor Roosevelt und George W. Bush herausgearbeitet worden. Im Zweiten Weltkrieg hatte Roosevelt die Amerikaner aufgefordert, sich wegen des Krieges aus nationalen Gründen auch im privaten Leben einzuschränken. Doch im Krieg gegen den Terror, der in Irak und Afghanistan mittlerweile ebenfalls gigantische Summen verschluckt hat, galt eine andere Philosophie. Angesichts des Konsumeinbruchs der verunsicherten Amerikaner nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 bezeichnete es die Regierung als nationale Bürgerpflicht, sich gerade nicht einzuschränken. Bacevich zitiert George Bush mit dem markanten Satz:
"Ich fordere Sie alle auf, noch mehr einkaufen zu gehen."
Schade nur, dass Bacevich an einigen Punkten übers Ziel hinausschießt. Grautöne kennt er kaum, wenn er einen angeblich in Gänze korrupten Senat und eine über Jahrzehnte unfähige Militärführung kritisiert – wozu nicht unbedingt passt, dass er dann in einem eigens hinzugefügten Nachwort doch lobende Worte über Obama verliert.
Und er begeht den klassischen Fehler, Denkern ein zu großes Gewicht bei der Ausformung der Politik beizumessen. In Wahrheit agierten die Sicherheitsberater Nitze und Wolfowitz nicht im luftleeren Raum. Der erste versuchte eine US-Strategie zu entwickeln, die auf die Herausforderungen des bedrohlich wirkenden Kalten Krieges einging. Der letzte lieferte ein zwar katastrophal falsches, aber durchaus verständliches Konzept für die Definition amerikanischer Interessen. Sie war geprägt von der tatsächlichen Vormachtstellung der USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Das soll den Wert des Buches von Bacevich nicht schmälern. Sein Langzeitblick liefert eine gedankliche Immunisierung gegen jede Form von Ideologie. Und sein eingefordertes Nachdenken, ob das Grundproblem nicht vielleicht im Konzept des American "Way of Life" liegt, trifft ins Mark. Provokant ist zudem sein Hinweis, dass es oft eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten und den Wünschen der Bevölkerung und einer bestimmten Politik gibt. Die Amerikaner bekommen den Präsidenten, den sie verdienen.
Bacevich schiebt seinen Landsleuten also eine Art Kollektivschuld und eine Mitverantwortung für den "Niedergang des Empires" zu. Kein Wunder, dass ihn dies in seiner Heimat nicht gerade populär macht.
Das Buch des amerikanischen Politologen Andrew Bacevich ist auf jeden Fall eine lohnende Lektüre. Zwar hat sich dieser dabei sichtlich von den acht Jahren der Bush-Regierung und den Kriegen im Irak und in Afghanistan prägen lassen. Bacevich stimmt dabei ein in den Chor derer, die die Hybris eines selbstempfundenen "Empires" scharf kritisieren. Das an sich wäre im Obama-Zeitalter nicht besonders originell. Aber das Buch hat in den USA dennoch für Aufregung gesorgt.
Das liegt an Thesen, die sehr stark am amerikanischen Selbstverständnis kratzen - und zudem an einer sehr düsteren Prognose für die Entwicklung der Supermacht. Dafür zitiert Bacevich sein großes Vorbild, den amerikanischen Theologen Reinhard Niebuhr:
"Am Ende der Geschichte werden Gesellschaftsordnungen sich wahrscheinlich selbst zerstören, in dem Bestreben, ihre Unzerstörbarkeit zu beweisen."
Aus Sicht des 62-jährigen Bacevich befinden sich die USA seit Jahrzehnten auf dem falschen Pfad. Dafür sieht er drei Hauptgründe – die anhaltende Verschwendungssucht der Amerikaner; ein schlecht funktionierendes politisches System, das dazu führte, dass zunehmend Hardliner die Politik bestimmen konnten; und die fortgesetzte Auswahl unfähiger Generäle in die entscheidenden Positionen. Dabei sortiert der Autor alte Fakten und Zusammenhänge neu. So setzt Bacevich den Höhepunkt amerikanischer Macht nicht etwa in die 90er-Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion an, sondern in den zwei Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Immerhin verfügten die USA 1945 über mehr als 50 Prozent der gesamten weltweiten industriellen Produktion. Amerika war in der Nachkriegszeit auch wegen des wachsenden Wohlstands seiner Bevölkerung ein weltweites Vorbild. Der von Ökonomen gefeierte Boom der 80er-Jahre und die lange Wachstumsphase bis 2008 sind für Bacevich dagegen nur Schimären. Denn beide Entwicklungen wurden mit einer horrenden Verschuldung erkauft. Die Stärke der Supermacht sinkt seiner Meinung nach bereits seit dem Vietnamkrieg, weil dort erstmals erhebliche finanzielle und militärische Mittel eingesetzt wurden, die in keinem Verhältnis mehr zur Wohlstandsvermehrung in den USA standen.
Besonders umstritten ist seine Begründung, dass der amerikanische "Way of live" die Basis für eine falsche Ausrichtung und eine fortgesetzt expansionistische Sicherheitspolitik war und ist. Die wertebezogene Begründung der amerikanischen Außenpolitik, die auch Außenministerin Hillary Clinton anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalls wieder betont hatte, hält Bacevich für vorgeschoben. Begriffe wie "Freiheit" und "Demokratie" kaschieren für ihn nur die wahren Interessen, die auf politische und militärische Dominanz zielen. In große Kriege seien die USA nie gezogen, um Völker zu befreien, sondern um elementare Interessen zu befriedigen – wozu der Durst nach Waren und Rohstoffen gehörte.
In aller Härte rechnet er dabei mit früheren sicherheitspolitischen Regierungsstrategen wie Paul Nitze in den 50er-Jahren und Paul Wolfowitz in der Bush-Zeit ab. Diesen wirft er vor, der amerikanischen Außenpolitik das ideologische Rüstzeug für eine ungebremste Militärpolitik geliefert zu haben. Sie hätten die Ansicht durchgesetzt, dass die USA nur durch absolute Dominanz in der Welt Sicherheit erwerben können. Ein völlig aufgeblähter Militärapparat und die auch von der Obama-Regierung verfolgte Vorstellung eines unbefristeten globalen Krieges gegen den Terror sind die Folge.
Teilweise ist die Kritik überzogen und schlicht unfair. Doch der düstere Blick auf die US-Geschichte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bacevich kein linker Pazifist ist. Der Absolvent der Militärschmiede West Point und Vietnam-Kämpfer argumentiert vielmehr aus einer Position heraus, die durchaus die Notwendigkeit Amerikas sieht, Werte zu verteidigen – und sehr kritisch auf die sinkende Bereitschaft seiner Landsleute blickt, sich überhaupt noch für das eigene Land zu engagieren. Die einen kämpfen, die anderen shoppen.
Dankenswerterweise bricht Bacevich dabei mit der in den USA vorherrschenden Lager-Argumentation, in der Konservative und Demokraten wechselseitig und vorhersehbar aufeinander einprügeln. Auch er zieht zwar hart mit der Außenpolitik etwa von Bush oder Ronald Reagan ins Gericht. Aber letztlich wirft er einer langen Kette von US-Präsidenten vor, darunter auch Bill Clinton, die eigenen Ideale verraten und eine Politik verhängnisvoller Militärinterventionen betrieben zu haben.
Besonders nachdenkenswert ist dabei die erwähnte These, dass sich ein erheblicher Teil der amerikanischen Außenpolitik durch den ungebremsten Drang der amerikanischen Gesellschaft nach Konsum erklärt.
"Ob es um Erdöl, Kredit oder die Verfügbarkeit billiger Konsumgüter geht – wir erwarten, dass die Welt dem American way of life entgegenkommt."
Nimmt man die Bedürfnisse des "Imperiums des Konsums" zum Dreh- und Angel-Punkte der Analyse, wird auch das sehr unterschiedliche historische Image von Präsidenten erklärlicher. So begründet Bacevich das Scheitern des US-Präsidenten Jimmy Carter auch mit dessen Maßhalte-Rede im Jahr 1979.
Für europäische Leser wirkt fast visionär, was Carter damals etwa zum Thema Energieabhängigkeit und zum nötigen Klimaschutz gesagt hatte. Aber die Amerikaner wollten in der Krise keine Appelle zum Maßhalten hören, sondern wählten lieber den Republikaner Ronald Reagan, der ihnen genau das versprach, was sie hören wollten – ungebremstes Wachstum und wachsenden Wohlstand. Bis heute hat es dem Image Reagans nicht geschadet, dass er den USA eine gigantische Verschuldung beschert hat und er die Supermacht an ein Leben auf Pump gewöhnte.
Selten ist auf wenigen Seiten zudem so klar ein entscheidender Kontrast zwischen den Kriegspräsidenten Theodor Roosevelt und George W. Bush herausgearbeitet worden. Im Zweiten Weltkrieg hatte Roosevelt die Amerikaner aufgefordert, sich wegen des Krieges aus nationalen Gründen auch im privaten Leben einzuschränken. Doch im Krieg gegen den Terror, der in Irak und Afghanistan mittlerweile ebenfalls gigantische Summen verschluckt hat, galt eine andere Philosophie. Angesichts des Konsumeinbruchs der verunsicherten Amerikaner nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 bezeichnete es die Regierung als nationale Bürgerpflicht, sich gerade nicht einzuschränken. Bacevich zitiert George Bush mit dem markanten Satz:
"Ich fordere Sie alle auf, noch mehr einkaufen zu gehen."
Schade nur, dass Bacevich an einigen Punkten übers Ziel hinausschießt. Grautöne kennt er kaum, wenn er einen angeblich in Gänze korrupten Senat und eine über Jahrzehnte unfähige Militärführung kritisiert – wozu nicht unbedingt passt, dass er dann in einem eigens hinzugefügten Nachwort doch lobende Worte über Obama verliert.
Und er begeht den klassischen Fehler, Denkern ein zu großes Gewicht bei der Ausformung der Politik beizumessen. In Wahrheit agierten die Sicherheitsberater Nitze und Wolfowitz nicht im luftleeren Raum. Der erste versuchte eine US-Strategie zu entwickeln, die auf die Herausforderungen des bedrohlich wirkenden Kalten Krieges einging. Der letzte lieferte ein zwar katastrophal falsches, aber durchaus verständliches Konzept für die Definition amerikanischer Interessen. Sie war geprägt von der tatsächlichen Vormachtstellung der USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Das soll den Wert des Buches von Bacevich nicht schmälern. Sein Langzeitblick liefert eine gedankliche Immunisierung gegen jede Form von Ideologie. Und sein eingefordertes Nachdenken, ob das Grundproblem nicht vielleicht im Konzept des American "Way of Life" liegt, trifft ins Mark. Provokant ist zudem sein Hinweis, dass es oft eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten und den Wünschen der Bevölkerung und einer bestimmten Politik gibt. Die Amerikaner bekommen den Präsidenten, den sie verdienen.
Bacevich schiebt seinen Landsleuten also eine Art Kollektivschuld und eine Mitverantwortung für den "Niedergang des Empires" zu. Kein Wunder, dass ihn dies in seiner Heimat nicht gerade populär macht.
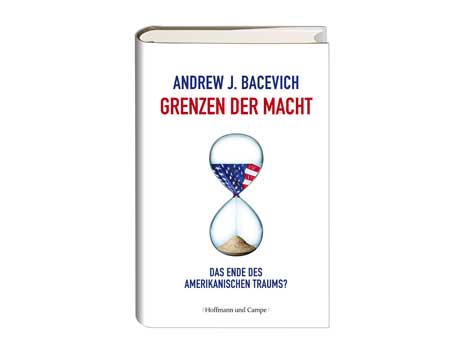
Andrew Bacevich: "Grenzen der Macht"© Hoffmann und Campe
