Die Mitteleuropäer von morgen
Über Jahrhunderte prägten adeliges Landleben und Prager Aristokraten-Eleganz das Leben in Böhmen - bis Nazi-Herrschaft und Kommunismus diese Welt aus den Fugen brachten. Vladimir Votýpka schildert nun, wie die entwurzelten Adeligen allmählich wieder zurückfinden zu ihrer Geschichte und Herkunft.
"Wissen Sie, der böhmische Adel ist ein Bestandteil der tschechischen Nation. Wir sind nicht stolz darauf, dass wir adelig sind, aber dass wir ein Bestandteil dieses Landes sind und dass wir kulturell, wirtschaftlich und politisch an seinem Schicksal Anteil genommen haben. Mein Vater hatte immer wieder gesagt – auch nach 1918, nach der Abschaffung der Titel und der Orden: 'Ich lasse mich nicht verdrängen, ich bin von hier.'"
Das sagte Prinz Franz von Schwarzenberg zu dem tschechischen Journalisten Vladimir Votýpka, der mit seinem Buch über die Rückkehr des böhmischen Adels gerade dieses Selbstverständnis veranschaulichen möchte. Die frühere oder spätere Emigration und die Schikanen der im Lande Gebliebenen während des Kommunismus vermochten daran nichts zu ändern. Wer sich nach 1918 für die tschechoslowakische Republik entschied – wie fast alle Adeligen – und sich zwischen 1938 und 1945 nicht die deutsche Staatsbürgerschaft aufdrängen ließ - ebenfalls die Mehrheit unter den Adeligen – kann seit 1992 die Rückgabe seiner enteigneten Schlösser und Güter beantragen. Von Fall zu Fall, dauert das Verfahren unterschiedlich lang, je nach der Rechtslage und den Launen der Bürokraten.
Immerhin suchen die Tschechen, wenn sie sich mit ihren alten Adel beschäftigen, der ihr Land gegenüber dem österreichischen Kaiser als König der Länder der Wenzelskrone vertrat, wieder einen Anschluss an ihre vollständige Geschichte. Überall erinnern Burgen und Schlösser mit weiträumigen Parkanlagen oder prächtige Grabstätten in Domen und Kirchen an die Jahrhunderte adeligen Landlebens oder Prager aristokratisch geprägter Eleganz.
Der böhmische Adel erinnert aber auch die Tschechen daran, mitten in Europa zu liegen, mit den europäischen Nachbarn eng verflochten zu sein. Neben den Wladiken, dem tschechischen Kleinadel, der zuweilen in höhere Ränge aufstieg, gibt es die Battaglia oder Belcredi, die aus Italien kamen, die Schwarzenberg aus Franken, die Mensdorf-Pouilly, eine deutsch-russisch-lothringische Mischung, oder die Coudenhove-Kalergi, die ursprünglich in Brabant zu Hause waren, Verwandte in Russland besaßen und über die Kalergis mit einer kaiserlich-byzantinischen Dynastie zusammenhängen. Ganz abgesehen von den Kinsky oder den Lobkowitz, einheimischen Grafen und Fürsten, deren katholische Vorfahren 1618 nicht gegen den Kaiser rebellierten und entsprechend reichen Lohn dafür empfingen.
Sie alle - ob sie nun einen italienischen, französischen oder russischen Namen trugen und deutsch redeten wie ihr Kaiser und König - hatten ein böhmisches Herz. Sie waren europäische Böhmen. Karl Eugen Czernin erzählt von seinem Vater:
"Aber als ihn jemand fragte, ob er eher Tscheche, Deutscher oder Österreicher wäre, antwortete er: 'ich bin Österreicher, weil ich Tscheche bin.' Das können wir heute nur mehr schwer verstehen. Heute ist Österreich ein Land, aber in der Vergangenheit war Österreich eine Idee, ein Gedanke, etwas Erdachtes, gewissermaßen ein Zwischenreich, ein Lebensraum für kleinere Nationen in Mittel– und Osteuropa zwischen den riesigen nationalen Blöcken Russland und Deutschland."
Insofern war Böhmen immer ein Land mit zwei Lungenflügeln, einem königlich-böhmischen und einem kaiserlich-österreichischen. Wer jetzt wieder zurückkommt, tut es, wie die meisten beteuern, aus Verantwortung der Familie und Böhmen gegenüber. Die Schlösser sind meist heruntergekommen und verwahrlost. Sie zu erneuern kostet Mühe, verschafft Sorgen und bereitet dennoch Freude, weil die aus Böhmen einst gewaltsam Entwurzelten wieder heim finden zu ihrer Geschichte und Herkunft. Nicht allen fällt es leicht, zu vergessen, was sie erlebten bei Zwangsarbeit in Lagern, Bergwerken oder dass sie genötigt waren als Entrechtete zu emigrieren und sich oft genug unter trostlosen Bedingungen, doch in Freiheit, durchschlagen mussten.
Vladimir Votýpka schildert mit vielen Beispielen, wie eben der Adel sich auch im Elend als ein Stand der Freiheit und unerschütterlichen Selbstbewusstseins bewährte. Manchen von den Älteren fällt es schwer, sich nach Jahrzehnten im Ausland wieder an die tschechische Mentalität zu gewöhnen und ihre neuen Heimaten aufzugeben. Erstaunlicherweise fällt es den Jüngeren leicht, sich in Böhmens Hain und Fluren, in dessen Geschichte und die ihnen fast unbekannte Sprache einzugemeinden und Tschechen zu werden, ohne zu vergessen, auch Kanadier, Amerikaner, Niederländer oder Österreicher gewesen zu sein. Aus ihnen werden offenbar zukünftige Mitteleuropäer, die Böhmen, und Mähren, heute Tschechien, so ganz in sich versunken, dringend braucht.
Vladimir Votýpka: Rückkehr des böhmischen Adels
Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar 2010
Das sagte Prinz Franz von Schwarzenberg zu dem tschechischen Journalisten Vladimir Votýpka, der mit seinem Buch über die Rückkehr des böhmischen Adels gerade dieses Selbstverständnis veranschaulichen möchte. Die frühere oder spätere Emigration und die Schikanen der im Lande Gebliebenen während des Kommunismus vermochten daran nichts zu ändern. Wer sich nach 1918 für die tschechoslowakische Republik entschied – wie fast alle Adeligen – und sich zwischen 1938 und 1945 nicht die deutsche Staatsbürgerschaft aufdrängen ließ - ebenfalls die Mehrheit unter den Adeligen – kann seit 1992 die Rückgabe seiner enteigneten Schlösser und Güter beantragen. Von Fall zu Fall, dauert das Verfahren unterschiedlich lang, je nach der Rechtslage und den Launen der Bürokraten.
Immerhin suchen die Tschechen, wenn sie sich mit ihren alten Adel beschäftigen, der ihr Land gegenüber dem österreichischen Kaiser als König der Länder der Wenzelskrone vertrat, wieder einen Anschluss an ihre vollständige Geschichte. Überall erinnern Burgen und Schlösser mit weiträumigen Parkanlagen oder prächtige Grabstätten in Domen und Kirchen an die Jahrhunderte adeligen Landlebens oder Prager aristokratisch geprägter Eleganz.
Der böhmische Adel erinnert aber auch die Tschechen daran, mitten in Europa zu liegen, mit den europäischen Nachbarn eng verflochten zu sein. Neben den Wladiken, dem tschechischen Kleinadel, der zuweilen in höhere Ränge aufstieg, gibt es die Battaglia oder Belcredi, die aus Italien kamen, die Schwarzenberg aus Franken, die Mensdorf-Pouilly, eine deutsch-russisch-lothringische Mischung, oder die Coudenhove-Kalergi, die ursprünglich in Brabant zu Hause waren, Verwandte in Russland besaßen und über die Kalergis mit einer kaiserlich-byzantinischen Dynastie zusammenhängen. Ganz abgesehen von den Kinsky oder den Lobkowitz, einheimischen Grafen und Fürsten, deren katholische Vorfahren 1618 nicht gegen den Kaiser rebellierten und entsprechend reichen Lohn dafür empfingen.
Sie alle - ob sie nun einen italienischen, französischen oder russischen Namen trugen und deutsch redeten wie ihr Kaiser und König - hatten ein böhmisches Herz. Sie waren europäische Böhmen. Karl Eugen Czernin erzählt von seinem Vater:
"Aber als ihn jemand fragte, ob er eher Tscheche, Deutscher oder Österreicher wäre, antwortete er: 'ich bin Österreicher, weil ich Tscheche bin.' Das können wir heute nur mehr schwer verstehen. Heute ist Österreich ein Land, aber in der Vergangenheit war Österreich eine Idee, ein Gedanke, etwas Erdachtes, gewissermaßen ein Zwischenreich, ein Lebensraum für kleinere Nationen in Mittel– und Osteuropa zwischen den riesigen nationalen Blöcken Russland und Deutschland."
Insofern war Böhmen immer ein Land mit zwei Lungenflügeln, einem königlich-böhmischen und einem kaiserlich-österreichischen. Wer jetzt wieder zurückkommt, tut es, wie die meisten beteuern, aus Verantwortung der Familie und Böhmen gegenüber. Die Schlösser sind meist heruntergekommen und verwahrlost. Sie zu erneuern kostet Mühe, verschafft Sorgen und bereitet dennoch Freude, weil die aus Böhmen einst gewaltsam Entwurzelten wieder heim finden zu ihrer Geschichte und Herkunft. Nicht allen fällt es leicht, zu vergessen, was sie erlebten bei Zwangsarbeit in Lagern, Bergwerken oder dass sie genötigt waren als Entrechtete zu emigrieren und sich oft genug unter trostlosen Bedingungen, doch in Freiheit, durchschlagen mussten.
Vladimir Votýpka schildert mit vielen Beispielen, wie eben der Adel sich auch im Elend als ein Stand der Freiheit und unerschütterlichen Selbstbewusstseins bewährte. Manchen von den Älteren fällt es schwer, sich nach Jahrzehnten im Ausland wieder an die tschechische Mentalität zu gewöhnen und ihre neuen Heimaten aufzugeben. Erstaunlicherweise fällt es den Jüngeren leicht, sich in Böhmens Hain und Fluren, in dessen Geschichte und die ihnen fast unbekannte Sprache einzugemeinden und Tschechen zu werden, ohne zu vergessen, auch Kanadier, Amerikaner, Niederländer oder Österreicher gewesen zu sein. Aus ihnen werden offenbar zukünftige Mitteleuropäer, die Böhmen, und Mähren, heute Tschechien, so ganz in sich versunken, dringend braucht.
Vladimir Votýpka: Rückkehr des böhmischen Adels
Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar 2010
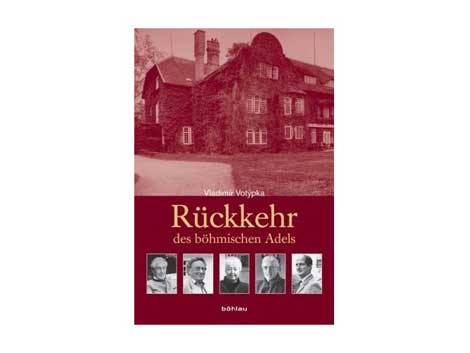
Buchcover: "Rückkehr des böhmischen Adels" von Vladimir Votýpka© Böhlau Verlag
