Die Kultur des Kapitalismus
Die kontroversten Thesen amerikanischen Historikerin Joyce Appleby sind lehrreich und gut erzählt - aber ohne jeglichen Spannungsbogen. Sie wären in kurzen Essays besser aufgehoben gewesen.
Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise hat eine heftige Systemdebatte ausgelöst. Unter der Überschrift "Die Zukunft des Kapitalismus" wurde gefragt, ob der Kapitalismus eine solche überhaupt haben könne, ob er eine Zukunft haben dürfe, ob man ihn nicht vom Kopf auf die Füße stellen müsse und was eigentlich seine Hauptmerkmale seien.
Vor diesem Hintergrund hat der Murmann Verlag Joyce Applebys Geschichte des Kapitalismus unter dem anklagenden Titel "Die unbarmherzige Revolution" herausgebracht. Freilich geht es der amerikanischen Historikerin vor allem um das Phänomen der unablässigen Erneuerung, die mit dem Heraufziehen des Kapitalismus möglich geworden ist. Es geht ihr um die Kultur des Kapitalismus.
Appleby erkennt durchaus die großen Meriten eines Systems an, das Gesellschaften ermöglicht, sich immer wieder neu zu erfinden und zu durchmischen. Dennoch treibt auch sie die üblichen Säue durchs Dorf, von der Krisenanfälligkeit freier Märkte bis hin zu den angeblich vom Kapitalismus verursachten Mentalitätsverkrümmungen.
"… kurzsichtiges Handeln unter Vernachlässigung langfristiger Folgen, Zuteilung von Kompetenzen ohne gleichzeitige Zuweisung von Verantwortung, Bevorzugung materieller gegenüber geistigen Werten, Kommerzialisierung zwischenmenschlicher Beziehungen, Monetarisierung sozialer Werte, Schädigung der Demokratie, Verunsicherung von Gemeinschaften und Institutionen, Gefährdung bestehender Abmachungen, Förderung von Aggressivität und Belohnung von Gier."
Es drängt sich die Gegenfrage auf, ob unfreie Systeme nicht dieselben oder noch weitere Probleme mit sich bringen. Man muss nur nach Kuba blicken oder, gerade als Historiker, auf die Jahrzehnte sozialistischer Experimente im Ostblock. Abgesehen davon wird die alte These vom Moralverzehr des Markts durch Wiederholung nicht besser.
Eine triftige Widerlegung könnte die Autorin schon bei Adam Smith finden, dem berühmten Moralphilosophen der schottischen Aufklärung und Begründer der modernen Ökonomie, der in seiner "Theorie der ethischen Gefühle" die Geburt des gesellschaftlichen Moralkonsenses aus der Interaktion erklärt. Doch Smith scheint nicht gerade ihr Lieblingsautor zu sein.
"Nach Smith bildete sich der Kapitalismus aufgrund der allgemeinen natürlichen Neigung des Menschen aus, Dinge zu tauschen. Stattdessen war die ökonomische Entwicklung selbst eine Bedingung dafür, dass sich diese spezifische, kulturell bedingte Neigung durchsetzen konnte. Smith vertauschte Ursache und Wirkung."
Diese Kritik geht zu weit. Dass Austauschbeziehungen und Arbeitsteilung das Leben prägen, ist eine anthropologische Konstante. Der Mensch lebt in Gemeinschaft, weil er anders nicht überleben kann, auch seine ganze Gattung nicht. Wenn der Mensch in Gemeinschaft lebt, kommuniziert er mit anderen, arrangiert sich mit anderen, nimmt Leistungen in Anspruch und wird selbst in die Pflicht genommen.
Wer den Nachweis führen will, dass der kapitalistische Geist keineswegs zur Grundausstattung des Menschen gehört, wie Appleby schreibt, der kann sich nicht darauf beschränken, einfach das Tauschmotiv zu leugnen. Die Argumentation wird erst in dem Moment schlüssiger, wo der kapitalistische Fortschrittsoptimismus in den Blick gelangt.
Dass man sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann, war in der Tat eine Erkenntnis, die auch im Westen erst im Zuge der Aufklärung populär wurde, im Zuge der Ablösung vom Feudalismus. Andernorts hat dieser Bewusstseinswandel bis heute nicht stattgefunden. Joyce Appleby findet freilich auch am Fortschrittsdenken etwas zu kritisieren.
"Dass kaum jemand sich überrascht zeigt, wenn eine Krise eintritt, verweist auf eine Eigenschaft, die im Kapitalismus kultiviert wird. Gemeint ist eine Art von Optimismus, die die Realität verneint."
Liberale Ökonomen berauschen sich in der Rückschau allzu gern an der vermeintlichen Folgerichtigkeit der Entwicklung zur Marktwirtschaft und wundern sich dann über reale Fehlentwicklungen. Appleby warnt vor dieser deterministischen Versuchung und mahnt, den Blick offen zu halten für die wichtigste Frage: Wie konnte sich die Kultur des Kapitalismus entwickeln? Was waren ihre Voraussetzungen?
Ganz in Marx’scher Tradition sieht sie die Ökonomie in der Führungsrolle: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Historisch hat nach Ansicht der Verfasserin schlicht das günstige Gemisch aus fortschrittlicher Agrartechnik, Recht und politischer Verfassung im England des 17. Jahrhunderts den Boden für die ökonomische Revolution bereitet – mit soziologischen wie ideellen Konsequenzen erst in mittlerer Frist. Die "kapitalistischen Werte" hätten Zeit gebraucht, um sich durchzusetzen.
"Der Kapitalismus trat also mit einer englischen Prägung in die Geschichte ein. Das bedeutete, dass die Marktwirtschaft für diejenigen, deren Muttersprache eine andere als die englische war, ihre Fremdheit nie ganz verlor."
Aber brauchen ökonomische Revolutionen nicht immer auch ein passendes kulturelles Klima? Rätselhaft ist auch, weshalb die Autorin darauf beharrt, dass "die Saat des Kapitalismus nicht im Mittelalter gelegt wurde". Schließlich lässt sich die von ihr betonte einzigartige Rolle Englands gar nicht denken, wenn es damals keinen Schatz an politischen Ideen gegeben hätte, den man hätte nutzen können – etwa dank der päpstlichen Revolution des 11. Jahrhunderts, die das Recht wiederbelebte und der Trennung von Politik und Religion Vorschub leistete.
Insgesamt ist dies ein unhandliches Buch. Die Geschichte des Kapitalismus entfaltet sich auf mehr als 600 Seiten. Das Spektrum reicht von den Hungersnöten in England bis zur Sklavenhaltung in Amerika, von der Dampfkraft bis zur Massenproduktion, vom Zinswucher bis zur Stagflation, von den verpassten Chancen der Niederlande bis zum Staatskapitalismus in China, von Napoleon bis zu Max Weber.
All das ist lehrreich und gut erzählt – allerdings ohne jeglichen Spannungsbogen. Die kontroversen, diskussionswürdigen Thesen, die in diese kolossale Fleißarbeit eingewoben sind, wären in kurzen, pointierten Essays doch besser aufgehoben.
Joyce Appleby: Die unbarmherzige Revolution. Eine Geschichte des Kapitalismus
Murmann Verlag Hamburg, März 2011
Vor diesem Hintergrund hat der Murmann Verlag Joyce Applebys Geschichte des Kapitalismus unter dem anklagenden Titel "Die unbarmherzige Revolution" herausgebracht. Freilich geht es der amerikanischen Historikerin vor allem um das Phänomen der unablässigen Erneuerung, die mit dem Heraufziehen des Kapitalismus möglich geworden ist. Es geht ihr um die Kultur des Kapitalismus.
Appleby erkennt durchaus die großen Meriten eines Systems an, das Gesellschaften ermöglicht, sich immer wieder neu zu erfinden und zu durchmischen. Dennoch treibt auch sie die üblichen Säue durchs Dorf, von der Krisenanfälligkeit freier Märkte bis hin zu den angeblich vom Kapitalismus verursachten Mentalitätsverkrümmungen.
"… kurzsichtiges Handeln unter Vernachlässigung langfristiger Folgen, Zuteilung von Kompetenzen ohne gleichzeitige Zuweisung von Verantwortung, Bevorzugung materieller gegenüber geistigen Werten, Kommerzialisierung zwischenmenschlicher Beziehungen, Monetarisierung sozialer Werte, Schädigung der Demokratie, Verunsicherung von Gemeinschaften und Institutionen, Gefährdung bestehender Abmachungen, Förderung von Aggressivität und Belohnung von Gier."
Es drängt sich die Gegenfrage auf, ob unfreie Systeme nicht dieselben oder noch weitere Probleme mit sich bringen. Man muss nur nach Kuba blicken oder, gerade als Historiker, auf die Jahrzehnte sozialistischer Experimente im Ostblock. Abgesehen davon wird die alte These vom Moralverzehr des Markts durch Wiederholung nicht besser.
Eine triftige Widerlegung könnte die Autorin schon bei Adam Smith finden, dem berühmten Moralphilosophen der schottischen Aufklärung und Begründer der modernen Ökonomie, der in seiner "Theorie der ethischen Gefühle" die Geburt des gesellschaftlichen Moralkonsenses aus der Interaktion erklärt. Doch Smith scheint nicht gerade ihr Lieblingsautor zu sein.
"Nach Smith bildete sich der Kapitalismus aufgrund der allgemeinen natürlichen Neigung des Menschen aus, Dinge zu tauschen. Stattdessen war die ökonomische Entwicklung selbst eine Bedingung dafür, dass sich diese spezifische, kulturell bedingte Neigung durchsetzen konnte. Smith vertauschte Ursache und Wirkung."
Diese Kritik geht zu weit. Dass Austauschbeziehungen und Arbeitsteilung das Leben prägen, ist eine anthropologische Konstante. Der Mensch lebt in Gemeinschaft, weil er anders nicht überleben kann, auch seine ganze Gattung nicht. Wenn der Mensch in Gemeinschaft lebt, kommuniziert er mit anderen, arrangiert sich mit anderen, nimmt Leistungen in Anspruch und wird selbst in die Pflicht genommen.
Wer den Nachweis führen will, dass der kapitalistische Geist keineswegs zur Grundausstattung des Menschen gehört, wie Appleby schreibt, der kann sich nicht darauf beschränken, einfach das Tauschmotiv zu leugnen. Die Argumentation wird erst in dem Moment schlüssiger, wo der kapitalistische Fortschrittsoptimismus in den Blick gelangt.
Dass man sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann, war in der Tat eine Erkenntnis, die auch im Westen erst im Zuge der Aufklärung populär wurde, im Zuge der Ablösung vom Feudalismus. Andernorts hat dieser Bewusstseinswandel bis heute nicht stattgefunden. Joyce Appleby findet freilich auch am Fortschrittsdenken etwas zu kritisieren.
"Dass kaum jemand sich überrascht zeigt, wenn eine Krise eintritt, verweist auf eine Eigenschaft, die im Kapitalismus kultiviert wird. Gemeint ist eine Art von Optimismus, die die Realität verneint."
Liberale Ökonomen berauschen sich in der Rückschau allzu gern an der vermeintlichen Folgerichtigkeit der Entwicklung zur Marktwirtschaft und wundern sich dann über reale Fehlentwicklungen. Appleby warnt vor dieser deterministischen Versuchung und mahnt, den Blick offen zu halten für die wichtigste Frage: Wie konnte sich die Kultur des Kapitalismus entwickeln? Was waren ihre Voraussetzungen?
Ganz in Marx’scher Tradition sieht sie die Ökonomie in der Führungsrolle: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Historisch hat nach Ansicht der Verfasserin schlicht das günstige Gemisch aus fortschrittlicher Agrartechnik, Recht und politischer Verfassung im England des 17. Jahrhunderts den Boden für die ökonomische Revolution bereitet – mit soziologischen wie ideellen Konsequenzen erst in mittlerer Frist. Die "kapitalistischen Werte" hätten Zeit gebraucht, um sich durchzusetzen.
"Der Kapitalismus trat also mit einer englischen Prägung in die Geschichte ein. Das bedeutete, dass die Marktwirtschaft für diejenigen, deren Muttersprache eine andere als die englische war, ihre Fremdheit nie ganz verlor."
Aber brauchen ökonomische Revolutionen nicht immer auch ein passendes kulturelles Klima? Rätselhaft ist auch, weshalb die Autorin darauf beharrt, dass "die Saat des Kapitalismus nicht im Mittelalter gelegt wurde". Schließlich lässt sich die von ihr betonte einzigartige Rolle Englands gar nicht denken, wenn es damals keinen Schatz an politischen Ideen gegeben hätte, den man hätte nutzen können – etwa dank der päpstlichen Revolution des 11. Jahrhunderts, die das Recht wiederbelebte und der Trennung von Politik und Religion Vorschub leistete.
Insgesamt ist dies ein unhandliches Buch. Die Geschichte des Kapitalismus entfaltet sich auf mehr als 600 Seiten. Das Spektrum reicht von den Hungersnöten in England bis zur Sklavenhaltung in Amerika, von der Dampfkraft bis zur Massenproduktion, vom Zinswucher bis zur Stagflation, von den verpassten Chancen der Niederlande bis zum Staatskapitalismus in China, von Napoleon bis zu Max Weber.
All das ist lehrreich und gut erzählt – allerdings ohne jeglichen Spannungsbogen. Die kontroversen, diskussionswürdigen Thesen, die in diese kolossale Fleißarbeit eingewoben sind, wären in kurzen, pointierten Essays doch besser aufgehoben.
Joyce Appleby: Die unbarmherzige Revolution. Eine Geschichte des Kapitalismus
Murmann Verlag Hamburg, März 2011
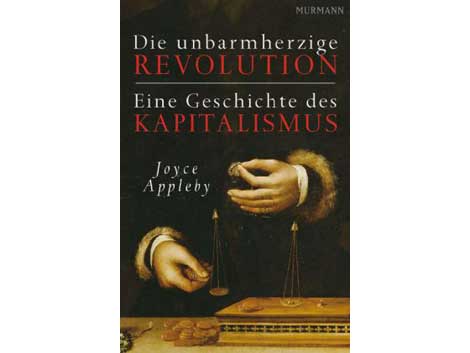
Buchcover: "Die unbarmherzige Revolution" von Joyce Appleby© Murmann Verlag
