Die erschütternde Kraft der Musik
Daniel J. Levitin versucht in "Der Musik-Instikt" die Gefühlsreaktionen des Menschen auf Musik zu erklären. Oliver Sacks beschreibt in "Der einarmige Pianist", wie Musik auf kranke Menschen wirkt.
Musik sagt nichts, funktioniert nicht in Begriffen. Sie ist klingende Luft: Nur da, solange man sie hört.
Warum gibt es Musik? Warum hat die menschliche Evolution deren Fortbestand gesichert? Bringt Musik dem Menschen irgendeinen Überlebensvorteil?
"Es gibt eine Menge Leute, die finden es leichter über Musik miteinander zu kommunizieren als über Sprache. Sprache ist gut für analytische und faktizide Kommunikation. Musik ist besser, wenn es um Gefühle geht. Kunst ganz allgemein: Malerei, Skulptur, Tanz, Theater, Poesie. Kunst will etwas ganz anderes transportieren als Nachrichten. Kunst berührt den Menschen innen und lenkt ihn hin zu einer Gefühlsreaktion auf ein Ereignis. Denn sie zeigt uns die Wirklichkeit in übertragener Form, in neuer Gestalt. Vielleicht in Form literarischer Bilder oder in Form von Klang. Diese Formen machen es leichter für uns, an den affektiven Gehalt eines Themas heranzukommen."
Der Kognitionspsychologe Professor Daniel Levitin, der als Musikproduzent von Chris Isaac, Joni Mitchell und Carlos Santana goldene Schallplatten gewonnen hat, sagt, eines Tages hätte er dringend der Frage nachgehen wollen, warum Musik auf ihn eine manchmal erschütternd tiefgehende emotionale Wirkung habe. Zum Beispiel die des von ihm sehr verehrten Komponisten und Sängers Elvis Costello.
"All the words you say to me
have music in them
All the sorrows and the joys
like magnetism
And a selfish boy looks through a prism
and says what is
But never asks what isn’t.”"
""Die bildgebenden Verfahren, mit denen wir heute arbeiten, haben uns etwas sehr Spannendes im Hinblick auf die tiefgehende emotionale Wirkung von Musik gezeigt: Musik ist in der Lage, einige Regionen im Gehirn zu aktivieren, die von der Sprache nicht erreicht werden. Das sind die primitiven Regionen, die alle Wirbel-und Säugetiere gemeinsam haben. Regionen wie das Kleinhirn und der Hirnstamm. Interessant ist auch die Verbindung zur Amygdala, die die Kampf- oder Fluchtreaktionen auslöst. Wenn wir beim Hören von Musik erschaudern, wenn sich unsere Körperhaare aufstellen und wir Gänsehaut kriegen – all das geht auf Aktivitäten der Amygdala zurück."
Der 75-jährige Neurologe Oliver Sacks, der einen enthusiastischen Klappentext zu Levitins "Musik-Instinkt" beisteuerte, hat übrigens in seiner Sammlung von Fallstudien mit dem Titel "Der einarmige Pianist" beschrieben, wie Musik auf kranke Menschen wirkt. Ein Aspekt, den Levitin in seinem Kompendium ausblendet.
"Mit dem Dichter Walt Whitman sage ich, obwohl meine Profession die Neurologie ist: Ich feiere die Vielfalt. Farbblindheit oder Taubheit sind nicht nur Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Sie können auch die Möglichkeit für ein anderes Leben eröffnen."
Was die Rolle der Musik bei der Therapie von Alzheimer- und anderen Demenzpatienten angeht, sind Sacks’ Einlassungen ziemlich spektakulär: Der Verlust des Gedächtnisses schließt Demenzkranke zwar in ein Leben purer Gegenwart ein. Aber die Erinnerung an ihre Musik bleibt ihnen bis zuletzt. Und nur die im Gehirn unglaublich komplex verschaltete Musik ist in der Lage, - Zitat Oliver Sacks - "vergessene Emotionen hervorzulocken und den Patienten zu orientieren und zu verankern, wenn fast nichts mehr anderes hilft".
Professor Daniel Levitin, Leiter des Labors für musikalische Wahrnehmung und Inhaber eines Lehrstuhls für die Psychologie der elektronischen Kommunikation an der McGill University in Kanada, ist sich mit Sacks einig, dass Musik eine wichtige Rolle in der menschlichen Evolution spielte. Denn die Schrift gibt es erst 5000 Jahre, den Menschen aber seit 150 000 Jahren. Wie wurde vor Erfindung der Schrift eine wichtige Information weitergegeben? Levitin nimmt an: Der Mensch reimte. Diese Pflanze kannst Du essen. Von jener solltest Du die Finger lassen. Und damit alle das besser behielten, wurde es mit einer Melodie unterlegt.
Hören ist der erste unserer Sinne, der sich schon beim Fötus für die Welt öffnet und der letzte, der sich vor ihr verschließt, wenn es ans Sterben geht.
In den letzten Jahren machten Studien mit dem Titel "Der Mozart-Effekt" oder Forschungen zur förderlichen Rolle der Musik in der Schlaganfalltherapie Furore. Auch Oliver Sacks betrachtet in seinem Buch "Der einarmige Pianist" Musik als Beiwerk zur Symptomklärung oder in ihrer heilenden Wirkung. Daniel Levitin hat einen anderen Ansatz. Ihm geht es in seinen Betrachtungen zum Thema Musik und Gehirn nicht darum, dass mit Hilfe der Musik bei anderen, vielleicht vorgeblich "wichtigeren" Dingen bessere Ergebnisse zu erzielen wären, sondern darum, Beweise dafür zu finden, wie die vielleicht manchmal unheimlichen Gefühlsreaktionen auf Musik fassbar zu machen sind. Auch wenn Daniel Levitins Motiv damit letztlich womöglich ein Kontrollbedürfnis ist: Seine Begeisterung und Neugierde, sein Forscherdrang teilen sich dem Leser mit und machen das Kompendium "Der Musik-Instinkt" zu einem kurzweiligen Sachbuch, das uns über den aktuellen Stand der Forschung informiert.
Daniel J. Levitin: Der Musik-Instinkt - Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft
Aus dem Englischen von Andreas Held
Spektrum Akademischer Verlag
Oliver Sacks: Der einarmige Pianist – Über Musik und Gehirn
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Rowohlt Verlag
Warum gibt es Musik? Warum hat die menschliche Evolution deren Fortbestand gesichert? Bringt Musik dem Menschen irgendeinen Überlebensvorteil?
"Es gibt eine Menge Leute, die finden es leichter über Musik miteinander zu kommunizieren als über Sprache. Sprache ist gut für analytische und faktizide Kommunikation. Musik ist besser, wenn es um Gefühle geht. Kunst ganz allgemein: Malerei, Skulptur, Tanz, Theater, Poesie. Kunst will etwas ganz anderes transportieren als Nachrichten. Kunst berührt den Menschen innen und lenkt ihn hin zu einer Gefühlsreaktion auf ein Ereignis. Denn sie zeigt uns die Wirklichkeit in übertragener Form, in neuer Gestalt. Vielleicht in Form literarischer Bilder oder in Form von Klang. Diese Formen machen es leichter für uns, an den affektiven Gehalt eines Themas heranzukommen."
Der Kognitionspsychologe Professor Daniel Levitin, der als Musikproduzent von Chris Isaac, Joni Mitchell und Carlos Santana goldene Schallplatten gewonnen hat, sagt, eines Tages hätte er dringend der Frage nachgehen wollen, warum Musik auf ihn eine manchmal erschütternd tiefgehende emotionale Wirkung habe. Zum Beispiel die des von ihm sehr verehrten Komponisten und Sängers Elvis Costello.
"All the words you say to me
have music in them
All the sorrows and the joys
like magnetism
And a selfish boy looks through a prism
and says what is
But never asks what isn’t.”"
""Die bildgebenden Verfahren, mit denen wir heute arbeiten, haben uns etwas sehr Spannendes im Hinblick auf die tiefgehende emotionale Wirkung von Musik gezeigt: Musik ist in der Lage, einige Regionen im Gehirn zu aktivieren, die von der Sprache nicht erreicht werden. Das sind die primitiven Regionen, die alle Wirbel-und Säugetiere gemeinsam haben. Regionen wie das Kleinhirn und der Hirnstamm. Interessant ist auch die Verbindung zur Amygdala, die die Kampf- oder Fluchtreaktionen auslöst. Wenn wir beim Hören von Musik erschaudern, wenn sich unsere Körperhaare aufstellen und wir Gänsehaut kriegen – all das geht auf Aktivitäten der Amygdala zurück."
Der 75-jährige Neurologe Oliver Sacks, der einen enthusiastischen Klappentext zu Levitins "Musik-Instinkt" beisteuerte, hat übrigens in seiner Sammlung von Fallstudien mit dem Titel "Der einarmige Pianist" beschrieben, wie Musik auf kranke Menschen wirkt. Ein Aspekt, den Levitin in seinem Kompendium ausblendet.
"Mit dem Dichter Walt Whitman sage ich, obwohl meine Profession die Neurologie ist: Ich feiere die Vielfalt. Farbblindheit oder Taubheit sind nicht nur Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Sie können auch die Möglichkeit für ein anderes Leben eröffnen."
Was die Rolle der Musik bei der Therapie von Alzheimer- und anderen Demenzpatienten angeht, sind Sacks’ Einlassungen ziemlich spektakulär: Der Verlust des Gedächtnisses schließt Demenzkranke zwar in ein Leben purer Gegenwart ein. Aber die Erinnerung an ihre Musik bleibt ihnen bis zuletzt. Und nur die im Gehirn unglaublich komplex verschaltete Musik ist in der Lage, - Zitat Oliver Sacks - "vergessene Emotionen hervorzulocken und den Patienten zu orientieren und zu verankern, wenn fast nichts mehr anderes hilft".
Professor Daniel Levitin, Leiter des Labors für musikalische Wahrnehmung und Inhaber eines Lehrstuhls für die Psychologie der elektronischen Kommunikation an der McGill University in Kanada, ist sich mit Sacks einig, dass Musik eine wichtige Rolle in der menschlichen Evolution spielte. Denn die Schrift gibt es erst 5000 Jahre, den Menschen aber seit 150 000 Jahren. Wie wurde vor Erfindung der Schrift eine wichtige Information weitergegeben? Levitin nimmt an: Der Mensch reimte. Diese Pflanze kannst Du essen. Von jener solltest Du die Finger lassen. Und damit alle das besser behielten, wurde es mit einer Melodie unterlegt.
Hören ist der erste unserer Sinne, der sich schon beim Fötus für die Welt öffnet und der letzte, der sich vor ihr verschließt, wenn es ans Sterben geht.
In den letzten Jahren machten Studien mit dem Titel "Der Mozart-Effekt" oder Forschungen zur förderlichen Rolle der Musik in der Schlaganfalltherapie Furore. Auch Oliver Sacks betrachtet in seinem Buch "Der einarmige Pianist" Musik als Beiwerk zur Symptomklärung oder in ihrer heilenden Wirkung. Daniel Levitin hat einen anderen Ansatz. Ihm geht es in seinen Betrachtungen zum Thema Musik und Gehirn nicht darum, dass mit Hilfe der Musik bei anderen, vielleicht vorgeblich "wichtigeren" Dingen bessere Ergebnisse zu erzielen wären, sondern darum, Beweise dafür zu finden, wie die vielleicht manchmal unheimlichen Gefühlsreaktionen auf Musik fassbar zu machen sind. Auch wenn Daniel Levitins Motiv damit letztlich womöglich ein Kontrollbedürfnis ist: Seine Begeisterung und Neugierde, sein Forscherdrang teilen sich dem Leser mit und machen das Kompendium "Der Musik-Instinkt" zu einem kurzweiligen Sachbuch, das uns über den aktuellen Stand der Forschung informiert.
Daniel J. Levitin: Der Musik-Instinkt - Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft
Aus dem Englischen von Andreas Held
Spektrum Akademischer Verlag
Oliver Sacks: Der einarmige Pianist – Über Musik und Gehirn
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Rowohlt Verlag
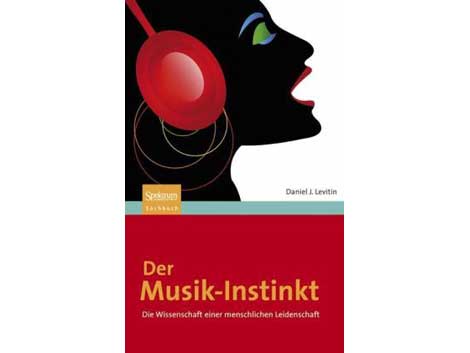
Daniel J. Levitin: "Der Musik-Instikt"© Rowohlt Verlag
