Der Wandel des Stauffenberg-Bildes
Zum Jahrestag des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 sind zwei Bücher erschienen, die sich mit Claus Schenk von Stauffenberg, seiner Tat und dem sich wandelnden Geschichtsbild beschäftigen. In "Operation Walküre" schildert Tobias Kniebe die Vorbereitung und Durchführung des Anschlags. In "Es lebe das Heilige Deutschland" befasst sich Ulrich Schlie mit dem Lebensweg von Stauffenbergs.
Weil jede Generation Geschichte neu befragt, gibt es auch immer andere Antworten auf viele Fragen. Dies ist nicht ohne Gefahr für die Überlieferung und Geschichtsbilder. In der Tat sind für keinen Bereich der Zeitgeschichte mündliche Überlieferungen so wichtig gewesen, wie für die Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. In Archiven finden sich zwar viele Flugblätter der NS-Gegner und nicht wenige Unterlagen der Verfolger. Darunter auch die Berichte der Sonderkommission 20. Juli 1944, die nach dem Anschlag Stauffenbergs eingesetzt wurde.
Die Geschichte der internen Auseinandersetzungen zwischen den Regimegegnern, ihrer verwirrenden Diskussionen über ihre Ziele und Methoden ist auf Erinnerungen Überlebender angewiesen. Damit liefert sich der Historiker aber dem Zeitzeugen aus, der sich oft als Einziger erinnert und deshalb kaum korrigiert werden kann, sei es aus Pietät und Takt, sei es wegen fehlender anderer Überlieferungen. Historiker sind auf Zeitzeugen angewiesen, deren Lebenszeugnisse oftmals umso farbiger ausfallen, je weiter wir uns vom eigentlichen Ereignis entfernen. Und nicht selten sagen sie mehr über den Zeugen als über das Ereignis selbst aus.
Tobias Kniebe schildert Vorbereitung und Durchführung der Operation "Walküre" mit der Präzision eines Drehbuchautors. Er macht deutlich, wie sehr unsere Erinnerung von Bildern abhängt, die durch Spielfilme erzeugt wurden. Ulrich Schlie hingegen nähert sich Stauffenberg und dessen Tat an, indem er nach Herkunft, Erziehung, Bildung und Ethos fragt. Für ihn ist Stauffenberg vor allem als Soldat, als "Kämpfer" und "Krieger" zu verstehen und zu würdigen.
"Leben hieß für Stauffenberg: Krieger sein. Was für die Stoiker gilt, traf auf ihn im wahren Wortsinn zu. Dem Staat zu dienen hieß für ihn später: kämpfen, und als der Staat gänzlich in die Hände der Verbrecher gefallen war und kein anderer sich dazu bereit fand, das Äußerste zu wagen: Staatsstreich und Attentat."
Die gut lesbaren Arbeiten von Tobias Kniebe und Ulrich Schlie, Filmjournalist der eine, Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium der andere, stehen unter dem Eindruck der Stauffenberg-Renaissance, die seit etwa zehn Jahren zu bemerken ist.
Weil in der Widerstandsforschung Grundsätze der Quellenkritik nur selten zu gelten scheinen, ist es wohltuend, dass Schlie die Darstellung der Ereignisse von seinen persönlichen Nachfragen und Würdigungen scheidet. Er beschreibt verständlich und präzise wie kaum ein Autor vor ihm die Diskussionen über die Kompetenz und Leistungsfähigkeit der deutschen Kriegsspitzen und macht zugleich die Verantwortungslosigkeit menschenverachtender Kriegführung deutlich, die Stauffenberg empörte.
Schlie behauptet auch nicht, Stauffenberg sei ein Gegner des Regimes von der ersten Stunde an gewesen, er wiederholt auch nicht verbreitete Vorurteile und Verurteilungen, das an den Stammtischen gehörte "falsch und zu spät", das Gerede von der Haut, die im letzten Moment gerettet werden sollte. Ihm gelingt es vielmehr, die Überlieferungskontexte zu benennen. So wurde erst 1951 behauptet, Stauffenberg hätte am 30. Januar 1933 der Hakenkreuzfahne Reverenz erwiesen – in den Erinnerungen eines Generals, der seine Rehabilitierung betrieb. Wenn Stauffenberg damals - 1933 - derart geirrt habe, was wäre dann ihm, dem 1951 seine Rehabilitierung betreibenden ehemaligen Wehrmachtsgeneral anzulasten?
Schlie will vor allem zeigen, wie sich in der Auseinandersetzung mit der Realität des Krieges bei dem späteren Attentäter eine Distanzierung vom Regime und seinen Verbrechen entwickelte, die schließlich zur Tat drängte und von jeder Rücksicht auf das eigene Leben absah.
"Die Berührung mit dem Tod und die Bindung an die Besonderheit des soldatischen Dienens, die Bereitschaft, unter Einsatz des eigenen Lebens seinen Auftrag zu erfüllen, haben in ihm den Grundsatz verankert, dass der sittliche Wert eines Menschen erst da beginnt, wo er bereit ist, sein Leben für andere zu opfern."
Beim Attentat des 20. Juli geht es nicht nur um die Geschichte Stauffenbergs, sondern um unser Bild von Attentäter und Tat, von seinem Handeln in einer Gruppe und für den zivilen Widerstand, dem sich Stauffenberg geradezu unterstellte. Schlie will reflektieren, was es heute bedeutet, sich auf die Tradition des Widerstands zu berufen. Es geht ja nicht mehr darum, mit dem Widerstand die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der zivilisierten Nationen zu forcieren, wie es in den 50er-Jahren üblich war. Deshalb kann auch die Frage, welchem rückwärtsgewandten politischen Weltbild die Gruppen um Stauffenberg, Goerdeler und Beck anhingen, keine Bedeutung mehr für die politisch-moralische und ethische Würdigung haben. Sondern es geht um politische Verantwortung, um Einsicht in politische Verbrechen, um Mut und die Überwindung von Angst und Furcht.
Dass die Regimegegner vielfach politische Positionen überwinden mussten, die sie, Kinder ihrer Zeit, mit den Nationalsozialisten zumindest partiell geteilt hatten, ist heute nicht mehr umstritten. Viel größer ist die Herausforderung Nachlebender, die Voraussetzungen ihres Tuns zu erfassen – also Wertvorstellungen zu verstehen, die es Regimegegnern ermöglichten, sich den Sogströmungen ihrer Zeit, der Neigung des Menschen zur Anpassung, dem Karrierestreben zu entziehen – so fremd sie uns heute auch sein mögen.
Auch hier gelangt Schlie zu wichtigen Erkenntnissen. Er lässt Stauffenberg als einen Suchenden, als Irrenden, als seine Begrenzungen überwindenden Handelnden deutlich werden.
"Widerstand, will er etwas bewirken, muss mit partieller Affirmation der bestehenden Zustände einhergehen."
Ein "Kommiskopp" war Stauffenberg so wenig wie seine Kameraden Tresckow und Mertz, wie Beck oder Olbricht. Gebildet, wie diese Offiziere waren, stellten sie sich ganz grundsätzlich ihrer Verantwortung für Krieg, Politik, Geschichte und Zukunft.
Sie gelangten so zu einer radikalen Haltung, die keine Rücksicht auf das eigene Leben und nicht einmal mehr auf die Familie nahm. Dass sie scheiterten, lag weniger an ihnen als an denen, auf die sie setzten und die sie im Stich ließen, als alles auf deren konsequente Unterstützung ankam.
Diese prinzipiellen Dimensionen einer Verantwortungsethik sind Kniebe fast ganz fremd. Er schildert spannend und verständlich Abläufe und bleibt ganz auf den Walküre-Film mit Tom Cruise fixiert, den er mit vielen Vorschuss-Lorbeeren versehen hat. Kniebe ist ganz Rechercheur. Schlie entgeht diesem Überlieferungsdilemma wesentlich besser.
Die Kontroversen der Widerstandsgeschichte sind inzwischen weitgehend ausgestanden. Inzwischen gehört die Vereidigung junger Rekruten am 20. Juli zu den neuen Gedenkritualen unserer Geschichts- und Erinnerungs-Politik. Sie verstärkt die bedenkliche Tendenz, Stauffenberg zum alles überragenden Regimegegner zu überhöhen. Doch der Widerstand erschöpft sich nicht in der Tat Stauffenbergs. Diese bildet nicht mehr als einen gewissen Endpunkt in einer langjährigen Auseinandersetzung von Christen, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern, Kommunisten, Jugendlichen, Emigranten, Kriegsgefangenen und einzelnen mit dem Regime und seinen Verbrechen.
Der Wandel des Stauffenberg-Bildes ist beachtlich. Mehrheitlich waren die Deutschen in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre noch dagegen, eine Straße oder gar eine Schule nach Stauffenberg zu benennen. Das änderte sich nur langsam mit den Interventionen von Theodor Heuß und durch den politischen Prozess, den der damalige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gegen den rechtsextremistischen Parteifunktionär und ehemaligen Wehrmachts-Major Remer am Oberlandesgericht Braunschweig geführt hatte. Remer hatte wesentlich dazu beigetragen dass der Umsturzversuch Stauffenbergs misslang. Fritz Bauer stellte in seinem Plädoyer fest, Hitler sei der "wahre Verräter" gewesen, einen Verräter aber könne man nicht verraten. Es ist gut, dass diese Deutung sich durchgesetzt hat.
Thomas Kniebe: Operation Walküre. Das Drama des 20. Juli
Rowohlt Berlin, 2009
Ulrich Schlie: Es lebe das heilige Deutschland – ein Tag im Leben des Claus Schenk von Stauffenberg
Herder Verlag, 2009
Die Geschichte der internen Auseinandersetzungen zwischen den Regimegegnern, ihrer verwirrenden Diskussionen über ihre Ziele und Methoden ist auf Erinnerungen Überlebender angewiesen. Damit liefert sich der Historiker aber dem Zeitzeugen aus, der sich oft als Einziger erinnert und deshalb kaum korrigiert werden kann, sei es aus Pietät und Takt, sei es wegen fehlender anderer Überlieferungen. Historiker sind auf Zeitzeugen angewiesen, deren Lebenszeugnisse oftmals umso farbiger ausfallen, je weiter wir uns vom eigentlichen Ereignis entfernen. Und nicht selten sagen sie mehr über den Zeugen als über das Ereignis selbst aus.
Tobias Kniebe schildert Vorbereitung und Durchführung der Operation "Walküre" mit der Präzision eines Drehbuchautors. Er macht deutlich, wie sehr unsere Erinnerung von Bildern abhängt, die durch Spielfilme erzeugt wurden. Ulrich Schlie hingegen nähert sich Stauffenberg und dessen Tat an, indem er nach Herkunft, Erziehung, Bildung und Ethos fragt. Für ihn ist Stauffenberg vor allem als Soldat, als "Kämpfer" und "Krieger" zu verstehen und zu würdigen.
"Leben hieß für Stauffenberg: Krieger sein. Was für die Stoiker gilt, traf auf ihn im wahren Wortsinn zu. Dem Staat zu dienen hieß für ihn später: kämpfen, und als der Staat gänzlich in die Hände der Verbrecher gefallen war und kein anderer sich dazu bereit fand, das Äußerste zu wagen: Staatsstreich und Attentat."
Die gut lesbaren Arbeiten von Tobias Kniebe und Ulrich Schlie, Filmjournalist der eine, Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium der andere, stehen unter dem Eindruck der Stauffenberg-Renaissance, die seit etwa zehn Jahren zu bemerken ist.
Weil in der Widerstandsforschung Grundsätze der Quellenkritik nur selten zu gelten scheinen, ist es wohltuend, dass Schlie die Darstellung der Ereignisse von seinen persönlichen Nachfragen und Würdigungen scheidet. Er beschreibt verständlich und präzise wie kaum ein Autor vor ihm die Diskussionen über die Kompetenz und Leistungsfähigkeit der deutschen Kriegsspitzen und macht zugleich die Verantwortungslosigkeit menschenverachtender Kriegführung deutlich, die Stauffenberg empörte.
Schlie behauptet auch nicht, Stauffenberg sei ein Gegner des Regimes von der ersten Stunde an gewesen, er wiederholt auch nicht verbreitete Vorurteile und Verurteilungen, das an den Stammtischen gehörte "falsch und zu spät", das Gerede von der Haut, die im letzten Moment gerettet werden sollte. Ihm gelingt es vielmehr, die Überlieferungskontexte zu benennen. So wurde erst 1951 behauptet, Stauffenberg hätte am 30. Januar 1933 der Hakenkreuzfahne Reverenz erwiesen – in den Erinnerungen eines Generals, der seine Rehabilitierung betrieb. Wenn Stauffenberg damals - 1933 - derart geirrt habe, was wäre dann ihm, dem 1951 seine Rehabilitierung betreibenden ehemaligen Wehrmachtsgeneral anzulasten?
Schlie will vor allem zeigen, wie sich in der Auseinandersetzung mit der Realität des Krieges bei dem späteren Attentäter eine Distanzierung vom Regime und seinen Verbrechen entwickelte, die schließlich zur Tat drängte und von jeder Rücksicht auf das eigene Leben absah.
"Die Berührung mit dem Tod und die Bindung an die Besonderheit des soldatischen Dienens, die Bereitschaft, unter Einsatz des eigenen Lebens seinen Auftrag zu erfüllen, haben in ihm den Grundsatz verankert, dass der sittliche Wert eines Menschen erst da beginnt, wo er bereit ist, sein Leben für andere zu opfern."
Beim Attentat des 20. Juli geht es nicht nur um die Geschichte Stauffenbergs, sondern um unser Bild von Attentäter und Tat, von seinem Handeln in einer Gruppe und für den zivilen Widerstand, dem sich Stauffenberg geradezu unterstellte. Schlie will reflektieren, was es heute bedeutet, sich auf die Tradition des Widerstands zu berufen. Es geht ja nicht mehr darum, mit dem Widerstand die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der zivilisierten Nationen zu forcieren, wie es in den 50er-Jahren üblich war. Deshalb kann auch die Frage, welchem rückwärtsgewandten politischen Weltbild die Gruppen um Stauffenberg, Goerdeler und Beck anhingen, keine Bedeutung mehr für die politisch-moralische und ethische Würdigung haben. Sondern es geht um politische Verantwortung, um Einsicht in politische Verbrechen, um Mut und die Überwindung von Angst und Furcht.
Dass die Regimegegner vielfach politische Positionen überwinden mussten, die sie, Kinder ihrer Zeit, mit den Nationalsozialisten zumindest partiell geteilt hatten, ist heute nicht mehr umstritten. Viel größer ist die Herausforderung Nachlebender, die Voraussetzungen ihres Tuns zu erfassen – also Wertvorstellungen zu verstehen, die es Regimegegnern ermöglichten, sich den Sogströmungen ihrer Zeit, der Neigung des Menschen zur Anpassung, dem Karrierestreben zu entziehen – so fremd sie uns heute auch sein mögen.
Auch hier gelangt Schlie zu wichtigen Erkenntnissen. Er lässt Stauffenberg als einen Suchenden, als Irrenden, als seine Begrenzungen überwindenden Handelnden deutlich werden.
"Widerstand, will er etwas bewirken, muss mit partieller Affirmation der bestehenden Zustände einhergehen."
Ein "Kommiskopp" war Stauffenberg so wenig wie seine Kameraden Tresckow und Mertz, wie Beck oder Olbricht. Gebildet, wie diese Offiziere waren, stellten sie sich ganz grundsätzlich ihrer Verantwortung für Krieg, Politik, Geschichte und Zukunft.
Sie gelangten so zu einer radikalen Haltung, die keine Rücksicht auf das eigene Leben und nicht einmal mehr auf die Familie nahm. Dass sie scheiterten, lag weniger an ihnen als an denen, auf die sie setzten und die sie im Stich ließen, als alles auf deren konsequente Unterstützung ankam.
Diese prinzipiellen Dimensionen einer Verantwortungsethik sind Kniebe fast ganz fremd. Er schildert spannend und verständlich Abläufe und bleibt ganz auf den Walküre-Film mit Tom Cruise fixiert, den er mit vielen Vorschuss-Lorbeeren versehen hat. Kniebe ist ganz Rechercheur. Schlie entgeht diesem Überlieferungsdilemma wesentlich besser.
Die Kontroversen der Widerstandsgeschichte sind inzwischen weitgehend ausgestanden. Inzwischen gehört die Vereidigung junger Rekruten am 20. Juli zu den neuen Gedenkritualen unserer Geschichts- und Erinnerungs-Politik. Sie verstärkt die bedenkliche Tendenz, Stauffenberg zum alles überragenden Regimegegner zu überhöhen. Doch der Widerstand erschöpft sich nicht in der Tat Stauffenbergs. Diese bildet nicht mehr als einen gewissen Endpunkt in einer langjährigen Auseinandersetzung von Christen, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern, Kommunisten, Jugendlichen, Emigranten, Kriegsgefangenen und einzelnen mit dem Regime und seinen Verbrechen.
Der Wandel des Stauffenberg-Bildes ist beachtlich. Mehrheitlich waren die Deutschen in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre noch dagegen, eine Straße oder gar eine Schule nach Stauffenberg zu benennen. Das änderte sich nur langsam mit den Interventionen von Theodor Heuß und durch den politischen Prozess, den der damalige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gegen den rechtsextremistischen Parteifunktionär und ehemaligen Wehrmachts-Major Remer am Oberlandesgericht Braunschweig geführt hatte. Remer hatte wesentlich dazu beigetragen dass der Umsturzversuch Stauffenbergs misslang. Fritz Bauer stellte in seinem Plädoyer fest, Hitler sei der "wahre Verräter" gewesen, einen Verräter aber könne man nicht verraten. Es ist gut, dass diese Deutung sich durchgesetzt hat.
Thomas Kniebe: Operation Walküre. Das Drama des 20. Juli
Rowohlt Berlin, 2009
Ulrich Schlie: Es lebe das heilige Deutschland – ein Tag im Leben des Claus Schenk von Stauffenberg
Herder Verlag, 2009
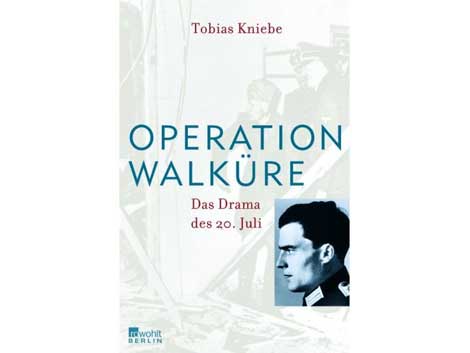
Thomas Kniebe: "Operation Walküre. Das Drama des 20. Juli"© Rowohlt Berlin
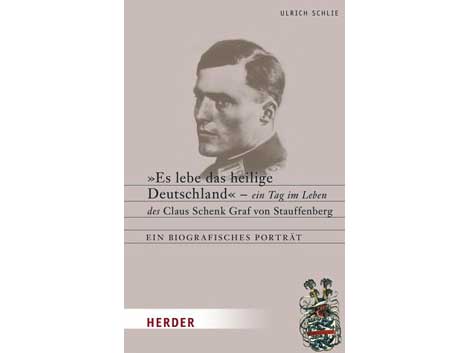
Ulrich Schlie: „Es lebe das heilige Deutschland“© Herder Verlag
