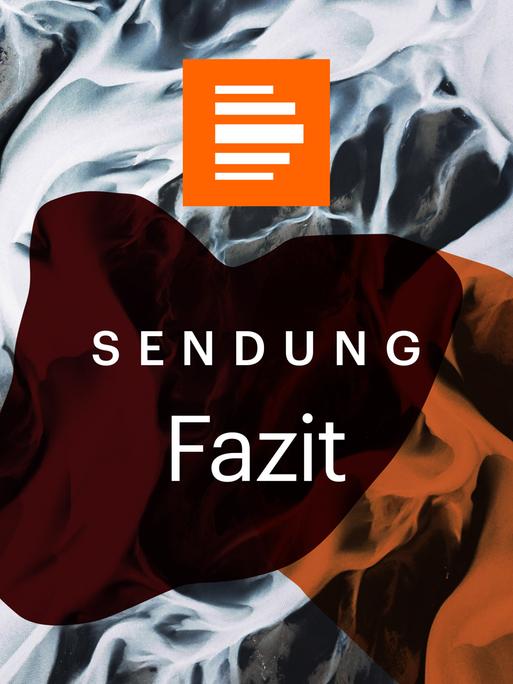Der Schatz im Salzsee
Lithium ist ein begehrter Rohstoff, der für die Herstellung der Batterien von Elektro-Autos gebraucht wird. Die Jagd ausländischer Investoren auf Boliviens reiche Vorräte ist in vollem Gang, doch der Andenstaat will selbst von seinen Schätzen profitieren.
Lithium ist ein begehrter Rohstoff, der für die Herstellung der Batterien von Elektro-Autos gebraucht wird. Die Jagd auf Boliviens reiche Vorräte ist in vollem Gang, ausländische Investoren geben sich die Klinke in die Hand. Doch der Andenstaat will von seinen Schätzen profitieren.
Auf dem Salar de Uyuni im Südwesten Boliviens, dem größten Salzsee der Welt. Nur von Dezember bis März, wenn es regnet, ähnelt der Salar wirklich einem See. Die dicke Salzkruste ist dann von Wasser bedeckt. Während der restlichen Monate wird der Salar de Uyuni zur Salzwüste, 12.000 Quadratkilometer groß. Die weiße Kruste erinnert an gefrorenen Schnee, sie ist von einem wabenähnlichen Muster überzogen.
Der Uyuni-Salzsee liegt auf gut 3.600 Metern Höhe in der bolivianischen Region Potosí. 2009 zog der See mehr als 80.000 Besucher aus der ganzen Welt an. Doch seit ein paar Jahren interessiert der Salar de Uyuni nicht nur Touristen, sondern auch ausländische Rohstoff-Unternehmen und Auto-Hersteller. Denn unter seiner Oberfläche verbirgt sich ein Schatz: die weltweit größten Vorkommen des Leichtmetalls Lithium. Neun Millionen Tonnen nach Schätzungen des Geologischen Dienstes der USA, doppelt so viel laut bolivianischer Regierung. Lithium ist Grundstoff hochpotenter, aufladbarer Batterien, die Elektrofahrzeuge antreiben. An der Entwicklung dieser umweltfreundlichen Vehikel arbeitet die internationale Automobil-Industrie auf Hochtouren.
"Was machen wir mit unseren Lithium-Reserven? Wir wollen Batterien herstellen, genauer gesagt Lithium-Ionen-Akkus – für Elektroautos, aber auch für Uhren, Taschenrechner oder Mobiltelefone. Auch Elektrofahrzeuge würden wir gerne hier in Bolivien produzieren."
… erklärt Gonzalo Alfaro, ein hochgewachsener Ingenieur, und rückt seinen weißen Helm zurecht. Alfaro ist leitender Mitarbeiter einer Pilotanlage zur Lithium-Gewinnung, die die bolivianische Regierung 15 Kilometer enfernt vom Uyuni-Salzsee baut: Mehrere weiße Gebäude mit verspiegelten Scheiben stehen schon. Gonzalo Alfaro betrachtet das halbfertige Labor. Der Stolz auf das, was hier entsteht, ist ihm anzumerken:
"Die Lithium-Reserven bedeuten für Bolivien Fortschritt, Wachstum, Unabhängigkeit und Nationalismus. Sie machen uns Bolivianern Mut."
Noch ist die Herstellung von Lithium-Batterien und Elektroautos in Bolivien Zukunftsmusik. Doch nicht nur Ingenieur Alfaro träumt diesen Traum. Auch Präsident Evo Morales am 550 Kilometer entfernten Regierungssitz La Paz tut es. Sein Ziel: Bolivien soll das Lithium nicht nur selbst aus dem Salzsee holen, sondern auch eine weiterverarbeitende Industrie aufbauen. Der Sozialist Morales wird nicht müde, über die Hoffnung zu sprechen, die der begehrte Rohstoff für sein Land bedeute. Bei einem Lithium-Kongress in La Paz wandte sich Boliviens erster indigener Präsident vor einem Jahr an die internationalen Teilnehmer:
"In unserer Geschichte wurden wir immer wieder ausgeplündert, wir Bolivianer, ein armes Volk. Wenn wir das Lithium nicht in unserem Land weiterverarbeiten, werden wir Bolivien niemals verändern. Dann werden wir weiter ausgebeutet, und andere Länder nehmen unsere Bodenschätze mit, so wie die Spanier das Silber aus Potosí. Diese Geschichte darf sich nicht wiederholen, nicht mit unserem Lithium, nicht mit unserem Eisen und nicht mit unserem Erdöl."
Unter spanischer Kolonialherrschaft schufteten im 16. und 17. Jahrhundert Zehntausende von Indio-Sklaven im Silberbergwerk von Potosí. Zwar gibt es heute keine derartige Ausplünderung mehr, doch Bolivien, das ärmste Land Südamerikas, exportiert die meisten seiner Rohstoffe: Erdgas und Öl, Agrarprodukte, Metalle und Mineralien. Der Bergbausektor wird von ausländischen Firmen dominiert, beim Leichtmetall aus dem Uyuni-Salzsee soll nun alles anders werden. "Ein zu 100 Prozent bolivianisches Projekt" lautet die Devise der Regierung für die Lithium-Gewinnung – das heißt, die Extraktion aus dem See und die Verarbeitung zu Lithiumkarbonat.
Zurück in der südwestlichen Region Potosí. Von der staatlichen Pilotanlage führt eine Schotterpiste über die karge Hochebene, das Altiplano, bis zum Salar de Uyuni. Chemie-Ingenieur Miguel Parra, ein ernsthafter, dynamisch wirkender Mann Ende 30, ist mit einem Jeep unterwegs zu seiner Arbeitsstelle auf dem Salzsee. Eine knappe halbe Stunde dauert es bis zum Ufer – dann braust das Fahrzeug über die harte Salzkruste und hält nach weiteren zehn Minuten.
"Das ist eines der Löcher, die wir gebohrt haben – 30 Meter tief. Daraus pumpen wir die Salzlauge, die unter der Kruste fließt und Lithium enthält."
Parra trägt eine Vliesjacke und schützt seine Augen mit einer dunklen Brille vor der gleißenden Sonne. Vom Bohrloch sind es nur ein paar Schritte zu einer Reihe von Becken, die der bolivianische Experte auf der Salzkruste errichtet hat. Sie sind jeweils fünf mal zehn Meter groß:
"Dies sind meine Versuchsbecken. Der erste Schritt ist, dass wir aus der Salzlauge durch eine chemische Reaktion die Sulfate herausholen, die wir nicht gebrauchen können. Anschließend kommt die Lauge in das erste Verdunstungsbecken, wo sich das Mineral Halit herauskristallisiert."
Halit, besser bekannt unter dem Namen Steinsalz, hat sich in blassrosa Kristallen am Beckenrand abgesetzt. Insgesamt wird die Salzlauge durch vier Verdunstungsbecken geleitet. Die Verdunstung ist das Verfahren zur Lithium-Gewinnung, das Miguel Parra auf dem Uyuni-Salzsee erprobt hat. Unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung und Wind setzen sich nacheinander verschiedene Salze ab, darunter Pottasche und Magnesiumchlorid, bis eine grünliche, ölige Flüssigkeit übrigbleibt. In ihr befindet sich reines Lithium. Chemie-Ingenieur Parra beugt sich über das vierte Becken und begutachtet zufrieden das Ergebnis:
"Hier endet der Verdunstungsprozess. Die konzentrierte Lithium-Flüssigkeit werden wir in die Fabrik bringen. Dort kann dann unter Zugabe einiger chemischer Elemente Lithiumkarbonat erzeugt werden."
Das weiße Pulver also, das für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus benötigt wird. In diesem Monat will Parra auf dem Salar de Uyuni mit der Verdunstung in großem Stil beginnen. Riesige Becken, 300 Meter lang und 150 Meter breit, warten bereits auf die Einleitung von Salzlauge. Wenn in einigen Monaten voraussichtlich große Mengen von Lithium-Flüssigkeit zur Verfügung stehen, soll die staatliche Pilotanlage am Salzsee den Betrieb aufnehmen.
Ein moderner Büroturm unweit des Prado, der Flaniermeile von La Paz. Mit dem Aufzug geht es in den neunten Stock. Luís Alberto Echazú leitet die für die Lithium-Gewinnung zuständige Abteilung der staatlichen Bergbaubehörde COMIBOL. Er sitzt an seinem Schreibtisch unter einem Porträt von Präsident Evo Morales. Echazús graues Haar ist akkurat gescheitelt, der Anzug kleinkariert. Er nennt Termine und Zahlen:
"Unsere Pilotanlage wird im ersten Trimester 2011 Lithiumkarbonat produzieren. Aber wir wollen auch die Pottasche nutzen, die beim Verdunstungsverfahren herauskristallisiert wird, und daraus Dünger machen. Für 2013 planen wir die Eröffnung einer Pottasche-Fabrik. Was das Lithiumkarbonat angeht, erwarten wir eine Produktion von 40 Tonnen monatlich, etwa ab Mitte nächsten Jahres. Und 2014 haben wir voraussichtlich eine richtige Industrie-Anlage."
"100 Prozent bolivianisch" – das heißt, dass die Regierung die industrielle Produktion von Lithiumkarbonat und Pottasche auch selbst finanzieren will. Mit eigenem Geld, Bankkrediten und Zukunftsverkäufen, bei denen erst bezahlt und später Lithiumkarbonat geliefert werde, erklärt Luís Alberto Echazú. Auf 450 Millionen US-Dollar schätzt er die Kosten für die Errichtung beider Fabriken. Für die Lithium-Weiterverarbeitung, also etwa die Produktion von Batterien, will die Regierung dann ausländische Partner ins Boot holen:
"Bedingung ist, dass sie akzeptieren, dass der bolivianische Staat den Rohstoff alleine fördert, und dass dieser in Bolivien weiterverarbeitet wird – in der Nähe unserer Fabrik für Lithiumkarbonat. Bedingung ist auch, dass bei allen Unternehmungen die Aktienmehrheit der Staat hat."
Das Interesse ausländischer Firmen am bolivianischen Lithium ist riesig. Doch ob eine von ihnen die Bedingungen der Regierung Morales akzeptieren wird, ist ungewiss. Sieben oder acht Bewerber haben laut Vize-Präsident Alvaro García Linera Projekte eingereicht. Manch ein Investor hatte es sich wohl leichter vorgestellt. Die französische Bolloré-Gruppe verhandelte zwei Jahre lang in La Paz. Ihr Angebot sah den Bau einer Batterienfabrik im Land vor. Doch das Unternehmen wollte von Anfang an dabei sein und auch bei der Herstellung von Lithiumkarbonat mit den Bolivianern zusammenarbeiten – diese winkten ab. Unterzeichnet hat Bolivien bislang lediglich Absichtserklärungen über technologische Zusammenarbeit mit Südkorea, Japan, Iran und Brasilien.
Ein gutbesuchtes Café in La Paz, im südlichen Stadtteil Sopocachi. Juan Carlos Zuleta rührt stirnrunzelnd in seinem Capucchino. Der bärtige Wirtschaftswissenschaftler im Wollpulli gehört in Bolivien zu den Kritikern des Vorgehens der Regierung:
"Was das Lithium nicht nur für unser Land, sondern für die ganze Welt bedeutet, scheint unsere Regierung nicht zu begreifen. Bisher hat sie keine Strategie für den Aufbau einer Lithium-Industrie."
Zuleta hält für einen schweren Irrtum, dass die bolivianische Regierung das Rad neu erfinden wolle:
"Es war nicht nötig, bei null anzufangen. Andernorts wird seit vielen Jahren Lithiumkarbonat erzeugt, die Verfahren sind bekannt. Das Vorgehen unserer Regierung verzögert die Industrialisierung Boliviens – und das in einem Moment, in dem viel davon abhängt, ob Bolivien in den Weltmarkt eintritt. Mit unseren riesigen Reserven könnten wir die Entwicklung des Lithium-Weltmarktes in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen. Manche sagen zwar, dass es in der Welt bereits genug Lithium gibt, um den Bedarf zu decken. Aber es geht auch darum, dass der Preis sinkt – damit die Akkus billiger werden und damit die Elektroautos."
Von Boliviens Lithium hängt ab, ob das Elektroauto einmal für Konsumenten weltweit erschwinglich wird – davon ist Juan Carlos Zuleta überzeugt. Der Wirtschaftswissenschaftler hat Angst, dass sein Land dieser Verantwortung nicht gerecht werden könnte:
"Wir sind ein kleines Land, aber das bedeutet nicht, dass wir für immer arm bleiben müssen. Wenn unsere Regierung die Orientierung verliert, und ihre große Verantwortung nicht erkennt, dann verliert Bolivien eine riesige Entwicklungschance."
Im Zentrum von Uyuni, der 10.000-Einwohner-Stadt am Salzsee. Uyuni besteht aus staubigen Straßen und einer kleinen Fußgängerzone. Touristen mit Sonnenbrillen und Hüten erfrischen sich in Straßencafés. Rund 80 Agenturen bieten Exkursionen auf den See an. Potosí ist die am schwächsten entwickelte Region Boliviens, wo fast jeder Dritte in extremer Armut lebt. In Potosí sind etwa zwei Drittel der Menschen extrem arm. Doch die Bewohner der Kleinstadt Uyuni haben in den letzten zwei Jahrzehnten einen bescheidenen Aufschwung erlebt, wie Hernán Juarez, der Leiter des kleinen Tourismus-Büros, erzählt:
"Ich bin sicher, dass dieses Industrie-Projekt langfristig Auswirkungen haben wird, wie das bei jeder Rohstoff-Förderung der Fall ist. Es wäre gut zu erfahren, welche Konsequenzen die Lithium-Gewinnung für den Uyuni-Salzsee haben wird. Mit Sicherheit wird der Tourismus langfristig in irgendeiner Form beeinträchtigt werden."
Außer vom Tourismus leben die Einwohner der Region Potosí vom Anbau des Quinoa-Getreides, von der Lama-Zucht und der Salzgewinnung. Marcelino Moreira ist Generalsekretär der Campesino-Gewerkschaft FRUTCAS in Uyuni. Der Bauer setzt Hoffnungen in die Lithium-Gewinnung, aber die Region müsse davon profitieren:
"Viele Menschen sind von hier nach Chile und Argentinien gezogen, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir wollen, dass hier investiert wird, damit sie zurückkommen. Unsere Region ist lange vernachlässigt worden. Der Aufbau einer Lithium-Industrie am Uyuni-Salzsee wird uns Entwicklung bringen. Natürlich, Lithium ist ein strategischer Rohstoff für unser Land, aber er muss es auch für diese Region sein."
Auf dem Salar de Uyuni im Südwesten Boliviens, dem größten Salzsee der Welt. Nur von Dezember bis März, wenn es regnet, ähnelt der Salar wirklich einem See. Die dicke Salzkruste ist dann von Wasser bedeckt. Während der restlichen Monate wird der Salar de Uyuni zur Salzwüste, 12.000 Quadratkilometer groß. Die weiße Kruste erinnert an gefrorenen Schnee, sie ist von einem wabenähnlichen Muster überzogen.
Der Uyuni-Salzsee liegt auf gut 3.600 Metern Höhe in der bolivianischen Region Potosí. 2009 zog der See mehr als 80.000 Besucher aus der ganzen Welt an. Doch seit ein paar Jahren interessiert der Salar de Uyuni nicht nur Touristen, sondern auch ausländische Rohstoff-Unternehmen und Auto-Hersteller. Denn unter seiner Oberfläche verbirgt sich ein Schatz: die weltweit größten Vorkommen des Leichtmetalls Lithium. Neun Millionen Tonnen nach Schätzungen des Geologischen Dienstes der USA, doppelt so viel laut bolivianischer Regierung. Lithium ist Grundstoff hochpotenter, aufladbarer Batterien, die Elektrofahrzeuge antreiben. An der Entwicklung dieser umweltfreundlichen Vehikel arbeitet die internationale Automobil-Industrie auf Hochtouren.
"Was machen wir mit unseren Lithium-Reserven? Wir wollen Batterien herstellen, genauer gesagt Lithium-Ionen-Akkus – für Elektroautos, aber auch für Uhren, Taschenrechner oder Mobiltelefone. Auch Elektrofahrzeuge würden wir gerne hier in Bolivien produzieren."
… erklärt Gonzalo Alfaro, ein hochgewachsener Ingenieur, und rückt seinen weißen Helm zurecht. Alfaro ist leitender Mitarbeiter einer Pilotanlage zur Lithium-Gewinnung, die die bolivianische Regierung 15 Kilometer enfernt vom Uyuni-Salzsee baut: Mehrere weiße Gebäude mit verspiegelten Scheiben stehen schon. Gonzalo Alfaro betrachtet das halbfertige Labor. Der Stolz auf das, was hier entsteht, ist ihm anzumerken:
"Die Lithium-Reserven bedeuten für Bolivien Fortschritt, Wachstum, Unabhängigkeit und Nationalismus. Sie machen uns Bolivianern Mut."
Noch ist die Herstellung von Lithium-Batterien und Elektroautos in Bolivien Zukunftsmusik. Doch nicht nur Ingenieur Alfaro träumt diesen Traum. Auch Präsident Evo Morales am 550 Kilometer entfernten Regierungssitz La Paz tut es. Sein Ziel: Bolivien soll das Lithium nicht nur selbst aus dem Salzsee holen, sondern auch eine weiterverarbeitende Industrie aufbauen. Der Sozialist Morales wird nicht müde, über die Hoffnung zu sprechen, die der begehrte Rohstoff für sein Land bedeute. Bei einem Lithium-Kongress in La Paz wandte sich Boliviens erster indigener Präsident vor einem Jahr an die internationalen Teilnehmer:
"In unserer Geschichte wurden wir immer wieder ausgeplündert, wir Bolivianer, ein armes Volk. Wenn wir das Lithium nicht in unserem Land weiterverarbeiten, werden wir Bolivien niemals verändern. Dann werden wir weiter ausgebeutet, und andere Länder nehmen unsere Bodenschätze mit, so wie die Spanier das Silber aus Potosí. Diese Geschichte darf sich nicht wiederholen, nicht mit unserem Lithium, nicht mit unserem Eisen und nicht mit unserem Erdöl."
Unter spanischer Kolonialherrschaft schufteten im 16. und 17. Jahrhundert Zehntausende von Indio-Sklaven im Silberbergwerk von Potosí. Zwar gibt es heute keine derartige Ausplünderung mehr, doch Bolivien, das ärmste Land Südamerikas, exportiert die meisten seiner Rohstoffe: Erdgas und Öl, Agrarprodukte, Metalle und Mineralien. Der Bergbausektor wird von ausländischen Firmen dominiert, beim Leichtmetall aus dem Uyuni-Salzsee soll nun alles anders werden. "Ein zu 100 Prozent bolivianisches Projekt" lautet die Devise der Regierung für die Lithium-Gewinnung – das heißt, die Extraktion aus dem See und die Verarbeitung zu Lithiumkarbonat.
Zurück in der südwestlichen Region Potosí. Von der staatlichen Pilotanlage führt eine Schotterpiste über die karge Hochebene, das Altiplano, bis zum Salar de Uyuni. Chemie-Ingenieur Miguel Parra, ein ernsthafter, dynamisch wirkender Mann Ende 30, ist mit einem Jeep unterwegs zu seiner Arbeitsstelle auf dem Salzsee. Eine knappe halbe Stunde dauert es bis zum Ufer – dann braust das Fahrzeug über die harte Salzkruste und hält nach weiteren zehn Minuten.
"Das ist eines der Löcher, die wir gebohrt haben – 30 Meter tief. Daraus pumpen wir die Salzlauge, die unter der Kruste fließt und Lithium enthält."
Parra trägt eine Vliesjacke und schützt seine Augen mit einer dunklen Brille vor der gleißenden Sonne. Vom Bohrloch sind es nur ein paar Schritte zu einer Reihe von Becken, die der bolivianische Experte auf der Salzkruste errichtet hat. Sie sind jeweils fünf mal zehn Meter groß:
"Dies sind meine Versuchsbecken. Der erste Schritt ist, dass wir aus der Salzlauge durch eine chemische Reaktion die Sulfate herausholen, die wir nicht gebrauchen können. Anschließend kommt die Lauge in das erste Verdunstungsbecken, wo sich das Mineral Halit herauskristallisiert."
Halit, besser bekannt unter dem Namen Steinsalz, hat sich in blassrosa Kristallen am Beckenrand abgesetzt. Insgesamt wird die Salzlauge durch vier Verdunstungsbecken geleitet. Die Verdunstung ist das Verfahren zur Lithium-Gewinnung, das Miguel Parra auf dem Uyuni-Salzsee erprobt hat. Unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung und Wind setzen sich nacheinander verschiedene Salze ab, darunter Pottasche und Magnesiumchlorid, bis eine grünliche, ölige Flüssigkeit übrigbleibt. In ihr befindet sich reines Lithium. Chemie-Ingenieur Parra beugt sich über das vierte Becken und begutachtet zufrieden das Ergebnis:
"Hier endet der Verdunstungsprozess. Die konzentrierte Lithium-Flüssigkeit werden wir in die Fabrik bringen. Dort kann dann unter Zugabe einiger chemischer Elemente Lithiumkarbonat erzeugt werden."
Das weiße Pulver also, das für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus benötigt wird. In diesem Monat will Parra auf dem Salar de Uyuni mit der Verdunstung in großem Stil beginnen. Riesige Becken, 300 Meter lang und 150 Meter breit, warten bereits auf die Einleitung von Salzlauge. Wenn in einigen Monaten voraussichtlich große Mengen von Lithium-Flüssigkeit zur Verfügung stehen, soll die staatliche Pilotanlage am Salzsee den Betrieb aufnehmen.
Ein moderner Büroturm unweit des Prado, der Flaniermeile von La Paz. Mit dem Aufzug geht es in den neunten Stock. Luís Alberto Echazú leitet die für die Lithium-Gewinnung zuständige Abteilung der staatlichen Bergbaubehörde COMIBOL. Er sitzt an seinem Schreibtisch unter einem Porträt von Präsident Evo Morales. Echazús graues Haar ist akkurat gescheitelt, der Anzug kleinkariert. Er nennt Termine und Zahlen:
"Unsere Pilotanlage wird im ersten Trimester 2011 Lithiumkarbonat produzieren. Aber wir wollen auch die Pottasche nutzen, die beim Verdunstungsverfahren herauskristallisiert wird, und daraus Dünger machen. Für 2013 planen wir die Eröffnung einer Pottasche-Fabrik. Was das Lithiumkarbonat angeht, erwarten wir eine Produktion von 40 Tonnen monatlich, etwa ab Mitte nächsten Jahres. Und 2014 haben wir voraussichtlich eine richtige Industrie-Anlage."
"100 Prozent bolivianisch" – das heißt, dass die Regierung die industrielle Produktion von Lithiumkarbonat und Pottasche auch selbst finanzieren will. Mit eigenem Geld, Bankkrediten und Zukunftsverkäufen, bei denen erst bezahlt und später Lithiumkarbonat geliefert werde, erklärt Luís Alberto Echazú. Auf 450 Millionen US-Dollar schätzt er die Kosten für die Errichtung beider Fabriken. Für die Lithium-Weiterverarbeitung, also etwa die Produktion von Batterien, will die Regierung dann ausländische Partner ins Boot holen:
"Bedingung ist, dass sie akzeptieren, dass der bolivianische Staat den Rohstoff alleine fördert, und dass dieser in Bolivien weiterverarbeitet wird – in der Nähe unserer Fabrik für Lithiumkarbonat. Bedingung ist auch, dass bei allen Unternehmungen die Aktienmehrheit der Staat hat."
Das Interesse ausländischer Firmen am bolivianischen Lithium ist riesig. Doch ob eine von ihnen die Bedingungen der Regierung Morales akzeptieren wird, ist ungewiss. Sieben oder acht Bewerber haben laut Vize-Präsident Alvaro García Linera Projekte eingereicht. Manch ein Investor hatte es sich wohl leichter vorgestellt. Die französische Bolloré-Gruppe verhandelte zwei Jahre lang in La Paz. Ihr Angebot sah den Bau einer Batterienfabrik im Land vor. Doch das Unternehmen wollte von Anfang an dabei sein und auch bei der Herstellung von Lithiumkarbonat mit den Bolivianern zusammenarbeiten – diese winkten ab. Unterzeichnet hat Bolivien bislang lediglich Absichtserklärungen über technologische Zusammenarbeit mit Südkorea, Japan, Iran und Brasilien.
Ein gutbesuchtes Café in La Paz, im südlichen Stadtteil Sopocachi. Juan Carlos Zuleta rührt stirnrunzelnd in seinem Capucchino. Der bärtige Wirtschaftswissenschaftler im Wollpulli gehört in Bolivien zu den Kritikern des Vorgehens der Regierung:
"Was das Lithium nicht nur für unser Land, sondern für die ganze Welt bedeutet, scheint unsere Regierung nicht zu begreifen. Bisher hat sie keine Strategie für den Aufbau einer Lithium-Industrie."
Zuleta hält für einen schweren Irrtum, dass die bolivianische Regierung das Rad neu erfinden wolle:
"Es war nicht nötig, bei null anzufangen. Andernorts wird seit vielen Jahren Lithiumkarbonat erzeugt, die Verfahren sind bekannt. Das Vorgehen unserer Regierung verzögert die Industrialisierung Boliviens – und das in einem Moment, in dem viel davon abhängt, ob Bolivien in den Weltmarkt eintritt. Mit unseren riesigen Reserven könnten wir die Entwicklung des Lithium-Weltmarktes in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen. Manche sagen zwar, dass es in der Welt bereits genug Lithium gibt, um den Bedarf zu decken. Aber es geht auch darum, dass der Preis sinkt – damit die Akkus billiger werden und damit die Elektroautos."
Von Boliviens Lithium hängt ab, ob das Elektroauto einmal für Konsumenten weltweit erschwinglich wird – davon ist Juan Carlos Zuleta überzeugt. Der Wirtschaftswissenschaftler hat Angst, dass sein Land dieser Verantwortung nicht gerecht werden könnte:
"Wir sind ein kleines Land, aber das bedeutet nicht, dass wir für immer arm bleiben müssen. Wenn unsere Regierung die Orientierung verliert, und ihre große Verantwortung nicht erkennt, dann verliert Bolivien eine riesige Entwicklungschance."
Im Zentrum von Uyuni, der 10.000-Einwohner-Stadt am Salzsee. Uyuni besteht aus staubigen Straßen und einer kleinen Fußgängerzone. Touristen mit Sonnenbrillen und Hüten erfrischen sich in Straßencafés. Rund 80 Agenturen bieten Exkursionen auf den See an. Potosí ist die am schwächsten entwickelte Region Boliviens, wo fast jeder Dritte in extremer Armut lebt. In Potosí sind etwa zwei Drittel der Menschen extrem arm. Doch die Bewohner der Kleinstadt Uyuni haben in den letzten zwei Jahrzehnten einen bescheidenen Aufschwung erlebt, wie Hernán Juarez, der Leiter des kleinen Tourismus-Büros, erzählt:
"Ich bin sicher, dass dieses Industrie-Projekt langfristig Auswirkungen haben wird, wie das bei jeder Rohstoff-Förderung der Fall ist. Es wäre gut zu erfahren, welche Konsequenzen die Lithium-Gewinnung für den Uyuni-Salzsee haben wird. Mit Sicherheit wird der Tourismus langfristig in irgendeiner Form beeinträchtigt werden."
Außer vom Tourismus leben die Einwohner der Region Potosí vom Anbau des Quinoa-Getreides, von der Lama-Zucht und der Salzgewinnung. Marcelino Moreira ist Generalsekretär der Campesino-Gewerkschaft FRUTCAS in Uyuni. Der Bauer setzt Hoffnungen in die Lithium-Gewinnung, aber die Region müsse davon profitieren:
"Viele Menschen sind von hier nach Chile und Argentinien gezogen, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir wollen, dass hier investiert wird, damit sie zurückkommen. Unsere Region ist lange vernachlässigt worden. Der Aufbau einer Lithium-Industrie am Uyuni-Salzsee wird uns Entwicklung bringen. Natürlich, Lithium ist ein strategischer Rohstoff für unser Land, aber er muss es auch für diese Region sein."